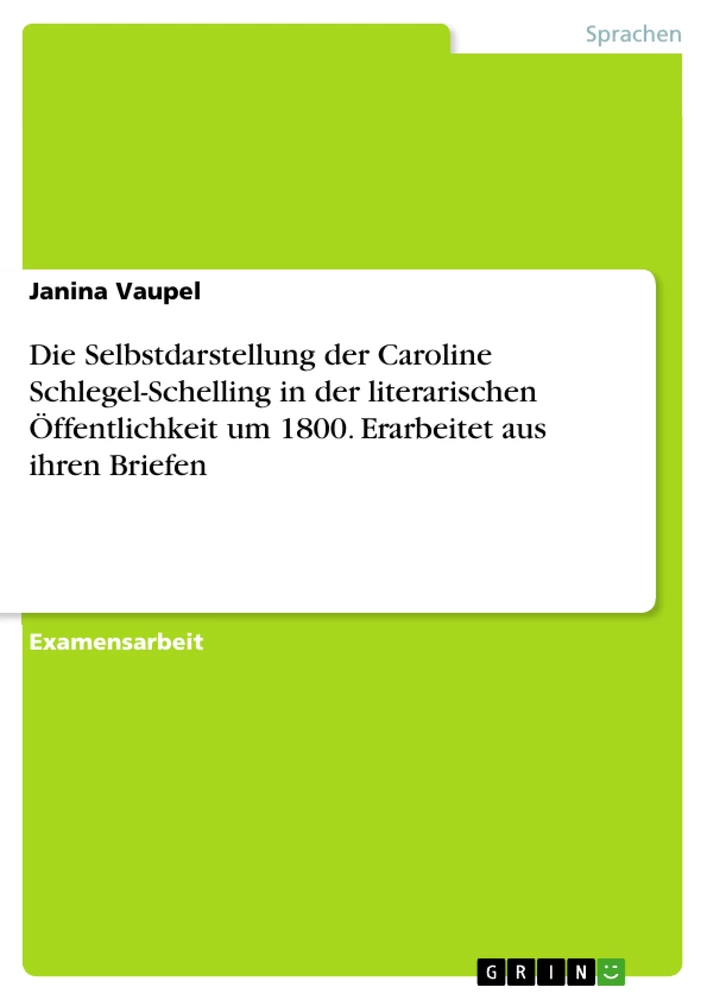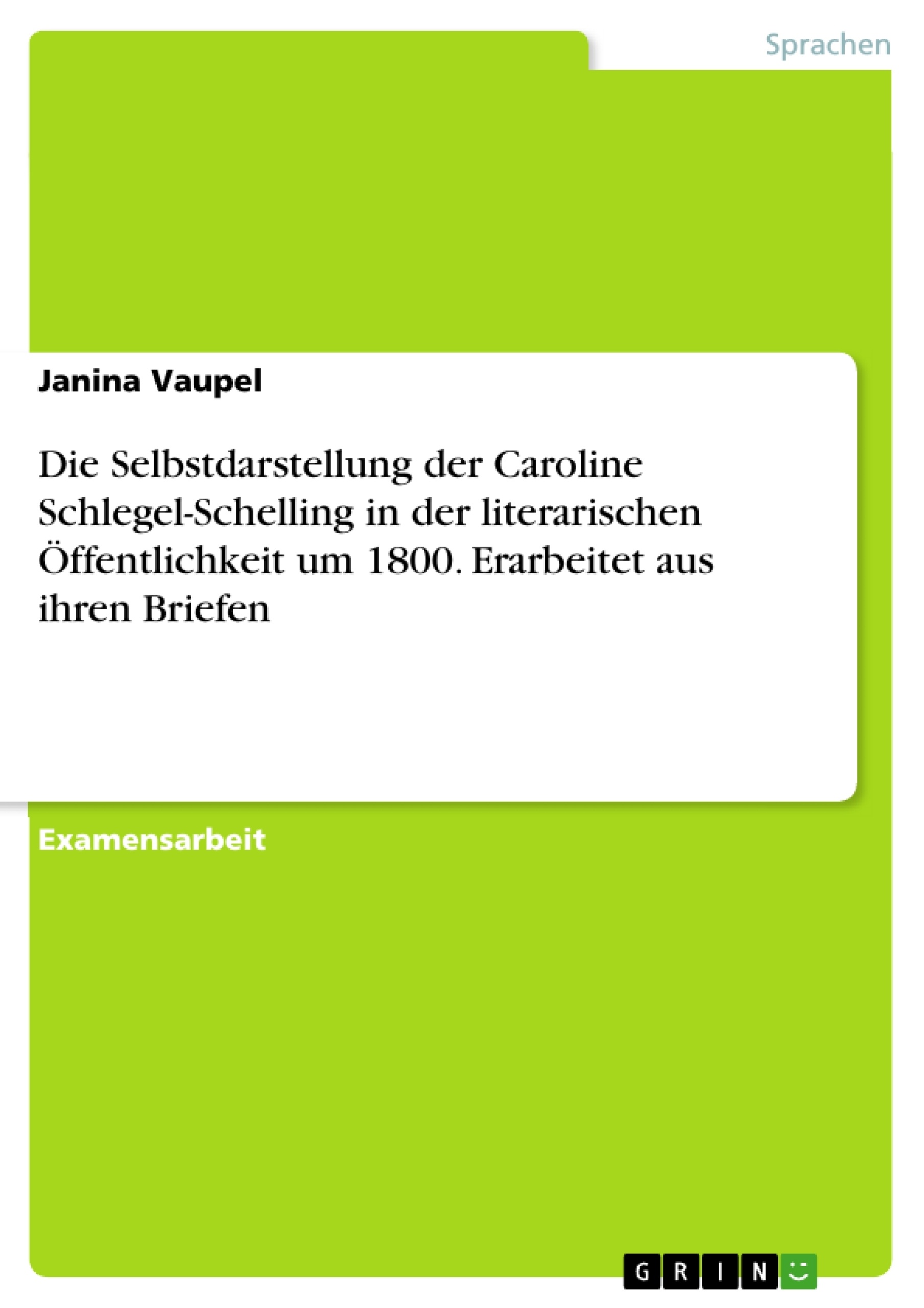„Über ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen (…).“ Diese spöttischen Äußerungen stammen aus einem Brief der Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling (1763-1809). Bei Caroline, Tochter des Göttinger Professors Michaelis, verwitwete Böhmer, geschiedene Schlegel, am Ende glücklich verheiratete Schelling, handelt es sich um eine der interessantesten Frauenpersönlichkeiten ihrer Zeit. Die selbstbewusste Frau, deren Leben keineswegs in geraden Bahnen verlief und einige Schicksalsschläge mit sich brachte, war eine überaus fleißige Briefeschreiberin. Mehrere hundert Briefe – entweder von ihr selbst geschrieben, oder aber an sie adressiert – sind gewissermaßen als ihr Nachlass erhalten geblieben. Ihre zahlreichen Briefe erlauben uns dabei nicht nur Einblicke in die Ereignisse und die Gesellschaft um die Jahrhundertwende 1800, sondern zeugen in besonderem Maße von den Tätigkeiten Carolines als Übersetzerin und Rezensentin. Sie korrespondierte unter anderem mit Goethe, Schiller, Fichte und Novalis, um nur einige berühmte Namen aus ihrem Umfeld zu nennen. Um diese und weitere intellektuelle Köpfe formierte sich der sogenannte Jenaer Kreis, aus dem heraus sich die Romantik in Deutschland entwickelte. Caroline war mittendrin – und prägte mit ihren Beiträgen die Frühromantik.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Carolines Leben – ein Kurzportrait
- III. Carolines literarische Unternehmungen aus ihrer eigenen Sicht
- III.1 Literarische Unternehmungen
- III.2 Carolines Selbstdarstellung
- IV. „Man schätzt ein Frauenzimmer nur nach dem, was sie als Frauenzimmer ist“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstdarstellung Caroline Schlegel-Schellings in der literarischen Öffentlichkeit um 1800 anhand ihrer Briefe. Ziel ist es, ein umfassendes Bild ihrer Rolle als Schriftstellerin, Übersetzerin und Rezensentin zu zeichnen und ihren Beitrag zur Frühromantik zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt die bestehenden biographischen Darstellungen und analysiert, wie diese Carolines Leben und Werk interpretieren.
- Carolines Leben und ihre vielfältigen Rollen
- Carolines literarische Tätigkeiten (Übersetzung, Rezension)
- Carolines Selbstverständnis und ihre Selbstdarstellung in Briefen
- Der Stellenwert von Carolines Briefen als literarische Quelle
- Carolines Beitrag zur Frühromantik und zum Jenaer Kreis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Caroline Schlegel-Schelling als eine der interessantesten Frauenpersönlichkeiten ihrer Zeit vor. Sie hebt die Bedeutung von Carolines Briefen als Quelle für Einblicke in ihr Leben, ihre Zeit und ihre literarischen Tätigkeiten hervor. Die Einleitung diskutiert außerdem die bestehende Forschungsliteratur zu Caroline Schlegel-Schelling und deren unterschiedliche Schwerpunkte, insbesondere die Fokussierung auf ihre Selbstverwirklichung und ihren Einfluss auf die Frühromantik. Es wird der Ansatz dieser Arbeit erläutert, der sich auf die Selbstdarstellung Carolines in ihren Briefen konzentriert.
II. Carolines Leben – ein Kurzportrait: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über das Leben von Caroline Schlegel-Schelling, von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Es skizziert die wichtigsten Stationen ihres Lebens, ihre Ehen, ihre Beziehungen zu wichtigen Intellektuellen des Jenaer Kreises und die Herausforderungen, denen sie sich als Frau im ausgehenden 18. Jahrhundert gegenüber sah. Der Fokus liegt auf der Darstellung ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensumstände, um das Verständnis ihrer literarischen Aktivitäten zu kontextualisieren.
III. Carolines literarische Unternehmungen aus ihrer eigenen Sicht: Dieses Kapitel analysiert Carolines literarische Tätigkeiten, wie Übersetzungen und Rezensionen, aus ihrer eigenen Perspektive, in erster Linie basierend auf ihren Briefen. Es wird untersucht, wie sie ihre Arbeit wahrnahm, welche Ziele sie verfolgte und wie sie ihre Rolle als Schriftstellerin in der Öffentlichkeit verstand. Die Selbstdarstellung Carolines steht hier im Mittelpunkt der Analyse. Das Kapitel beleuchtet, wie sie ihre literarischen Leistungen und ihr intellektuelles Engagement in ihren Briefen präsentierte und welche Strategien sie verwendete, um sich selbst und ihre Arbeit zu positionieren.
IV. „Man schätzt ein Frauenzimmer nur nach dem, was sie als Frauenzimmer ist“: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen im ausgehenden 18. Jahrhundert und deren Einfluss auf Carolines Leben und Werk. Es analysiert, wie Caroline mit diesen Erwartungen umgegangen ist, wie sie sich in einer von Männern dominierten intellektuellen Welt positionierte und welche Herausforderungen sie aufgrund ihres Geschlechts bewältigen musste. Die Analyse basiert auf ihren Briefen und berücksichtigt die bestehende Forschung zum Thema Frauen und Literatur in dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Caroline Schlegel-Schelling, Frühromantik, Jenaer Kreis, Briefe, Selbstdarstellung, Literatur, Übersetzungen, Rezensionen, Frauenrolle, Selbstverwirklichung, Emanzipation, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: Caroline Schlegel-Schelling – Selbstdarstellung in Briefen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Selbstdarstellung Caroline Schlegel-Schellings in der literarischen Öffentlichkeit um 1800 anhand ihrer Briefe. Ziel ist es, ein umfassendes Bild ihrer Rolle als Schriftstellerin, Übersetzerin und Rezensentin zu zeichnen und ihren Beitrag zur Frühromantik zu beleuchten. Die Arbeit analysiert auch, wie bestehende biographische Darstellungen Carolines Leben und Werk interpretieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Carolines Leben und ihre vielfältigen Rollen; ihre literarischen Tätigkeiten (Übersetzung, Rezension); ihr Selbstverständnis und ihre Selbstdarstellung in Briefen; den Stellenwert ihrer Briefe als literarische Quelle; und ihren Beitrag zur Frühromantik und zum Jenaer Kreis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel I (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt Caroline Schlegel-Schelling vor. Kapitel II (Carolines Leben – ein Kurzportrait) bietet einen biographischen Überblick. Kapitel III (Carolines literarische Unternehmungen aus ihrer eigenen Sicht) analysiert Carolines literarische Tätigkeiten anhand ihrer Briefe. Kapitel IV („Man schätzt ein Frauenzimmer nur nach dem, was sie als Frauenzimmer ist“) befasst sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und deren Einfluss auf Carolines Leben und Werk.
Wie wird die Selbstdarstellung Carolines untersucht?
Die Selbstdarstellung Carolines wird primär anhand ihrer Briefe untersucht. Die Arbeit analysiert, wie sie ihre Arbeit wahrnahm, welche Ziele sie verfolgte, wie sie ihre Rolle als Schriftstellerin verstand und wie sie sich selbst und ihre Arbeit in ihren Briefen präsentierte.
Welche Bedeutung haben Carolines Briefe für diese Arbeit?
Carolines Briefe bilden die zentrale Quelle für diese Arbeit. Sie liefern Einblicke in ihr Leben, ihre Zeit, ihre literarischen Tätigkeiten und ihre Selbstdarstellung. Die Arbeit untersucht die Briefe als literarische Quelle und analysiert, wie sie Carolines Selbstverständnis und ihre Positionierung in der Öffentlichkeit widerspiegeln.
Welche Rolle spielt die Frühromantik in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet Carolines Beitrag zur Frühromantik und zum Jenaer Kreis. Sie untersucht, wie sich ihre literarischen Tätigkeiten und ihre Selbstverwirklichung in den Kontext der Frühromantik einordnen lassen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Caroline Schlegel-Schelling, Frühromantik, Jenaer Kreis, Briefe, Selbstdarstellung, Literatur, Übersetzungen, Rezensionen, Frauenrolle, Selbstverwirklichung, Emanzipation, 18. Jahrhundert.
Welche Forschungsliteratur wird berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die bestehende biographische und literaturwissenschaftliche Forschungsliteratur zu Caroline Schlegel-Schelling und zum Thema Frauen und Literatur im ausgehenden 18. Jahrhundert. Der Ansatz dieser Arbeit konzentriert sich jedoch auf die Analyse der Selbstdarstellung in ihren Briefen.
- Quote paper
- Dipl. Gymnasiallehrerin Janina Vaupel (Author), 2014, Die Selbstdarstellung der Caroline Schlegel-Schelling in der literarischen Öffentlichkeit um 1800. Erarbeitet aus ihren Briefen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304582