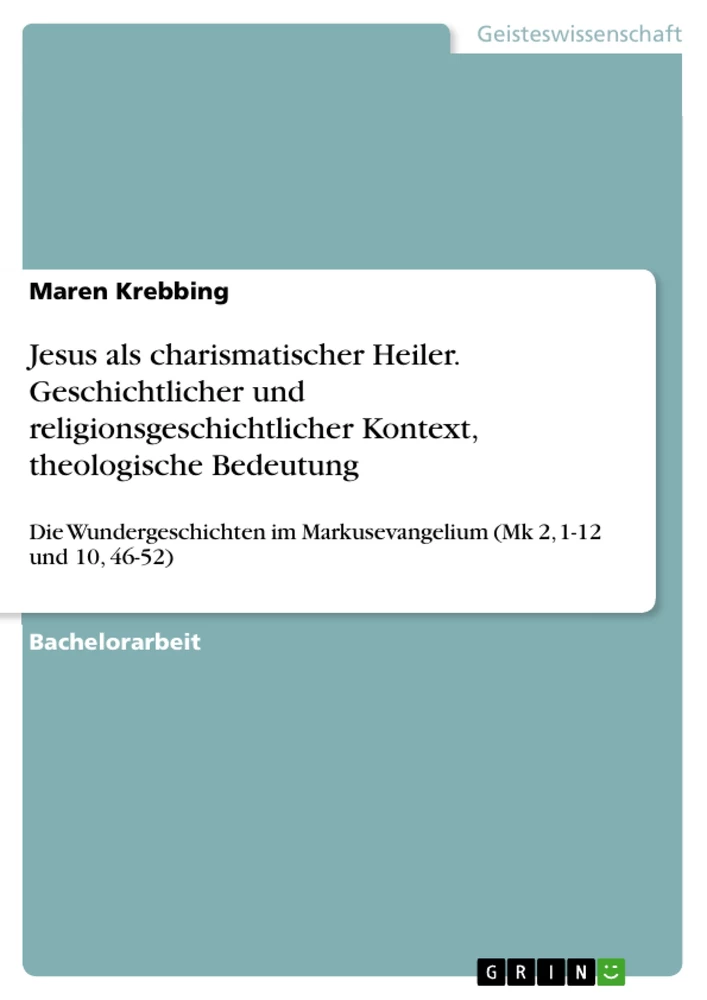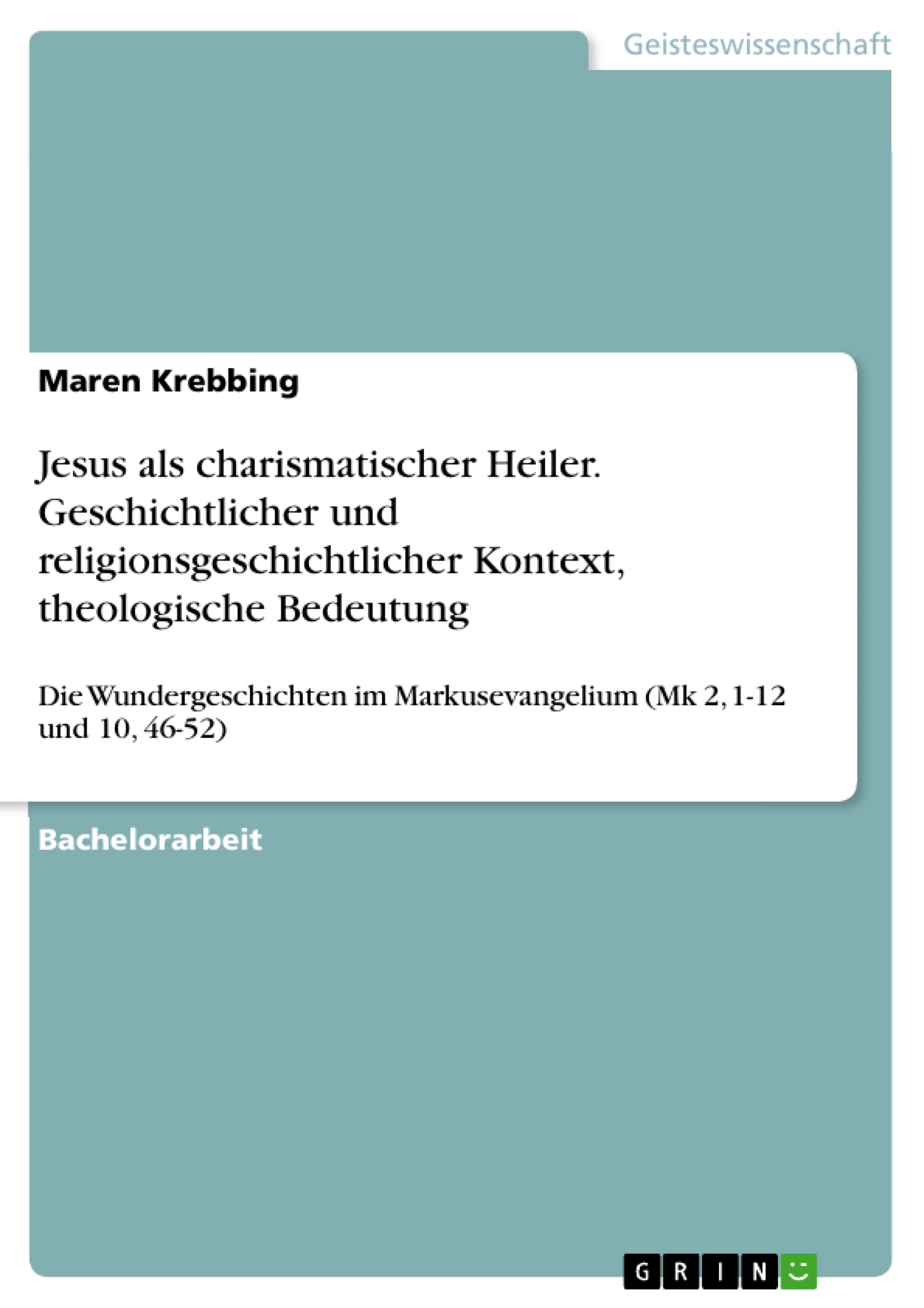In der vorliegenden Arbeit soll die Person Jesu als charismatischer Wunderheiler vorgestellt werden. Was sind Wunder? Und was bedeutet überhaupt charismatischer Heiler? Wie genau hat Jesus die Kranken von ihrem Leid befreit? Was möchte uns Jesus mit einer Krankenheilung mitteilen? Was hat eine Wundererzählung mit der heutigen Zeit zu tun? Sind dies allein alte Geschichte, die nichts mehr für unsere heutige Umwelt aussagen?
Mit diesen Fragen möchte ich mich gerne in meiner Bachelorarbeit beschäftigen. Auch in der gegenwärtigen Forschung kommt es noch immer zu Wiedersprüchen, ob Jesus als Heiler mit göttlicher Macht gehandelt hat oder ob dahinter nicht doch einfach ein verrückter Magier gesteckt haben könnte. Hierzu werde ich zwei seiner Wunderheilungen untersuchen, zum einen die Heilung eines Gelähmten und zum anderen die Heilung eines Blinden bei Jericho.
Dabei beziehe ich mich in meiner Arbeit auf die Erzählungen des Evangelisten Markus. Zunächst werde ich die Bedeutung eines Wunders aus antiker sowie aus heutiger Sichtweise veranschaulichen, sodass auch der Sinn und die Möglichkeiten des Verstehens solcher Erzählungen deutlich werden. Danach gehe ich auf das biblische Verständnis von Wundern, sowie das Verständnis des Evangelisten Markus ein. Anschließend erläutere ich kurz den typischen Aufbau einer Wundererzählung.
Im Kapitel 3 bis 5 folgt dann der Hauptteil meiner Bachelorarbeit, in dem ich zunächst Jesus als charismatischen Heiler beschreibe und schließlich die beiden Wundererzählungen des Markusevangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Jesus als Heiler analysiere. Hierbei gehe ich auf den Kontext und Aufbau, den Traditionshintergrund sowie die Interpretation und Deutungshorizonte der jeweiligen Wundererzählung ein. Abschließend folgt dann ein Fazit meiner Bachelorarbeit. Im Anhang dieser Arbeit habe ich die beiden Wundererzählungen des Markusevangeliums aus einer Einheitsübersetzung beigefügt, sodass die Analyse dieser Erzählungen besser nachzuvollziehen ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Person Jesus als charismatischen Heiler anhand von zwei Wundergeschichten des Markusevangeliums darzustellen. Die theoretische Grundlage meiner Arbeit beruht vor allem auf Quellen aus ausgewählter Fachliteratur von A. Weiser, B. Kollmann, C. Böttrich und R. Zimmermann. Des Weiteren habe ich mich auf theologische Kommentare von W. Grundmann, W. Eckey, J. Gnilka, P. Dschulnigg und L. Schenke bezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wunderbegriff
- 2.1 Heutiges Verständnis von Wundern
- 2.2 Antikes Verständnis von Wundern
- 2.3 Biblisches Verständnis von Wundern
- 2.4 Das Wunderverständnis des Evangelisten Markus
- 2.5 Aufbau einer Wundererzählung im Neuen Testament
- 3 Jesus als charismatischer Heiler
- 4 Die Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12)
- 4.1 Kontext
- 4.2 Aufbau
- 4.3 Traditionshintergrund
- 4.4 Interpretation
- 4.5 Deutungshorizonte
- 5 Der blinde Bartimäus (Mk 10, 46-52)
- 5.1 Kontext
- 5.2 Aufbau
- 5.3 Traditionshintergrund
- 5.4 Interpretation
- 5.5 Deutungshorizonte
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Jesus als charismatischen Heiler, indem sie zwei Wunderheilungen aus dem Markusevangelium analysiert: die Heilung des Gelähmten und die Heilung des blinden Bartimäus. Die Arbeit beleuchtet den historischen und religionsgeschichtlichen Kontext der Wunder, untersucht verschiedene Verständnisweisen des Wunderbegriffs (heutiges, antikes, biblisches und das des Evangelisten Markus) und interpretiert die ausgewählten Wundererzählungen im Hinblick auf ihre theologische Bedeutung.
- Der Wunderbegriff in verschiedenen Kontexten (heutiger, antiker, biblischer)
- Jesus als charismatischer Heiler
- Analyse der Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12)
- Analyse der Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10, 46-52)
- Theologische Bedeutung der Wunderheilungen Jesu
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wunderheilungen Jesu ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Sie stellt die zentrale These auf, Jesus als charismatischen Heiler darzustellen, und begründet die Wahl der beiden ausgewählten Wundergeschichten aus dem Markusevangelium. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas, insbesondere die anhaltende Debatte um die Natur der Wunderheilungen Jesu und deren Bedeutung für das heutige Verständnis.
2 Wunderbegriff: Dieses Kapitel untersucht den Wunderbegriff aus verschiedenen Perspektiven: dem heutigen Verständnis, dem antiken Verständnis und dem biblischen Verständnis, mit besonderem Fokus auf das Verständnis des Evangelisten Markus. Es differenziert zwischen verschiedenen Auffassungen von Wundern und beleuchtet die Herausforderungen, die die Interpretation solcher Ereignisse mit sich bringt, sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus theologischer Sicht. Der Abschnitt legt das Fundament für die Analyse der Wundergeschichten im weiteren Verlauf der Arbeit.
3 Jesus als charismatischer Heiler: Dieses Kapitel legt den Fokus auf die Darstellung Jesu als charismatischer Heiler. Es beleuchtet die Eigenschaften und die Ausdrucksformen dieser Rolle innerhalb des historischen und religiösen Kontexts. Dieser Abschnitt vertieft das Verständnis der zentralen Rolle Jesu als Heiler und bereitet den Boden für die detaillierte Analyse der Wundererzählungen in den folgenden Kapiteln. Die Kapitel verbindet die Rolle Jesu als Heiler mit der Interpretation und Deutung der folgenden Wundergeschichten.
4 Die Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12): Diese Kapitel analysiert die Wunderheilung des Gelähmten im Markusevangelium (Mk 2,1-12) detailliert. Es untersucht den Kontext der Erzählung, ihren Aufbau, den Traditionshintergrund und bietet verschiedene Interpretationsansätze und Deutungshorizonte. Die Analyse beleuchtet sowohl die erzählerischen Elemente als auch die theologischen Implikationen des Ereignisses. Es untersucht den Kontext der Erzählung im Markusevangelium, den Aufbau der Erzählung und ihren narrativen Stil, den Traditionshintergrund, mögliche Parallelen zu anderen Heilungen im Neuen Testament und die theologische Bedeutung der Erzählung für das Verständnis Jesu und seines Wirkens.
5 Der blinde Bartimäus (Mk 10, 46-52): Analog zum vorherigen Kapitel wird hier die Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10, 46-52) aus dem Markusevangelium analysiert. Auch hier werden Kontext, Aufbau, Traditionshintergrund, Interpretation und Deutungshorizonte der Erzählung umfassend behandelt. Die Analyse legt ein besonderes Augenmerk auf die Parallelen und Unterschiede zur Heilung des Gelähmten und die spezifischen theologischen Implikationen dieser Wundergeschichte. Diese Analyse beinhaltet den Kontext der Geschichte innerhalb des Markusevangeliums, den Aufbau der Geschichte, den Traditionshintergrund und die theologische Deutung des Ereignisses im Kontext des Evangeliums.
Schlüsselwörter
Jesus, Wunderheilung, Markusevangelium, charismatischer Heiler, Gelähmter, Bartimäus, Wunderbegriff, Antike, Bibel, Theologie, Interpretation, Deutungshorizonte, Traditionshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Jesus als charismatischer Heiler
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht Jesus als charismatischen Heiler anhand der Analyse zweier Wunderheilungen aus dem Markusevangelium: die Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12) und die Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10, 46-52). Sie beleuchtet den historischen und religionsgeschichtlichen Kontext, verschiedene Verständnisweisen des Wunderbegriffs und die theologische Bedeutung der ausgewählten Wundererzählungen.
Welche Aspekte des Wunderbegriffs werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wunderbegriff aus verschiedenen Perspektiven: dem heutigen, dem antiken und dem biblischen Verständnis, mit besonderem Fokus auf das Verständnis des Evangelisten Markus. Sie differenziert zwischen verschiedenen Auffassungen von Wundern und beleuchtet die Herausforderungen der Interpretation solcher Ereignisse aus wissenschaftlicher und theologischer Sicht.
Wie wird Jesus in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Jesus als charismatischen Heiler. Sie beleuchtet die Eigenschaften und Ausdrucksformen dieser Rolle im historischen und religiösen Kontext und verbindet diese Darstellung mit der Interpretation und Deutung der analysierten Wundergeschichten.
Welche Wunderheilungen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12) und die Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10, 46-52). Für jede Heilung werden Kontext, Aufbau, Traditionshintergrund, Interpretation und Deutungshorizonte umfassend behandelt, inklusive der erzählerischen Elemente und theologischen Implikationen.
Welche Methoden werden in der Analyse der Wunderheilungen angewendet?
Die Analyse umfasst die Untersuchung des Kontextes der Erzählungen im Markusevangelium, des Aufbaus und narrativen Stils, des Traditionshintergrunds, möglicher Parallelen zu anderen Heilungen im Neuen Testament und der theologischen Bedeutung der Erzählungen für das Verständnis Jesu und seines Wirkens.
Welche Parallelen und Unterschiede bestehen zwischen den analysierten Wunderheilungen?
Die Arbeit vergleicht die Heilung des Gelähmten und die Heilung des blinden Bartimäus, um Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten und die spezifischen theologischen Implikationen jeder Wundergeschichte zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jesus, Wunderheilung, Markusevangelium, charismatischer Heiler, Gelähmter, Bartimäus, Wunderbegriff, Antike, Bibel, Theologie, Interpretation, Deutungshorizonte, Traditionshintergrund.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Wunderbegriff, ein Kapitel zu Jesus als charismatischem Heiler, detaillierte Analysen der Heilung des Gelähmten und des blinden Bartimäus, ein Fazit, ein Literaturverzeichnis und einen Anhang. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
- Quote paper
- Maren Krebbing (Author), 2015, Jesus als charismatischer Heiler. Geschichtlicher und religionsgeschichtlicher Kontext, theologische Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304470