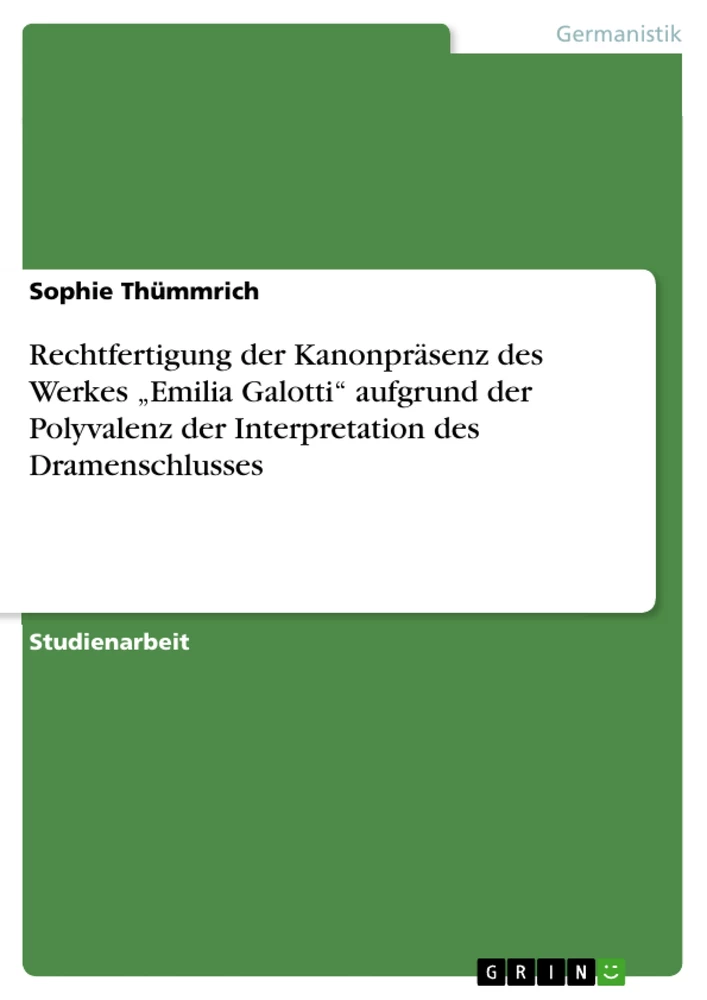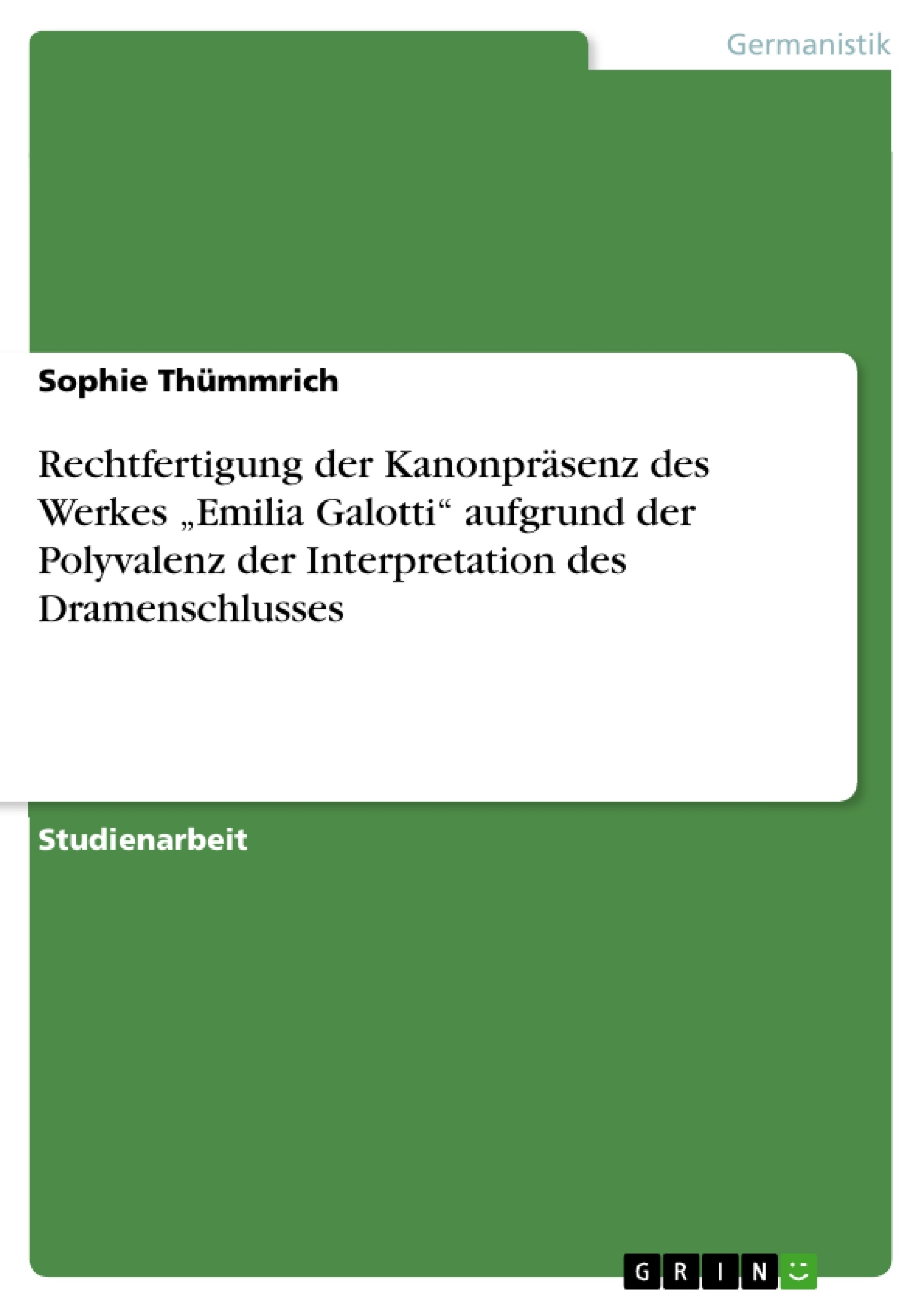Polyvalenz als eines der Hauptkriterien für Kanonizität eines Werkes ist in der vorliegenden Arbeit zentral. Anhand dieser Eigenschaft soll aufgezeigt werden, dass Lessings „Emilia Galotti" auch heute noch seine Berechtigung im literarischen Kanon findet. Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung ist der Dramenschluss.
Wie Horst Steinmetz zu Beginn seines Aufsatzes „Emilia Galotti“ feststellt, gehören „Untergang und Tod des Protagonisten [...] zum üblichen, wenn nicht notwendigen Strukturreper- toire der Tragödie.“ Die Analyse von Ursachen und Anlässen eines solchen Todes sind Teil der Interpretationsarbeit. Das literaturgeschichtlich Besondere bei Emilia Galotti ist, dass auch 240 Jahre nach der Uraufführung immer noch nach neuen Anhaltspunkten, die nach dem Motiv für den Tod der Protagonistin fragen, gesucht wird.
Es gilt zu klären, an welchen Stellen die letzten beiden Auftritte des Stücks Polyvalenz aufweisen und wie verschieden diese gedeutet werden können. Dazu soll zunächst gezeigt werden, inwiefern der Schluss offen ist. Ist der Tod Emilias letztlich Mord oder könnte man ihn auch als Selbsttötung deuten? Oder ergeben sich vielleicht noch andere Sichtweisen?
Je nachdem, welche Figur man als die tragische im Stück betrachtet, eröffnen sich unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der Deutung des Dramenausgangs. Dies wird an den Figuren der Emilia Galotti, dem Prinzen Hettore Gonzaga, Odoardo Galotti und an dem Kammerherrn Marinelli geprüft. Folgend soll hinterfragt werden, in welcher Art und Weise sich eine bewusste Offenlassung des Schlusses für die Bühne als politische Öffentlichkeit als nützlich erweist.
Verschiedene Deutungsrichtungen legen dem Vorangegangenen, das sich primär an den Text hält, anschließend dar, in welchem Sinne der Dramenschluss beurteilt wird. Hierfür wird einzelne Literatur ausgewertet und gegenübergestellt. Die Richtungen gehen vom Politischen, welches normativ, polemisch die Taten der Figuren an politischen und gesellschaftsverändernden Idealen misst, über die literatursoziologische Deutung, welche beschreibt wie das Handeln durch den sozialen Kontext bedingt ist, zum geistesgeschichtlichen Ansatz, der die Notwendigkeit für Emilias Verhalten aus dem zeitgenössichen Menschenbild zu erklären versucht. Abschließend wird kurz auf die feministische und genderorientierte Deutungsrichtung dargestellt werden. In einem Fazit werden die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Offenheit des Dramenschlusses
- Der Moment des Sterbens - Tötung oder Selbsttötung?
- Die tragische Figur im Stück
- Emilia Galotti
- Prinz Hettore Gonzaga
- Odoardo Galotti
- Marchese Marinelli
- Die Bühne als politische Öffentlichkeit
- Verschiedene Deutungsansätze
- Politische Deutung
- Literatursoziologische Deutung
- Geistesgeschichtliche Deutung
- Psychoanalytische und feministische Deutung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Polyvalenz des Dramenschlusses in Lessings „Emilia Galotti“ als ein zentrales Kriterium für die Kanonizität des Werkes. Der Fokus liegt auf der Offenheit des Schlusses und den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben.
- Die Offenheit des Dramenschlusses und die Frage nach Emilias Tod als Tötung oder Selbsttötung
- Die Rolle der tragischen Figur im Stück und die verschiedenen Perspektiven auf den Dramenausgang
- Die Bedeutung der Bühne als politische Öffentlichkeit und die bewusste Offenlassung des Schlusses
- Die verschiedenen Deutungsansätze, die sich auf den Dramenschluss beziehen, von der politischen bis zur feministischen Interpretation
- Die Relevanz von „Emilia Galotti“ für den literarischen Kanon im Hinblick auf die Polyvalenz der Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Polyvalenz für die Kanonizität von „Emilia Galotti“ dar. Sie beleuchtet die Besonderheit des Dramenschlusses und die vielfältigen Deutungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Das zweite Kapitel widmet sich der Offenheit des Dramenschlusses. Es analysiert den Moment des Sterbens und untersucht die Frage, ob Emilias Tod als Tötung oder Selbsttötung zu interpretieren ist. Weiterhin werden die verschiedenen Figuren des Stücks und ihre Perspektiven auf den Dramenausgang beleuchtet.
Das dritte Kapitel präsentiert verschiedene Deutungsansätze für den Dramenschluss. Es werden politische, literatursoziologische, geistesgeschichtliche sowie psychoanalytische und feministische Interpretationsansätze vorgestellt.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bewertet die Relevanz von „Emilia Galotti“ für den literarischen Kanon im Hinblick auf die Polyvalenz der Interpretation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Kanonizität, Polyvalenz, „Emilia Galotti“, Dramenschluss, Tötung, Selbsttötung, Tragische Figur, politische Öffentlichkeit, Deutungsansätze, politische Deutung, literatursoziologische Deutung, geistesgeschichtliche Deutung, feministische Deutung, Lessing.
- Quote paper
- Sophie Thümmrich (Author), 2012, Rechtfertigung der Kanonpräsenz des Werkes „Emilia Galotti“ aufgrund der Polyvalenz der Interpretation des Dramenschlusses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304286