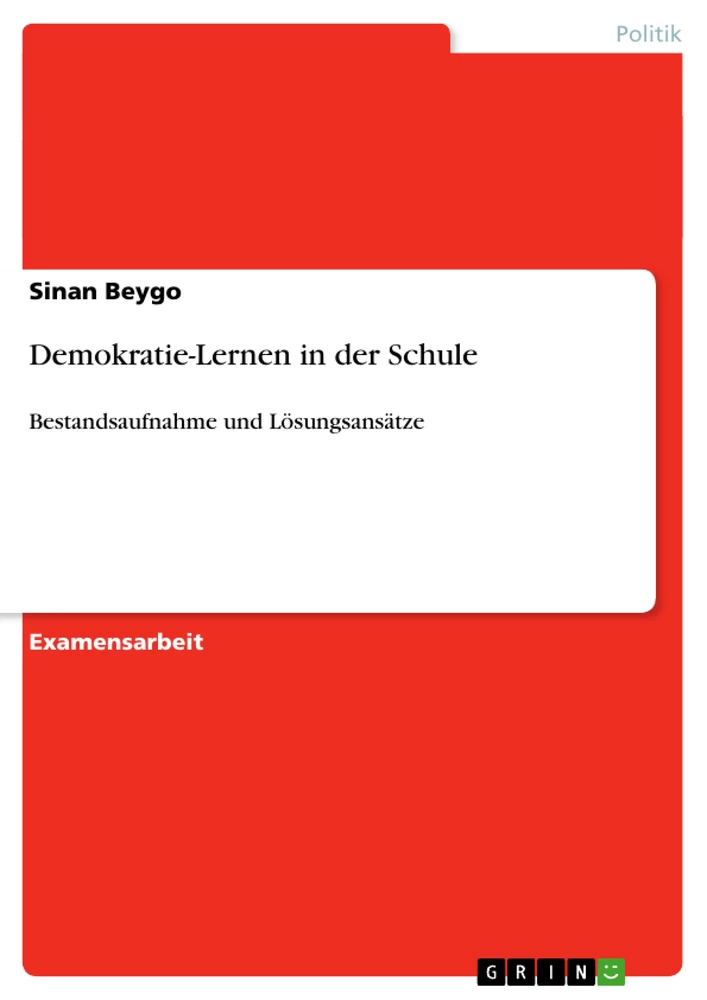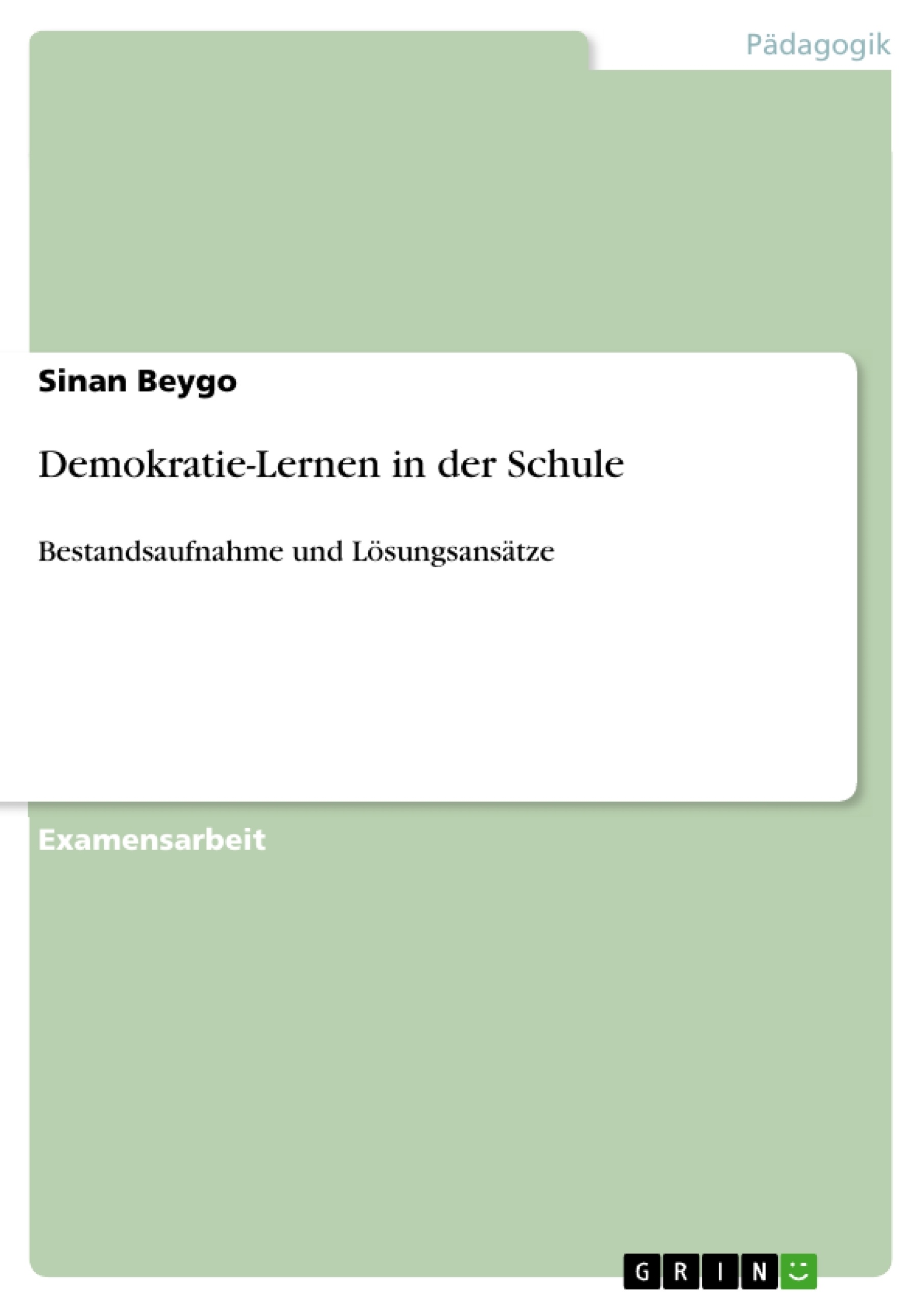Nicht erst seit dem Hilferuf der Berliner Rütli-Schule wird vielerorts über Jugendliche berichtet, die scheinbar nicht mehr in der Lage sind, mit anderen Menschen gewaltfrei auszukommen. Doch gerade diese Gewaltfreiheit ist eine der Grundpfeiler unserer Demokratie.
In dieser Arbeit wird von einem erweiterten Demokratie-Begriff ausgegangen, der Demokratie nicht nur als politisches Konstrukt, sondern als Lebensform begreift. Ausgehend von dem Konzept des Politikwissenschaftlers Gerhard Himmelmann werden Ansätze unter die Lupe genommen, die zum Demokratie-Lernen in der Schule entwickelt wurden.
Der Kern dieser Arbeit besteht nicht in der Entwicklung eines neuen didaktischen Konzeptes, es sollen vielmehr Hilfen für den interessierten Lehrer angeboten werden. Die strukturellen Gegebenheiten und Realitäten von Schule sollen hier als Grundlagen dienen, von denen ein Lehrer ausgehen muss und die nicht ohne weiteres geändert werden können.
Zu Beginn der Überlegungen wird die Frage gestellt, was Demokratie eigentlich bedeutet. Dann wird der Frage nachgegangen, warum Demokratie-Lernen notwendig ist. Dazu ist es wichtig, einen Blick auf die aktuelle jugendpolitische Lage zu werfen.
Das nächste Kapitel untersucht, inwiefern Aspekte des Demokratie-Lernens bereits in den Zielvorgaben der Bundesländer für Schule und Unterricht gefordert werden und begründet somit die Zuständigkeit der Schule für diesen Lernbereich.
Dass die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit sehr hoch ist, wird im vierten Kapitel dargestellt. Hier soll eine Bestandsaufnahme über den Zustand der demokratischen Bildung in der Schule vorgenommen werden.
Das fünfte Kapitel bietet schließlich Lösungsvorschläge dafür an, wie Demokratie-Lernen in der Schule umgesetzt werden kann. Das Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil befasst sich mit der Ebene des Unterrichts. Hier sollen in erster Linie demokratische Unterrichtsansätze dargestellt werden. Der zweite Teil stellt Konzepte und Programme aus der Fachdidaktik dar, die sich mit dem Demokratie-Lernen auseinandersetzen.
Das letzte Kapitel des Hauptteils ist den konkreten Beispielen aus der Praxis vorbehalten. Auch dieses Kapitel ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Teil zeigt Projekte, die für den Unterricht von Bedeutung sein können, während sich der zweite Teil Projekten auf der Ebene der gesamten Schule widmet.
Am Ende werden konkrete Handlungsvorschläge für einen demokratischen (Politik-) Unterricht angeboten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Demokratie?
- 2.1 Von der Relevanz politischer Beteiligung
- 2.1.1 Der Demokratiebegriff von Alexis de Tocqueville
- 2.1.2 Das Bürgerbild in der partizipatorischen Demokratietheorie
- 2.2 Demokratie als Lebensform
- 2.2.1 „Demokratie und Erziehung“ bei John Dewey
- 2.2.2 „Staatsbürgerliche Erziehung“ bei Georg Kerschensteiner
- 2.3 Demokratie als Gesellschaftsform
- 2.3.1 Pluralismus
- 2.3.2 Konflikt und Konfliktregulierung
- 2.3.3 Öffentlichkeit
- 2.3.4 Zivil- und Bürgergesellschaft
- 2.4 Demokratie als Herrschaftsform
- 2.5 Warum Demokratie-Lernen?
- 2.5.1 Politikverdrossenheit und Demokratieakzeptanz: Die 14. Shell Jugendstudie: „Jugend 2002“
- 2.5.2 Demokratieverständnis der Jugendlichen: „Projekt Civic Education“
- 2.5.3 Rechtsextremismus und Fremdenhass
- 2.5.4 Politische Handlungsbereitschaft Jugendlicher
- 2.5.5 Demokratie-Lernen oder Politik-Lernen?
- 2.6 Zwischenresümee
- 2.1 Von der Relevanz politischer Beteiligung
- 3. Ziele der schulischen politischen Bildung
- 3.1 Der allgemeine Bildungsauftrag
- 3.2 Der Bildungsauftrag des Sozialkundeunterrichts
- 3.3 Ziele des Sozialkundeunterrichts - Bürgerleitbilder
- 4. Bestandsaufnahme
- 4.1 Institutionelle und strukturelle Voraussetzungen
- 4.2 Sozialkundeunterricht im Fokus
- 4.3 Schulische Partizipationsmöglichkeiten
- 5. Demokratisches Lernen im Unterricht
- 5.1 Grundsätzliche Aspekte des demokratischen Lernens
- 5.1.1 Beziehungsdidaktik
- 5.1.2 Positive Eigenschaften des Lehrers aus Sicht der Schüler
- 5.1.3 Der ideale Sozialkundelehrer
- 5.1.4 Handlungsorientierung
- 5.1.5 Schülermitbestimmung am Beispiel Klassenrat
- 5.2 Ausgewählte Konzepte des Demokratie-Lernens
- 5.2.1 Das Konzept von Gerhard Himmelmann
- 5.2.2 Das BLK-Projekt „Demokratie lernen und leben“
- 5.2.3 „Schülerdemokratie und Schulentwicklung“
- 5.2.4 Das "Civics-Modell"
- 5.2.5 „Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen“
- 5.1 Grundsätzliche Aspekte des demokratischen Lernens
- 6. Beispiele aus der Unterrichtspraxis
- 6.1 Ausgewählte Praxisprojekte zum Demokratie-Lernen
- 6.1.1 Projekt: aktive Bürger
- 6.1.2 Planspiele
- 6.1.3 Jugend debattiert
- 6.1.4 „Achtung (+) Toleranz“
- 6.1.5 „Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta“
- 6.1.6 „Selbstvertrauen und soziale Kompetenz“
- 6.2 Schulische Projekte
- 6.2.1 Das Projekt „Schule als Staat“
- 6.2.2 „Erziehung durch Demokratie“ – Ein Projekt des Staatlichen Schulamts Reutlingen an Hauptschulen
- 6.2.3 Das Jugendprojekt „LUPO“
- 6.2.4 „Erfahrene Demokratie“ – Das Förderprogramm Demokratisch Handeln
- 6.2.5 Das BLK-Projekt in der Grundschule Süd in Landau
- 6.1 Ausgewählte Praxisprojekte zum Demokratie-Lernen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Demokratie-Lernen in der Schule. Ziel ist es, den aktuellen Stand des Demokratie-Lernens in der schulischen Praxis zu erfassen und mögliche Lösungsansätze für eine Verbesserung aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert verschiedene Konzepte und Praxisbeispiele.
- Definition und Relevanz von Demokratie
- Ziele schulischer politischer Bildung
- Bestandsaufnahme des Demokratie-Lernens in der Schule
- Konzepte und Methoden des demokratischen Lernens
- Praxisbeispiele und deren Evaluation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Anlass der Arbeit, der in einem Besuch einer Grundschule liegt, die erfolgreich am Projekt „Demokratie lernen und leben“ teilnimmt. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, das Demokratie-Lernen in Schulen zu verbessern und bereits bestehende Konzepte zu untersuchen, da viele dieser Konzepte zwar sinnvoll sind, aber im Schulalltag schwer umzusetzen sind. Die Arbeit konzentriert sich daher nicht auf die Entwicklung neuer Konzepte, sondern auf die Analyse und Bewertung bestehender Ansätze.
2. Was ist Demokratie?: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Demokratieverständnisses. Es untersucht Demokratie als Lebensform, Gesellschaftsform und Herrschaftsform und diskutiert verschiedene theoretische Ansätze, unter anderem von Tocqueville, Dewey und Kerschensteiner. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse von Jugendstudien, die die Politikverdrossenheit und das Demokratieverständnis Jugendlicher untersuchen und die Notwendigkeit von Demokratie-Lernen herausstellen. Die Kapitelteile beleuchten kritische Punkte wie Rechtsextremismus und Fremdenhass und fragen nach der politischen Handlungsbereitschaft Jugendlicher.
3. Ziele der schulischen politischen Bildung: Dieses Kapitel definiert den allgemeinen Bildungsauftrag und den spezifischen Bildungsauftrag des Sozialkundeunterrichts hinsichtlich der politischen Bildung. Es beschreibt die Ziele des Sozialkundeunterrichts und die damit verbundenen Bürgerleitbilder, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Bewertungskriterien für die untersuchten Konzepte und Praxisbeispiele dienen.
4. Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel analysiert die institutionellen und strukturellen Voraussetzungen für Demokratie-Lernen in der Schule. Es betrachtet den Sozialkundeunterricht und die schulischen Partizipationsmöglichkeiten kritisch und identifiziert Stärken und Schwächen des bestehenden Systems. Es legt die Grundlage für die spätere Diskussion von Lösungsansätzen und Verbesserungsmöglichkeiten.
5. Demokratisches Lernen im Unterricht: Dieses Kapitel behandelt grundsätzliche Aspekte des demokratischen Lernens, wie Beziehungsdidaktik, Handlungsorientierung und Schülermitbestimmung. Es stellt verschiedene Konzepte des Demokratie-Lernens vor, wie das von Gerhard Himmelmann, das BLK-Projekt „Demokratie lernen und leben“, und andere. Jeder Ansatz wird im Hinblick auf seine Umsetzbarkeit und seinen Beitrag zum Demokratie-Lernen untersucht.
6. Beispiele aus der Unterrichtspraxis: Dieses Kapitel präsentiert ausgewählte Praxisprojekte zum Demokratie-Lernen aus verschiedenen Bereichen, einschließlich Schulprojekten. Es werden konkrete Beispiele wie Planspiele, Debatten und Projekte zur Förderung von Toleranz und sozialer Kompetenz vorgestellt und analysiert. Die Kapitel analysieren den Erfolg dieser Projekte und geben Einblicke in die praktische Umsetzung von Demokratie-Lernen im Unterricht.
Schlüsselwörter
Demokratie-Lernen, politische Bildung, Schule, Sozialkundeunterricht, Partizipation, Schülermitbestimmung, Demokratietheorie, Jugendstudie, Praxisprojekte, Konzepte, Handlungskompetenz, Bürgergesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Demokratie-Lernen in der Schule"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Demokratie-Lernen in der Schule. Sie analysiert den aktuellen Stand der Praxis, bewertet verschiedene Konzepte und Praxisbeispiele und sucht nach Lösungsansätzen zur Verbesserung des Demokratie-Lernens.
Welche Aspekte der Demokratie werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Demokratie als Lebensform, Gesellschaftsform und Herrschaftsform. Sie bezieht verschiedene theoretische Ansätze ein (Tocqueville, Dewey, Kerschensteiner) und analysiert Jugendstudien zur Politikverdrossenheit und zum Demokratieverständnis Jugendlicher. Kritische Punkte wie Rechtsextremismus und Fremdenhass werden ebenso betrachtet.
Welche Ziele der schulischen politischen Bildung werden definiert?
Die Arbeit definiert den allgemeinen Bildungsauftrag und den spezifischen Bildungsauftrag des Sozialkundeunterrichts bezüglich politischer Bildung. Sie beschreibt die Ziele des Sozialkundeunterrichts und die damit verbundenen Bürgerleitbilder, die als Bewertungskriterien für die untersuchten Konzepte und Praxisbeispiele dienen.
Wie wird der aktuelle Stand des Demokratie-Lernens in der Schule erfasst?
Eine Bestandsaufnahme analysiert die institutionellen und strukturellen Voraussetzungen für Demokratie-Lernen, betrachtet den Sozialkundeunterricht und die schulischen Partizipationsmöglichkeiten kritisch und identifiziert Stärken und Schwächen des bestehenden Systems.
Welche Konzepte und Methoden des demokratischen Lernens werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Konzepte des Demokratie-Lernens, darunter das von Gerhard Himmelmann, das BLK-Projekt „Demokratie lernen und leben“, und weitere Ansätze. Jedes Konzept wird hinsichtlich seiner Umsetzbarkeit und seines Beitrags zum Demokratie-Lernen untersucht. Grundsätzliche Aspekte wie Beziehungsdidaktik, Handlungsorientierung und Schülermitbestimmung werden ebenfalls behandelt.
Welche Praxisbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit stellt ausgewählte Praxisprojekte zum Demokratie-Lernen vor, darunter Planspiele, Debatten, Projekte zur Förderung von Toleranz und sozialer Kompetenz sowie Schulprojekte wie "Schule als Staat" oder "Erziehung durch Demokratie". Der Erfolg dieser Projekte wird analysiert und die praktische Umsetzung von Demokratie-Lernen im Unterricht beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demokratie-Lernen, politische Bildung, Schule, Sozialkundeunterricht, Partizipation, Schülermitbestimmung, Demokratietheorie, Jugendstudie, Praxisprojekte, Konzepte, Handlungskompetenz, Bürgergesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was ist Demokratie?, Ziele der schulischen politischen Bildung, Bestandsaufnahme, Demokratisches Lernen im Unterricht und Beispiele aus der Unterrichtspraxis.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt den Anlass der Arbeit (Besuch einer Grundschule mit erfolgreichem Projekt „Demokratie lernen und leben“) und betont die Notwendigkeit, das Demokratie-Lernen zu verbessern und vorhandene Konzepte zu untersuchen, da viele Konzepte im Schulalltag schwer umzusetzen sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse und Bewertung bestehender Ansätze.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Ein explizites Fazit ist in diesem HTML-Auszug nicht enthalten. Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Stand des Demokratie-Lernens zu erfassen und Verbesserungsvorschläge zu liefern, basierend auf der Analyse bestehender Konzepte und Praxisbeispiele.
- Quote paper
- Sinan Beygo (Author), 2004, Demokratie-Lernen in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30422