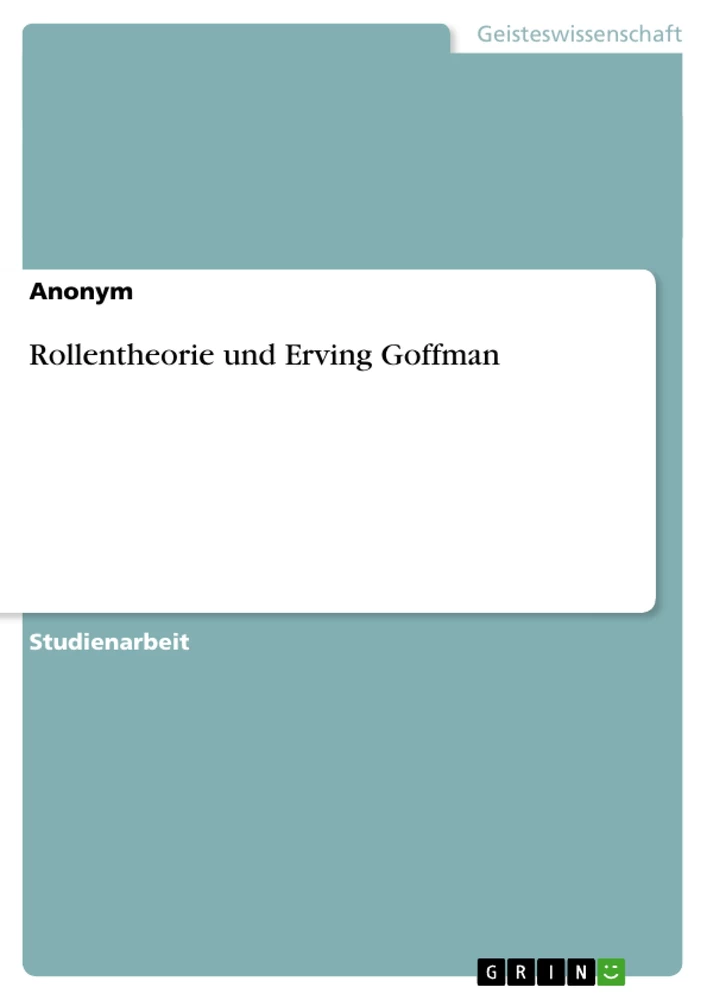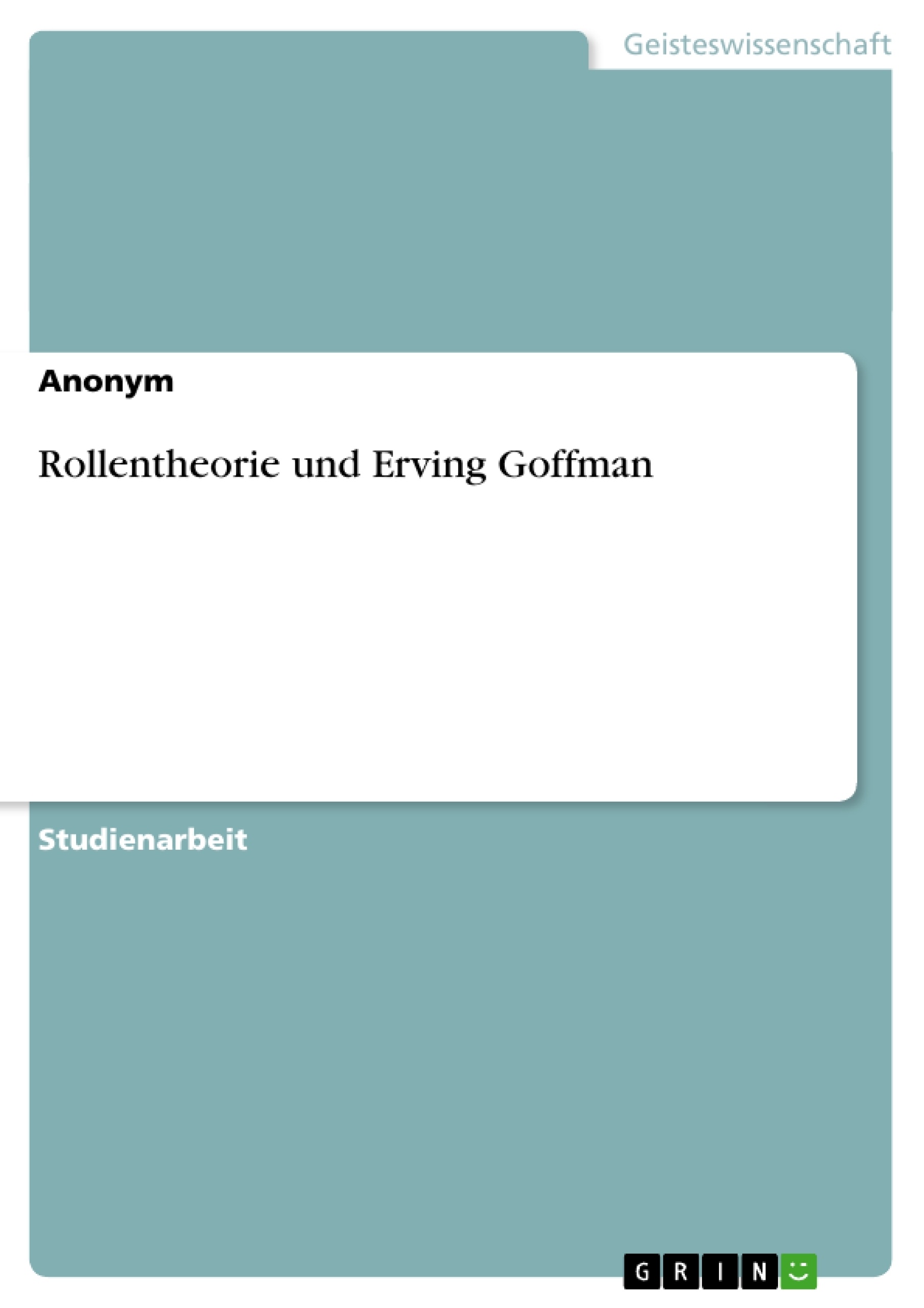„Soziologie ist die Untersuchung des gesellschaftlichen Lebens der Menschen, von Gruppen und Gesellschaften“ (Giddens, 1999, S.2). Dieser Definition zufolge untersuchen Soziologen zwischenmenschliches Handeln und das Agieren Einzelner in Gruppen. Diese Seminararbeit soll ebenfalls menschlichen Handelns untersuchen, insbesondere unter dem Aspekt der sozialen Rolle und der sozialen Position.
Grundlage der Arbeit ist die Formel „Wir alle spielen Theater“. Ihren Ursprung hat sie in der Übersetzung eines Buches von Erving Goffman. In einem Skriptum-Text wird sie dann später auch verwendet als Kapitelüberschrift für die Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie. Hier ist fraglich, ob beide Theorien dasselbe meinen, wie dieselbe Überschrift anklingen lässt.
Die Seminararbeit soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Rollentheorie, wie sie die Arbeitsgruppe Soziologie 1978 erarbeitet hat, und dem Ansatz von Erving Goffman aufzeigen und die Werke somit vergleichen. Dem eigentlichen Vergleich wird jeweils eine Zusammenfassung der Theorie vorangestellt, um die Ansichten festzuhalten. Dem Leser soll so erst jede Theorie alleine näher gebracht werden, damit er ihren Inhalt und die Hauptaussagen versteht. Daraufhin wird die Arbeit den Vergleich der beiden Theorien aufzeigen, wobei erst auf die Gemeinsamkeiten und anschliessend auf die Unterschiede eingegangen wird. Schliesslich werden in der Conclusio die Hauptaussagen über den Vergleich beider Theorien zusammengefasst und daraus folgend ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassungen der Theorien
- Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie
- Ansatz von Erving Goffman
- Gemeinsamkeiten zwischen der Rollentheorie und dem Ansatz von Erving Goffman
- Absicht
- Definition der sozialen Rolle und sozialen Position
- Erwartungen der Umwelt
- Soziale Norm
- Zeit-Raum-Konvergenz
- Unterschiede zwischen der Rollentheorie und dem Ansatz von Erving Goffman
- Die Verwendung des Modells Theater
- Aufrechterhaltung der sozialen Norm
- Conclusio
- Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten
- Zusammenfassung der Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie (1978) und dem Ansatz von Erving Goffman zu vergleichen und aufzuzeigen. Die Arbeit beginnt mit einer Zusammenfassung beider Theorien, um ein gemeinsames Verständnis des Inhalts zu schaffen. Anschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede detailliert analysiert.
- Vergleich der Rollentheorie und des Goffmanschen Ansatzes
- Analyse der Definition sozialer Rollen und Positionen in beiden Theorien
- Untersuchung der Bedeutung sozialer Normen und Erwartungen
- Bewertung der Rolle von Sanktionen im Kontext beider Theorien
- Auswirkungen von Rollenkonflikten (Intra- und Interrollenkonflikte)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und definiert den Untersuchungsgegenstand: einen Vergleich der Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie und des Ansatzes von Erving Goffman. Sie begründet die Relevanz des Vergleichs und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die zentrale Fragestellung ist, ob beide Theorien, trotz einer scheinbar ähnlichen Grundaussage ("Wir alle spielen Theater"), tatsächlich dasselbe meinen. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung eines detaillierten Verständnisses beider Theorien, bevor ein Vergleich vorgenommen wird, und kündigt die schrittweise Vorgehensweise an: Zuerst werden die einzelnen Theorien zusammengefasst, danach die Gemeinsamkeiten und schließlich die Unterschiede analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Conclusio und einem Fazit.
Zusammenfassungen der Theorien: Dieses Kapitel dient der Vorbereitung des eigentlichen Vergleichs. Es bietet eine detaillierte Zusammenfassung der Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie und des Ansatzes von Erving Goffman. Der Fokus liegt auf der präzisen Definition der Fachbegriffe und der Erörterung ihrer Bedeutung innerhalb der jeweiligen Theorie. Die Zusammenfassung der Rollentheorie basiert auf der Arbeit der Arbeitsgruppe Soziologie (1978), während die Zusammenfassung des Goffmanschen Ansatzes auf verschiedenen Werken verschiedener Autoren basiert (Eberle, 1991; Giddens, 1999; Goffman, 1977; Hettlage & Lenz, 1991). Dieses Kapitel legt den Grundstein für ein fundiertes Verständnis der beiden verglichenen Theorien.
2.1 Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie: Die Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie beschreibt den Menschen als Akteur innerhalb eines sozialen Systems, der eine soziale Position und eine soziale Rolle einnimmt. Die soziale Position definiert die Stellung des Individuums im System, während die soziale Rolle durch die Erwartungen der Bezugsgruppen an diese Person in ihrer Position bestimmt wird. Diese Erwartungen können normativ (erwartete Erfüllung) oder antizipatorisch (Vorhersage des Handelns) sein und führen zu positiven oder negativen Sanktionen durch die Bezugsgruppen. Das Kapitel erläutert die Unterscheidung zwischen Kann-, Soll- und Muss-Erwartungen und beschreibt die möglichen Konflikte, die aus unterschiedlichen Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen (Intrarollenkonflikt) oder aus der Kombination verschiedener Rollen in einer Position (Interrollenkonflikt) entstehen können. Weiterhin werden die Konzepte des "role-set" und der sozialen Kontrolle im Kontext von Normen und sozialem Wandel behandelt. Schließlich wird die praktische Bedeutung der Rollentheorie im Verständnis eigenen und fremden Handelns hervorgehoben.
2.2 Ansatz von Erving Goffman: Goffmans Ansatz basiert auf einem dramaturgischen Modell, das das zwischenmenschliche Leben als ein Schauspiel auf einer Bühne betrachtet. Personen nehmen Rollen entsprechend ihrer sozialen Positionen ein, wobei die soziale Rolle durch sozial definierte Erwartungen bestimmt wird. Goffman unterteilt die "Bühne" in eine Vorder- und Hinterbühne, wobei auf der Vorderbühne formale Rollen gespielt werden. Das Kapitel würde hier detaillierter auf die Aspekte von Darstellung, Impression Management und die Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbühne eingehen und wie diese Konzepte die soziale Interaktion beeinflussen. Die spezifischen Aspekte der Goffmanschen Theorie, die im vorliegenden Textausschnitt nicht detailliert beschrieben sind, würden hier erläutert werden, um ein umfassendes Bild zu liefern.
Schlüsselwörter
Rollentheorie, Erving Goffman, soziale Rolle, soziale Position, Bezugsgruppen, Erwartungen, Sanktionen, soziale Norm, Rollenkonflikt (Intra- und Interrollenkonflikt), soziales System, dramaturgisches Modell, Vorderbühne, Hinterbühne, soziale Kontrolle, sozialer Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vergleich der Rollentheorie und des Ansatzes von Erving Goffman
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht und kontrastiert die Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie (1978) und den Ansatz von Erving Goffman. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Theorien, trotz ihrer scheinbar ähnlichen Grundaussage, dass Menschen im sozialen Leben "Theater spielen".
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Zusammenfassung beider Theorien, eine Analyse der Gemeinsamkeiten (z.B. Definition sozialer Rollen und Positionen, Erwartungen der Umwelt, soziale Normen) und Unterschiede (z.B. Verwendung des Theatermodells, Aufrechterhaltung sozialer Normen), sowie eine Diskussion über soziale Rollen, Positionen, Bezugsgruppen, Sanktionen, Rollenkonflikte (Intra- und Interrollenkonflikte), und den Einfluss sozialer Kontrolle und des sozialen Wandels.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage definiert. Es folgt ein Kapitel mit Zusammenfassungen der Rollentheorie und des Goffmanschen Ansatzes. Anschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien detailliert analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Conclusio und einem Fazit.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie (1978) mit dem dramaturgischen Ansatz von Erving Goffman. Die Zusammenfassung der Rollentheorie basiert auf der Arbeit der Arbeitsgruppe Soziologie (1978), während die Zusammenfassung des Goffmanschen Ansatzes auf verschiedenen Werken (Eberle, 1991; Giddens, 1999; Goffman, 1977; Hettlage & Lenz, 1991) basiert.
Welche Gemeinsamkeiten werden zwischen den beiden Theorien herausgearbeitet?
Die Gemeinsamkeiten umfassen die Definition von sozialen Rollen und Positionen, die Bedeutung von Erwartungen der Umwelt, die Rolle sozialer Normen und der Einfluss von Sanktionen auf das Verhalten. Beide Theorien betrachten das Individuum als Akteur innerhalb eines sozialen Systems.
Welche Unterschiede werden zwischen den beiden Theorien herausgearbeitet?
Ein Hauptunterschied liegt in der Verwendung des dramaturgischen Modells durch Goffman, das das soziale Leben als Theater darstellt. Die Arbeit analysiert auch Unterschiede in Bezug auf die Aufrechterhaltung sozialer Normen und die Betonung bestimmter Aspekte des sozialen Handelns.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Rollentheorie, Erving Goffman, soziale Rolle, soziale Position, Bezugsgruppen, Erwartungen, Sanktionen, soziale Norm, Rollenkonflikt (Intra- und Interrollenkonflikt), soziales System, dramaturgisches Modell, Vorderbühne, Hinterbühne, soziale Kontrolle, sozialer Wandel.
Welches Ziel verfolgt die Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Rollentheorie der Arbeitsgruppe Soziologie und dem Ansatz von Erving Goffman zu entwickeln und diese differenziert darzustellen.
Wo finde ich weitere Informationen zu den verwendeten Theorien?
Weitere Informationen finden sich in den zitierten Werken: Arbeitsgruppe Soziologie (1978), Eberle (1991), Giddens (1999), Goffman (1977), Hettlage & Lenz (1991).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2003, Rollentheorie und Erving Goffman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30375