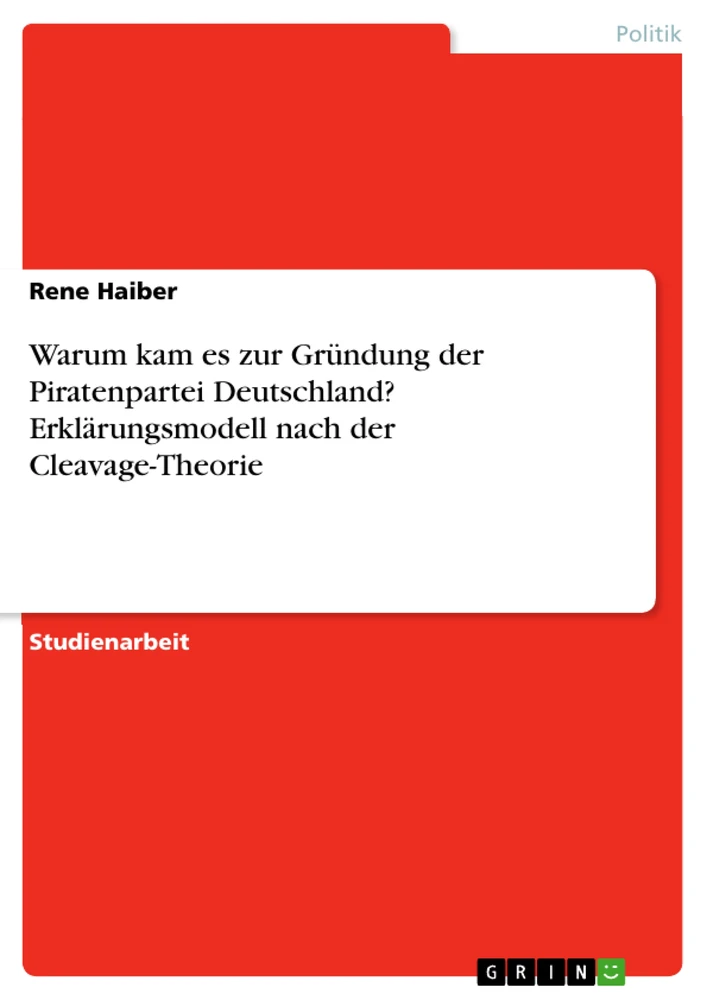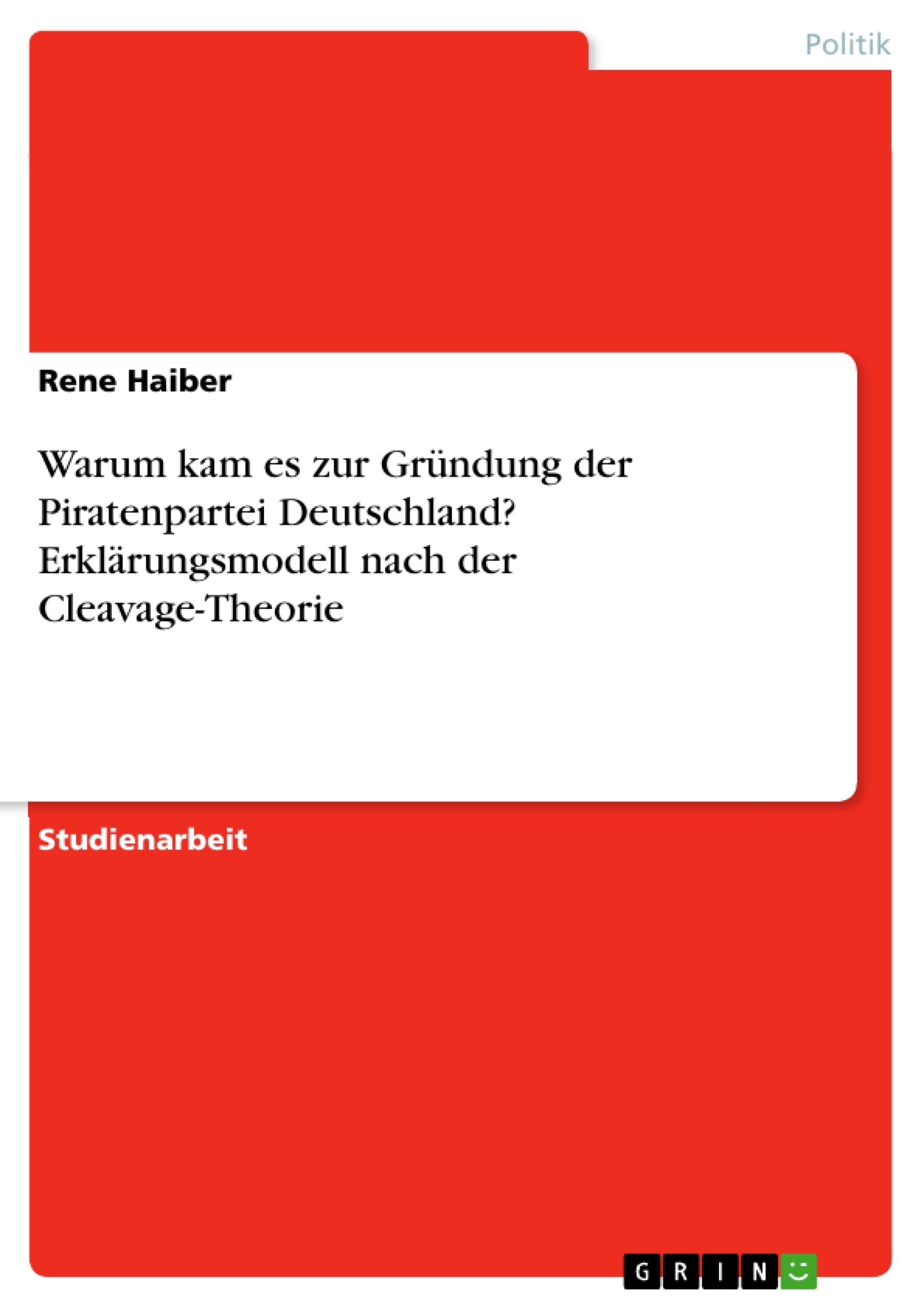"Klarmachen zum Ändern!" Mit diesem Wahlspruch tritt die Piratenpartei Deutschland bis heute auf ihrer Homepage auf. Sie sorgten in ihrem nun fünfjährigen Bestehen in Politik, Presse und Wissenschaft für Wirbel und viele Fragen, aber auch Bewunderung, Faszination und Hoffnung. Inzwischen gab es jedoch auch Wut, Fassungslosigkeit und Zweifel gegenüber dieser Partei.
In der politikwissenschaftlichen Literatur gibt es inzwischen einiges zur Analyse der Partei. Diese beschreiben meistens detailliert die Entstehungsgeschichte, versuchen ihre Wähler zu identifizieren und untersuchen, warum diese Partei so viele Wahlen gewonnen hat. Die Presse interessiert sich neben diesem vor allem dafür, ob diese Partei 2013 in den Bundestag einziehen wird. Diese Arbeit soll einen weiteren Beitrag zur Analyse der Piratenpartei Deutschland leisten.
In diesem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt: „Warum kam es zur Gründung der Piratenpartei Deutschland?“. Mich interessiert bei der Beantwortung dieser Forschungsfrage, was sich in der Gesellschaft geändert hat und welcher Konflikt dazu führte, dass sich eine neue Partei bilden musste. Deshalb steht im Fokus dieser Arbeit, welche Konfliktlinie zur Gründung der Piratenpartei führte oder ob sich gar eine neue Konfliktlinie in der deutschen Gesellschaft herauskristallisiert hat. Es interessiert dabei weniger, aber es ist auch nicht irrelevant, wer die Piraten wählt oder wo sie sich jetzt als Partei hinbewegt. Wichtig ist der Grund für ihre Entstehung. Es soll in dieser Arbeit um den Wandel in der deutschen Gesellschaft gehen, weshalb sie für die aktuelle Gesellschaftsforschung von Relevanz ist.
Um eine Konfliktlinie in einer Gesellschaft zu finden, wird zuerst definiert, was ein Cleavage, also eine Konfliktlinie ist. Dieser Begriff wurde von Lipset und Rokkan geprägt, deren Rekonstruktionsmodell des 1920 bestehenden Parteiensystems Europas im Anschluss dargestellt wird und folgend die Erweiterung von Ingleharts Cleavage des Postmaterialismus. Im Empirieabschnitt wird der deutsche gesellschaftliche Wandel untersucht, um nach einer kurzen Genese der Piratenpartei Schlussfolgerungen zu ziehen. Es wird erklärt, welcher Faktor die Gesellschaft bewegt und wie dieser dazu führte, dass sich die Piratenpartei Deutschland gründen musste.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Cleavage Theorie
- 2.1 Merkmale einer Konfliktlinie (Cleavage)
- 2.2 Das Modell nach Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan
- 2.3 Erweiterung nach Inglehart: Materialismus vs. Post-Materialismus
- 3. Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland
- 4. Die Piratenpartei Deutschland
- 4.1 Genese
- 4.2 Ein Cleavage, eine Partei
- 4.3 Auswertung / Ergebnis
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für die Gründung der Piratenpartei Deutschland. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und welche gesellschaftlichen Konfliktlinien (Cleavages) zur Entstehung dieser Partei führten. Die Arbeit analysiert den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland und prüft, ob sich neue Konfliktlinien herausgebildet haben. Der Fokus liegt auf den Ursachen der Parteigründung, weniger auf der Wählerschaft oder der aktuellen politischen Ausrichtung der Partei.
- Definition und Merkmale von Cleavages nach Lipset und Rokkan
- Das Modell von Lipset und Rokkan zur Rekonstruktion von Parteiensystemen
- Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland im Kontext der Cleavage-Theorie
- Die Genese der Piratenpartei Deutschland
- Analyse der Parteigründung im Lichte der Cleavage-Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die Gründung der Piratenpartei Deutschland. Sie betont den Fokus auf gesellschaftlichen Wandel und Konfliktlinien als Ursachen der Parteigründung und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der Cleavage-Theorie basiert. Die Arbeit untersucht, ob ein bestehender oder ein neuer Konflikt in der deutschen Gesellschaft zur Entstehung der Partei führte, und hebt die Relevanz dieses Themas für die Gesellschaftsforschung hervor.
2. Die Cleavage Theorie: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Cleavage" (Konfliktlinie) nach Lipset und Rokkan, wobei die drei notwendigen Merkmale (sozialstrukturell, institutionell, Werteaspekt) detailliert erläutert werden. Es wird differenziert zwischen ökonomischen und kulturellen Konflikten und die Bedeutung von "Wir"- und "Ihr"-Gefühlen sowie institutionalisierter Segmentierung für die Stabilität von Cleavages hervorgehoben. Das Kapitel beschreibt den Prozess der Politisierung von Konflikten und die vier Schwellen (Legitimation, Inkorporation, Repräsentation, Durchsetzung), die Parteien überwinden müssen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Abschließend wird darauf eingegangen, dass nicht jeder politische Konflikt automatisch ein Cleavage im Sinne von Lipset und Rokkan darstellt.
3. Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland: (Da der Text an dieser Stelle endet, kann keine Zusammenfassung für Kapitel 3 erstellt werden.)
4. Die Piratenpartei Deutschland: (Da der Text an dieser Stelle endet, kann keine Zusammenfassung für Kapitel 4 erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Piratenpartei Deutschland, Cleavage-Theorie, Lipset und Rokkan, gesellschaftlicher Wandel, Konfliktlinien, Politisierung, Parteiensystem, Postmaterialismus, soziale Spaltung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Piratenpartei Deutschland im Kontext der Cleavage-Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Piratenpartei Deutschland und analysiert, ob und welche gesellschaftlichen Konfliktlinien (Cleavages) dazu führten. Der Fokus liegt auf den Ursachen der Parteigründung, nicht auf der Wählerschaft oder der aktuellen politischen Ausrichtung.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan, die gesellschaftliche Konfliktlinien und deren Einfluss auf die Bildung von Parteiensystemen beschreibt. Es wird untersucht, ob die Gründung der Piratenpartei auf bestehende oder neue Cleavages zurückzuführen ist.
Was sind Cleavages und welche Merkmale werden betrachtet?
Cleavages sind gesellschaftliche Konfliktlinien mit drei Merkmalen: sozialstrukturell (gesellschaftliche Gruppen), institutionell (organisierte Interessenvertretung) und Werteaspekt (Wertekonflikte). Die Arbeit differenziert zwischen ökonomischen und kulturellen Konflikten und betrachtet die Bedeutung von "Wir"- und "Ihr"-Gefühlen sowie institutionalisierter Segmentierung für die Stabilität von Cleavages.
Welche Aspekte des gesellschaftlichen Wandels in Deutschland werden behandelt?
Der Text enthält an dieser Stelle keine detaillierte Zusammenfassung zu diesem Punkt. Kapitel 3 behandelt den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland im Kontext der Cleavage-Theorie, aber der bereitgestellte Text bricht vor der Zusammenfassung dieses Kapitels ab.
Wie wird die Piratenpartei Deutschland analysiert?
Der Text enthält an dieser Stelle keine detaillierte Zusammenfassung zu diesem Punkt. Kapitel 4 analysiert die Genese der Piratenpartei und untersucht, ob ihre Entstehung auf eine bestehende oder neue Konfliktlinie zurückzuführen ist. Der bereitgestellte Text bricht vor der Zusammenfassung dieses Kapitels ab.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Piratenpartei Deutschland, Cleavage-Theorie, Lipset und Rokkan, gesellschaftlicher Wandel, Konfliktlinien, Politisierung, Parteiensystem, Postmaterialismus, soziale Spaltung und Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Die Cleavage Theorie, Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland, Die Piratenpartei Deutschland und Fazit.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche gesellschaftlichen Konfliktlinien führten zur Gründung der Piratenpartei Deutschland?
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Der methodische Ansatz basiert auf der Analyse gesellschaftlicher Konfliktlinien (Cleavages) im Kontext der Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan.
- Quote paper
- Rene Haiber (Author), 2013, Warum kam es zur Gründung der Piratenpartei Deutschland? Erklärungsmodell nach der Cleavage-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303715