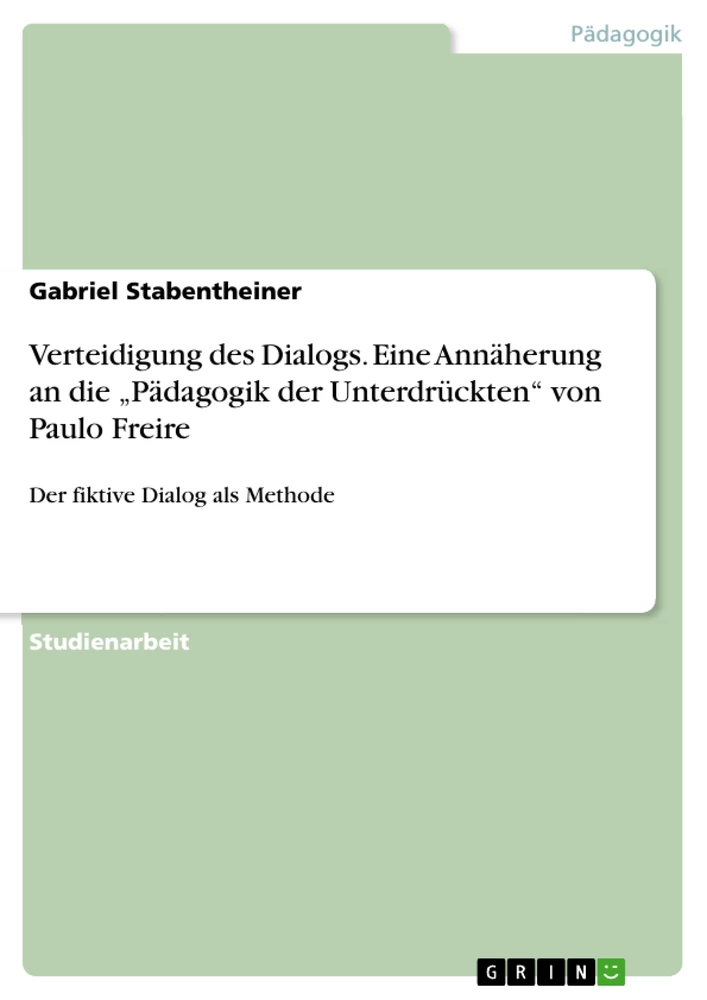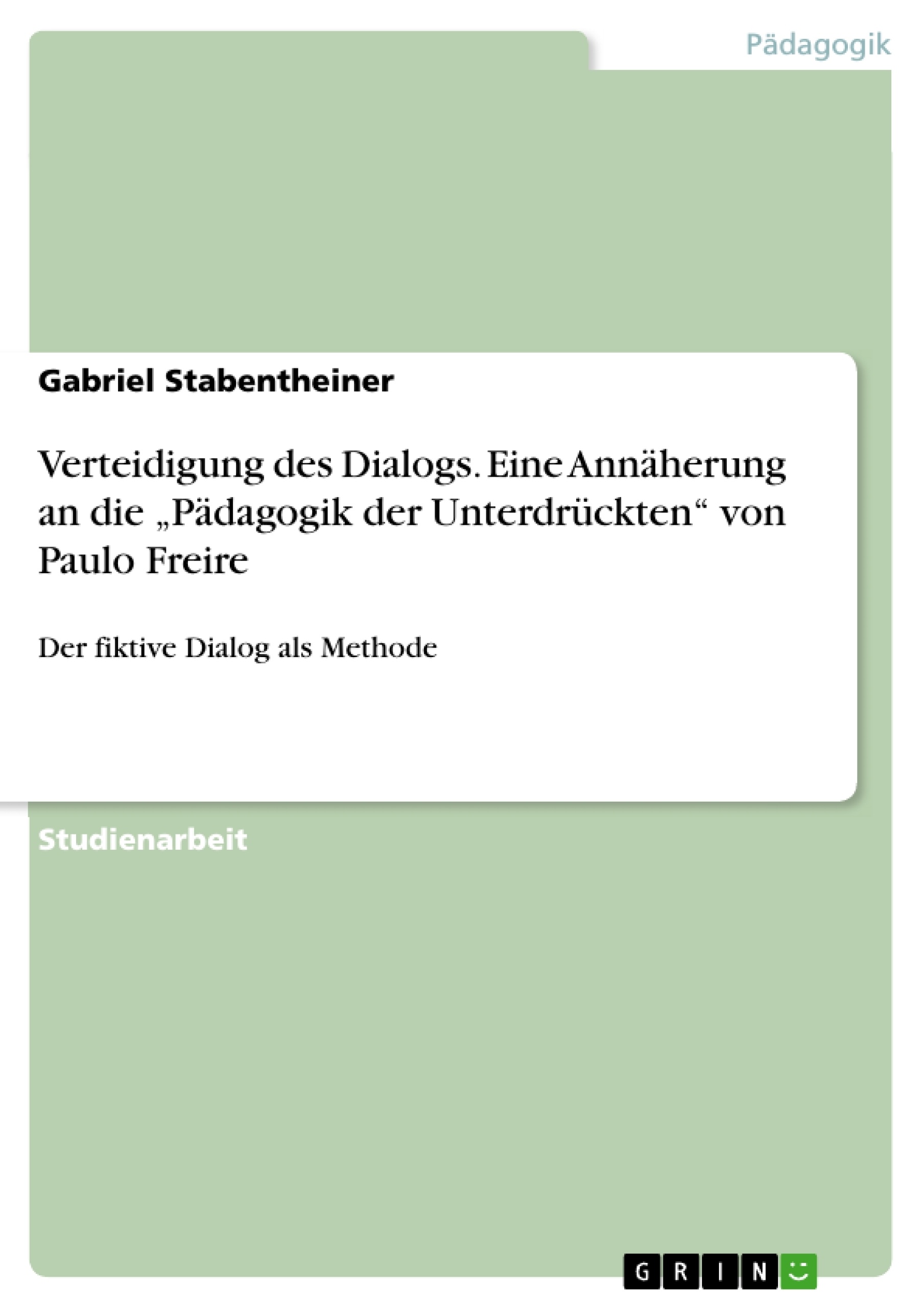Eigentlich dürfte Paulo Freire keine Bücher schreiben. Es widerspricht in gewissen Maße seinen Aussagen über die Wichtigkeit des Dialogs, einen – monologischen – Text zu verfassen. Ausdrücklich spricht er sich gegen die Verwendung von „Kommuniqués“ aus.
Glücklicherweise hat er uns trotzdem seine Gedanken und Erfahrungen zur Bildung als Praxis der Freiheit in Form von Schriftwerken zugänglich gemacht.
Ich möchte jedoch in dieser Arbeit Freires Aussagen aus seinem vorliegenden Werk „Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit“ tatsächlich nur als einen Teil eines fiktiven Dialogs behandeln – eines Dialogs, wie er heute bei uns stattfinden könnte. Freilich, damit Freire seine Thesen ausführen kann, muss es sich dabei um eine Diskussion über Bildung handeln und zwar mit Menschen, von denen angenommen werden kann, dass sie seine Sprache und damit seine Aussagen verstehen werden.
Voilà, der perfekte Rahmen: eine Lehrveranstaltung am Institut für Erziehungswissenschaften.
In der Ausführung des Dialogs folge ich – in dem begrenzten Maße, in dem es für diese Arbeit möglich ist, die sich ja hauptsächlich der Darlegung der Inhalte von Freires Werk verpflichtet – seiner pädagogischen Methodik. Etwa wird an den Anfang des Dialogs eine sogenannte „Kodierung“ gestellt. Diese ist ein Bild, das eine wichtige widersprüchliche Situation in der Lebenswelt der Betroffenen darstellt und das Auslöser und Anregung für die Diskussion sein soll, die Freire den „Prozess der Dekodierung“ nennt.
Mit dieser Arbeit, so zumindest meine Überzeugung, trete ich selbst in den Dialog mit Freire ein und trage somit zur Auflösung des Widerspruchs, der durch die Verschriftlichung von Freires Ideen entstanden ist, bei. Ich denke, damit durchaus in seinem Sinne zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Bild
Der Dialog
Quellenverzeichnis
Vorwort
Eigentlich dürfte Paulo Freire keine Bücher schreiben. Es widerspricht in gewissem Maße seinen Aussagen über die Wichtigkeit des Dialogs[1], einen – monologischen – Text zu verfassen. Ausdrücklich spricht er sich gegen die Verwendung von „Kommuniqués“ aus (vgl. Freire, z.B. S.114). Glücklicherweise hat er uns trotzdem seine Gedanken und Erfahrungen zur Bildung als Praxis der Freiheit in Form von Schriftwerken zugänglich gemacht.
Ich möchte jedoch in dieser Arbeit Freires Aussagen aus seinem vorliegenden Werk „Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit“ tatsächlich nur als einen Teil eines fiktiven Dialogs behandeln – eines Dialogs, wie er heute bei uns stattfinden könnte. Freilich, damit Freire seine Thesen ausführen kann, muss es sich dabei um eine Diskussion über Bildung handeln und zwar mit Menschen, von denen angenommen werden kann, dass sie seine Sprache und damit seine Aussagen verstehen werden.
Voilà, der perfekte Rahmen: eine Lehrveranstaltung am Institut für Erziehungswissenschaften.
In der Ausführung des Dialogs folge ich – in dem begrenzten Maße, in dem es für diese Arbeit möglich ist, die sich ja hauptsächlich der Darlegung der Inhalte von Freires Werk verpflichtet – seiner pädagogischen Methodik. Etwa wird an den Anfang des Dialogs eine sogenannte „Kodierung“ (vgl. ebd. S.95) gestellt. Diese ist ein Bild, das eine wichtige widersprüchliche Situation in der Lebenswelt der Betroffenen darstellt und das Auslöser und Anregung für die Diskussion sein soll, die Freire den „Prozess der Dekodierung“ (ebd. S.96) nennt.
Mit dieser Arbeit, so zumindest meine Überzeugung, trete ich selbst in den Dialog mit Freire ein und trage somit zur Auflösung des Widerspruchs, der durch die Verschriftlichung von Freires Ideen entstanden ist, bei. Ich denke, damit durchaus in seinem Sinne zu handeln.
Das Bild
Auf dem Foto ist eine Lehrerin zu sehen, die in einem Klassenzimmer vor der Tafel steht. Die ersten Reihen der SchülerInnen sind zu sehen. Es scheint eine größere Klasse mit vielen Kindern zu sein, etwa im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Einige von ihnen stützen ihre Köpfe auf die Hände, einer hat ihn sogar seitlich auf den am Pult ruhenden Arm gelegt. Die SchülerInnen scheinen zuzuhören, während die Lehrerin spricht. Diese schaut gerade nach vorne, während sie mit einer Hand auf die Tafel zeigt, die andere Hand auf das Pult gelegt, neben dem sie steht. Am Pult liegt ein aufgeschlagenes Buch, an der Tafel hängt eine schematische Karte: Die Staaten Europas.
Der Dialog
P: Was könnt ihr auf diesem Bild erkennen?
A: Eine Geografie-Klasse.
B: Eine langweilige.
C: Warum?
B: Naja, schau dir die Kinder an. Die sind ja schon beim Wegschlafen.
D: Das ist Frontalunterricht. Die Lehrerin trägt nur vor, die SchülerInnen sind unbeteiligt.
B: Ja, das ist das Problem. Da passt keiner lange auf.
E: Hmm. Das scheint eine ziemlich große Klasse zu sein. Ich schätze mal, das sind so 30 Kinder, so wie das ausschaut.
C: Ja, stimmt. Da ist es ja dann auch schwierig, guten Unterricht zu machen. Das weiß ich aus Erfahrung. Da kannst du gar nicht mit allen SchülerInnen diskutieren.
B: Das mag schon sein. Aber die Kinder haben so jedenfalls nichts davon. Lernen tun die so nix.
C: Aber schuld ist da dran doch das Schulsystem. Also, so große Klassen sollte es einfach nicht geben. Als Lehrer muss man halt auch immer irgendwie versuchen, dem Schulsystem gerecht zu werden und dabei trotzdem guten Unterricht zu machen. Das ist manchmal echt schwierig.
A: Ja, und außerdem: Frag’ einmal die Jugendlichen nach ihrer Meinung zu irgendeinem Thema. Da herrscht dann oft großes Schweigen. Manchmal kommen mir die richtig apathisch vor. Wenn’s nicht gerade um Computerspiele oder irgendwelche Schönheiten geht. Ich hab’ einmal eine Klasse von Jugendlichen gefragt, was sie von unserem Schulsystem halten. Viel mehr, als dass es „Scheisse“ sei, ist dabei nicht rausgekommen.
P: Hier sind gleich mehrere Motive der Unterdrückung zu erkennen, die uns immer wieder begegnen...
A: Warum „Unterdrückung“?
P: Naja: „Eine sorgfältige Analyse des Schüler-Lehrer-Verhältnisses [...] zeigt deutlich, dass es grundsätzlich übermittelnden Charakter besitzt. Die Beziehung besteht in einem übermittelnden Subjekt (dem Lehrer) und geduldig zuhörenden Objekten (den Schülern).“ „Sie [werden] dadurch zu «Containern» gemacht, ... die vom Lehrer «gefüllt» werden müssen. Je vollständiger er die Behälter füllt, ein desto besserer Lehrer ist er. Je williger die Behälter es zulassen, dass sie gefüllt werden, um so bessere Schüler sind sie.“ (ebd. S.57) Doch, „...ohne selbst zu forschen, ohne Praxis können Menschen nicht wahrhaft menschlich sein“. (ebd. S.58)
C: Aber jetzt mal halb lang. Du meinst also, dass die Lehrer die Schüler unterdrücken?
P: Ja, dort wo sie sich dieser sogenannten „Bankiers-Erziehung“ bedienen, also wo sie den Schülern Wissen einflößen wollen, schon. Aber vielleicht kommen wir zur Person des Lehrers später...
E: Tschuldigung, warum „Bankiers-Erziehung“?
P: Weil der Lehrer dabei bei den Schülern „Wissenseinlagen“ macht, die diese entgegennehmen, ordnen und aufstapeln. Die Schüler spielen also eine rein passive Rolle, während der Lehrer alle Entscheidungen über den Lernprozess trifft: Er lehrt, er weiß, er denkt, er redet, er wählt aus, er handelt. (vgl. ebd. S.57-59)
D: Er benotet..
C: Ja, aber wenn das wirklich so wäre, warum würden sich die SchülerInnen dann nicht dagegen wehren? Die können’s ja nicht gern haben, dass sie „nicht wahrhaft menschlich sind“.
B: Die wehren sich eh manchmal. Sind auffällig, stören, ...
P: „Wenn Kinder, die in einer Atmosphäre der ... Unterdrückung aufgezogen wurden, [...] während ihrer Kindheit nicht den Weg echten Aufstands zu gehen vermögen, dann werden sie entweder in die totale Indifferenz getrieben [...] oder sie engagieren sich in Formen zerstörerischer Aktion.“ (ebd. S.132)
B: Das nennt man dann Jugendgewalt.
A: Hab ich das jetzt richtig verstanden: Eltern unterdrücken ihre Kinder, und wenn sich die nicht früh genug dagegen wehren, werden sie der Unterdrückung gegenüber indifferent oder aber gewalttätig.
P: Ja, die Unterdrückung ist natürlich ein Prozess, der auch und vor allem in der Schule stattfindet. “die Schüler ... entdecken, dass man sich, um eine gewisse Befriedigung zu erreichen, ... an die Vorschriften anpassen muss, die von oben her festgesetzt wurden. Eine dieser Vorschriften lautet, nicht zu denken.“ (ebd.)
E: „Die Vorschrift, nicht zu denken.“ Ganz schön heftig.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Vorworts?
Das Vorwort kritisiert die Tatsache, dass Paulo Freire, trotz seiner Betonung des Dialogs, Bücher schreibt. Es wird der Rahmen der Arbeit vorgestellt: Eine fiktive Diskussion über Bildung in einer Lehrveranstaltung am Institut für Erziehungswissenschaften, die sich an Freires pädagogischer Methodik orientiert, beginnend mit einer „Kodierung“ in Form eines Bildes.
Was zeigt das Bild, das als „Kodierung“ dient?
Das Bild zeigt eine Lehrerin in einem Klassenzimmer vor der Tafel, unterrichtend eine große Klasse von Schülern. Einige Schüler scheinen gelangweilt oder unaufmerksam zu sein. An der Tafel hängt eine schematische Karte Europas.
Was ist der Inhalt des Dialogs?
Der Dialog ist eine Diskussion zwischen Studenten und einem Dozenten (P) über das Bild und das Thema Unterdrückung in der Bildung. Die Diskussion berührt Themen wie Frontalunterricht, große Klassen, Apathie der Schüler, die "Bankiers-Erziehung", die Rolle des Lehrers und die Reaktion der Schüler auf Unterdrückung.
Was ist die „Bankiers-Erziehung“?
Die "Bankiers-Erziehung" ist ein Begriff, den Freire verwendet, um eine traditionelle Unterrichtsmethode zu beschreiben, bei der der Lehrer Wissen in die Schüler "einzahlt", die als passive Empfänger fungieren. Die Schüler werden als "Behälter" betrachtet, die gefüllt werden müssen, und haben wenig aktive Beteiligung am Lernprozess.
Wie reagieren die Schüler auf die „Bankiers-Erziehung“ laut Freire?
Laut Freire können Schüler, die in einer Atmosphäre der Unterdrückung aufwachsen, entweder indifferent gegenüber der Unterdrückung werden oder gewalttätige Verhaltensweisen entwickeln, wenn sie sich nicht frühzeitig dagegen wehren.
Was ist Freires Sichtweise auf die Rolle des Dialogs?
Freire betont die Bedeutung des Dialogs als Mittel für Menschen, ihrem Sinn als Menschen gerecht zu werden. Der Dialog ist eine existenzielle Notwendigkeit und ermöglicht es den Menschen, sich aktiv und kritisch mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Gabriel Stabentheiner (Autor:in), 2007, Verteidigung des Dialogs. Eine Annäherung an die „Pädagogik der Unterdrückten“ von Paulo Freire, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303402