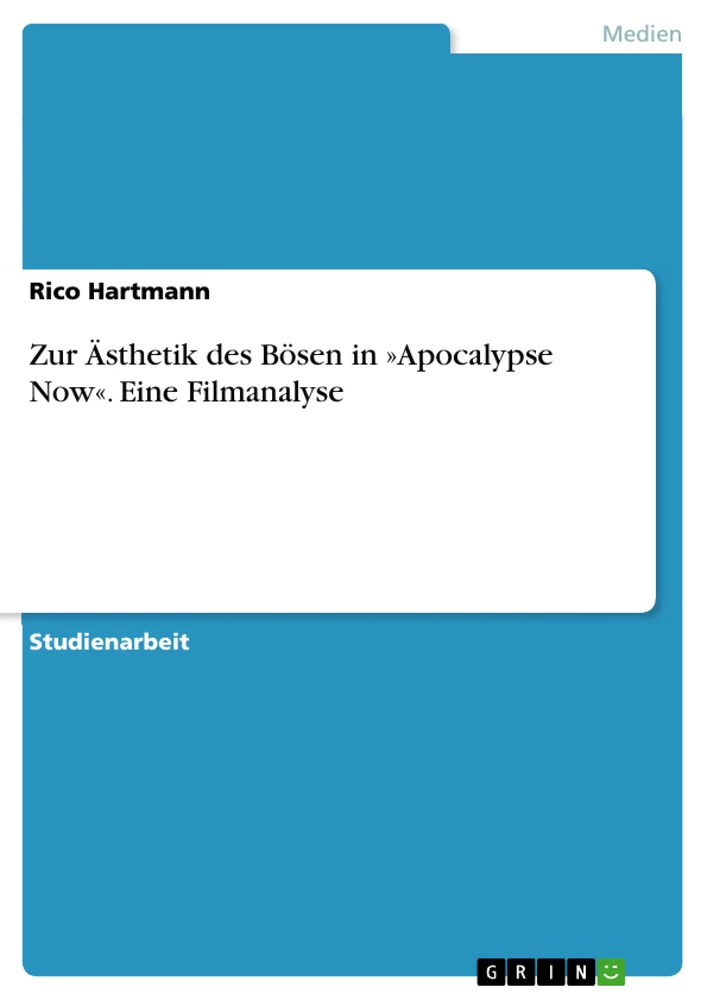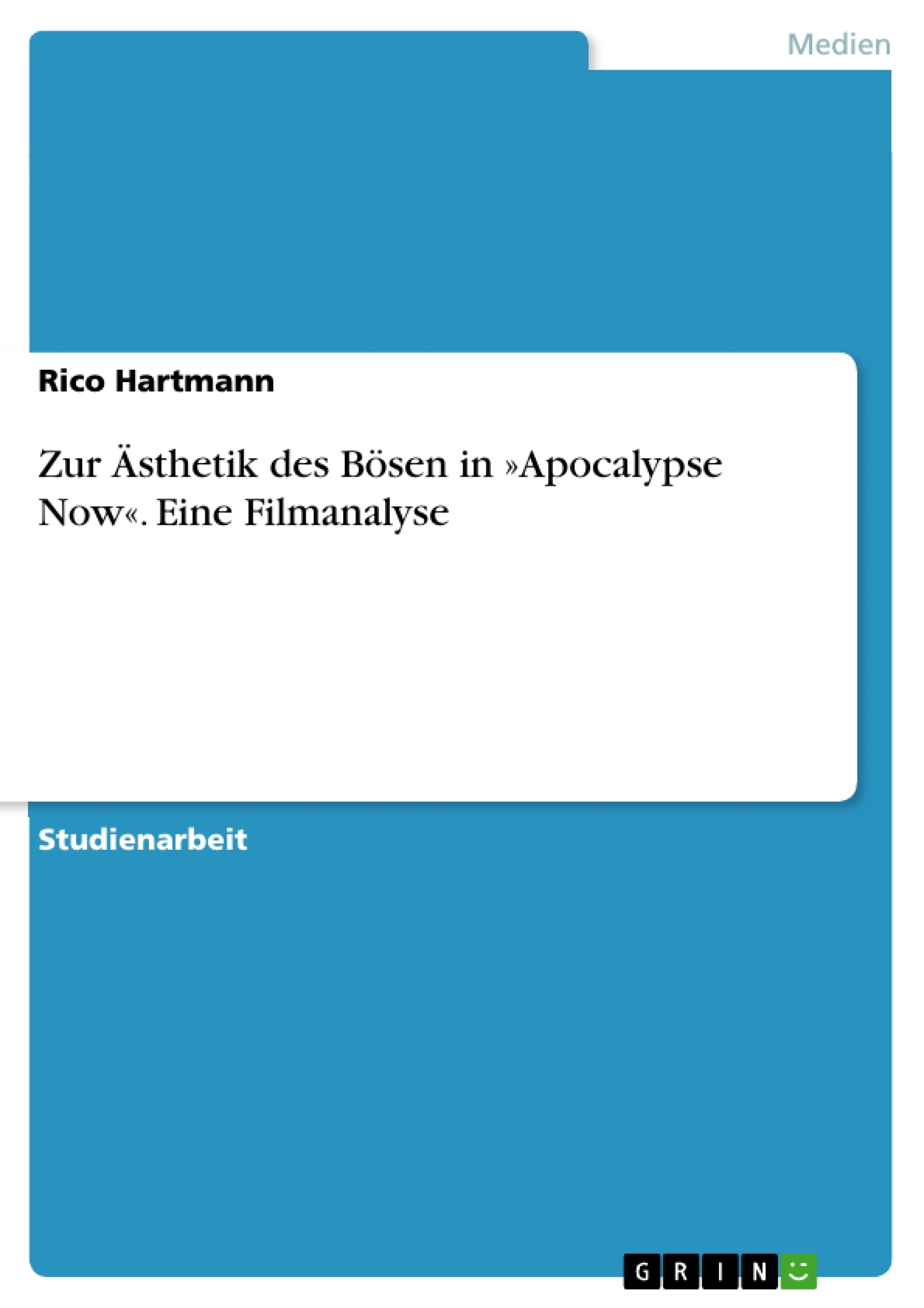"The most important thing I wanted to do in the making of Apocalypse Now was to create a film experience that would give its audience a sense of the horror, the madness, the sensuousness, and the moral dilemma of the Vietnam war. [...] And yet I wanted it to go further, to the moral issues that are behind all wars." (F. F. Coppola)
Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, erschienen 1979, gilt als Meilenstein der New- Hollywood-Ära sowie der gesamten Filmgeschichte. Die Zeit schrieb, dass es nach Apocalypse Now eigentlich keinen Kriegsfilm mehr geben dürfe.1 Bereits die Hintergründe des Films, die schwierigen Produktionsbedingungen wie auch die Buch- und Filmvorlagen, sorgten für vielfältige Interpretationen, Legenden und Mythenbildungen. Der Film selbst trug vor allem durch die neuartige inhaltliche und formale Ästhetik zu seiner Bekanntheit bei:
»Apocalypse Now« spielt mit den heroischen Klischees von Kriegen und Kriegsfilmen, um sie ins Absurde, Lächerliche und Schreckliche zu überführen. Die so bloßgestellte Doppelmoral von Kriegen und ihren medialen Inszenierungen wird dabei weniger aufklärerisch als über Gefühlsreflektion vermittelt.
Auch die optische, sprachliche und akustische Geschlossenheit des Films bildet eine Emergenz, die sich nicht allein symbolisch erschließt. Der Zuschauer spürt förmlich den Sog des Grauens: “The horror, the horror”.
Spätestens diese Worte am Ende des Films machen deutlich, dass es hier nicht nur um Vietnam, sondern um alle Kriege bis hin zu zivilen Alltagsformen des Krieges geht.
Grundthema ist demnach das dunkle Innere als Schattenseite der Wirklichkeit. Entsprechend meint das Reale psychoanalytisch nicht die Realität, sondern das ungreifbare Gespenstische, den dunklen Trieb im Traum, im Trauma. Das Reale ist der Horror. Das Hässliche, Gewalttätige, Obszöne ist verdrängter Teil von Subjekt und Gesellschaft, immer gegenwärtig, wenn auch nicht immer erkennbar. Dieses Wechselspiel von Präsenz und Absenz bildet eine eigene Ästhetik, eine Ästhetik des Bösen.
Inhaltsangabe
Abstract
Einleitung
1 Produktion, Plot, Struktur und Interpretation des Films
1.1 Produktion
1.2 Plot, Struktur und Interpretation
2 Zur Transtextualität des Bösen in Buchvorlage und Film
2.1 Sprache, Stimme und Blick der Protagonisten
2.2 Ton, Bild und Schönheit des Schreckens
Schluss
Quellen
Abstract
"The most important thing I wanted to do in the making of Apocalypse Now was to create a film experience that would give its audience a sense of the horror, the madness, the sensuousness, and the moral dilemma of the Vietnam war. [...] And yet I wanted it to go further, to the moral issues that are behind all wars." (F. F. Coppola)
»Apocalypse Now« spielt mit den heroischen Klischees von Kriegen und Kriegsfilmen, um sie ins Absurde, Lächerliche und Schreckliche zu überführen. Die so bloßgestellte Doppelmoral von Kriegen und ihren medialen Inszenierungen wird dabei weniger aufklärerisch als über Gefühlsreflektion vermittelt. Auch die optische, sprachliche und akustische Geschlossenheit des Films bildet eine Emergenz, die sich nicht allein symbolisch erschließt. Der Zuschauer spürt förmlich den Sog des Grauens: “The horror, the horror”. Spätestens diese Worte am Ende des Films machen deutlich, dass es hier nicht nur um Vietnam, sondern um alle Kriege bis hin zu zivilen Alltagsformen des Krieges geht. Grundthema ist demnach das dunkle Innere als Schattenseite der Wirklichkeit. Entsprechend meint das Reale psychoanalytisch nicht die Realität, sondern das ungreifbare Gespenstische, den dunklen Trieb im Traum, im Trauma. Das Reale ist der Horror. Das Hässliche, Gewalttätige, Obszöne ist verdrängter Teil von Subjekt und Gesellschaft, immer gegenwärtig, wenn auch nicht immer erkennbar. Dieses Wechselspiel von Präsenz und Absenz bildet eine eigene Ästhetik, eine Ästhetik des Bösen.
Einleitung
"The most important thing I wanted to do in the making of Apocalypse Now was to create a film experience that would give its audience a sense of the horror, the madness, the sensuousness, and the moral dilemma of the Vietnam war. [...] And yet I wanted it to go further, to the moral issues that are behind all wars." (Francis Ford Coppola, Making-of-Introduction der OV)
Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, erschienen 1979, gilt als Meilenstein der New-Hollywood-Ära sowie der gesamten Filmgeschichte . Die Zeit schrieb, dass es nach Apocalypse Now eigentlich keinen Kriegsfilm mehr geben dürfe.[1] Bereits die Hintergründe des Films, die schwierigen Produktionsbedingungen wie auch die Buch- und Filmvorlagen, sorgten für vielfältige Interpretationen, Legenden und Mythenbildungen. Der Film selbst trug vor allem durch die neuartige inhaltliche und formale Ästhetik zu seiner Bekanntheit bei: In zweieinhalb (in der Redux-Version dreieinhalb) Stunden werden in scheinbar spielerischer Leichtigkeit die Klischees und Oberflächlichkeiten heroischer Kriege und – in medialer Selbstreferenz – Kriegsfilme aufgeführt, um diese sogleich ins Lächerliche, Absurde, Psychedelische und Grauenhafte zu überführen. Dabei scheint die emotionale Wirkung eine rationale Betrachtung zu unterlaufen, so dass die Idee des Films, das Aufzeigen der (moralischen) Schrecken von Kriegen, oft erst klar wird, wenn man Abstand vom Schein des Schönen, »Coolen« und Humorvollen nimmt. Der epistemische Wert wird nicht über Aufklärung, sondern über Gefühlseflektion erreicht. Darüberhinaus bildet die optische, sprachliche und akustische Geschlossenheit des Films eine Emergenz, die sich nicht allein aus der jeweiligen symbolischen Ebene erschließt und den Zuschauer vielmehr fühlen lässt, was sich ihm gerade offenbart: die Apokalypse, das Ende, „The horror, the horror...“[2]. Spätestens diese letzten Worte des Filmes lassen die Frage aufwerfen, ob es tatsächlich primär um den Vietnamkrieg geht.
Anknüpfend an Coppolas Betonung, dass er das Grauen, den Wahnsinn und die Doppelmoral hinter allen Kriegen darstellen wollte (s.o.), soll hier der Standpunkt verfolgt werden, dass es weniger um Vietnam, um »Combat«, um wirklichen Krieg geht, als um zivile bzw. zivilisierte – und unzivilisierte - Formen des Krieges im alltäglichen Gesellschaftsleben. So gesehen stellt sich auch die Frage, ob hier überhaupt ein Kriegs- oder Antikriegsfilm vorliegt. Die Chicago Sun-Times schrieb: „Apocalypse Now [...] pushes beyond the others, into the dark places of the soul. It is not about war so much as about how war reveals truths we would be happy never to discover [...].“[3] Statt um Krieg geht es also um das Psychische des Kriegs – und das Kriegerische der Psyche. Grundthema ist das dunkle Innere, das Dionysische, der »Thanatos« als Schattenseite der Wirklichkeit. Die Psychoanalyse fasst das Reale entsprechend nicht als die Realität auf, sondern als das Gespenstische, Ungreifbare, als den nicht steuerbaren dunklen Trieb im Verdrängten, im Traum, im Trauma.[4] Das Reale ist der Horror. Das Hässliche, Gewalttätige, Obszöne ist als intersubjektives Unterbewusstes die Kehrseite regulativer, guter Moralvorstellungen und kategorischer Imperative – eine antagonistische Grundkonstante der Zivilisation, die zwischen physikalischer Anwesenheit und symbolisch-imaginärer Abwesenheit oszilliert. Dieses Wechselspiel von Präsenz und Absenz bildet in dieser Schemenhaftigkeit eine eigene Ästhetik, eine Ästhetik des Bösen.
[...]
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_Now#cite_note-3, 04.08.11.
[2] Filmzitate werden im Weiteren nicht mit Fußnoten belegt, da sie eigens transskribiert wurden und teilweise sinngemäße Zitationen oder Übersetzungen bilden, sowie filmversionsbedingt unterschiedlich sein können.
[3] Roger Ebert: Kritik zu Apocalypse Now. Chicago Sun-Times, 28. November 1999.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Inhaltsangabe zu "Apocalypse Now"?
Die Inhaltsangabe bietet einen umfassenden Überblick über die Analyse des Films "Apocalypse Now". Sie umfasst eine Zusammenfassung des Films, die Produktion, Plot, Struktur und Interpretation, sowie eine Untersuchung der Transtextualität des Bösen im Vergleich zur Buchvorlage. Außerdem werden Sprache, Stimme und Blick der Protagonisten sowie Ton, Bild und die Ästhetik des Schreckens behandelt. Ein Abstract und eine Einleitung umreißen die Hauptthemen und Argumente der Analyse.
Was sind die Hauptthemen im Abstract von "Apocalypse Now"?
Das Abstract betont, dass "Apocalypse Now" mit den Klischees von Krieg und Kriegsfilmen spielt, um deren Absurdität und Schrecken aufzuzeigen. Der Film vermittelt die Doppelmoral von Kriegen weniger aufklärerisch als durch emotionale Reflexion. Das Grundthema ist das dunkle Innere als Schattenseite der Wirklichkeit, wobei das Reale psychoanalytisch als das Ungreifbare und Gespenstische verstanden wird, als der Horror und die Verdrängung in Subjekt und Gesellschaft.
Was wird in der Einleitung von "Apocalypse Now" behandelt?
Die Einleitung stellt "Apocalypse Now" als einen Meilenstein der Filmgeschichte vor und verweist auf die schwierigen Produktionsbedingungen und die vielfältigen Interpretationen. Der Film dekonstruiert die Klischees heroischer Kriege und führt sie ins Lächerliche, Absurde und Grauenhafte. Es wird argumentiert, dass die emotionale Wirkung des Films eine rationale Betrachtung unterläuft und dass der epistemische Wert über Gefühlseflektion erreicht wird. Die Frage wird aufgeworfen, ob es sich primär um den Vietnamkrieg handelt, oder um zivile Formen des Krieges im alltäglichen Leben.
Was ist die These bezüglich des Krieges im Film "Apocalypse Now"?
Die These ist, dass es in "Apocalypse Now" weniger um den Vietnamkrieg selbst geht, sondern um zivile bzw. zivilisierte Formen des Krieges im alltäglichen Gesellschaftsleben. Es geht um das Psychische des Kriegs und das Kriegerische der Psyche. Das Grundthema ist das dunkle Innere als Schattenseite der Wirklichkeit, wobei das Reale psychoanalytisch als das Ungreifbare und Gespenstische, als der Horror und die Verdrängung verstanden wird.
Was bedeutet "Ästhetik des Bösen" im Kontext von "Apocalypse Now"?
Die "Ästhetik des Bösen" bezieht sich auf das Wechselspiel von Präsenz und Absenz des Hässlichen, Gewalttätigen und Obszönen als verdrängter Teil von Subjekt und Gesellschaft. Diese Schemenhaftigkeit bildet eine eigene Ästhetik, die in der Analyse des Films "Apocalypse Now" untersucht wird.
- Quote paper
- Rico Hartmann (Author), 2011, Zur Ästhetik des Bösen in »Apocalypse Now«. Eine Filmanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302924