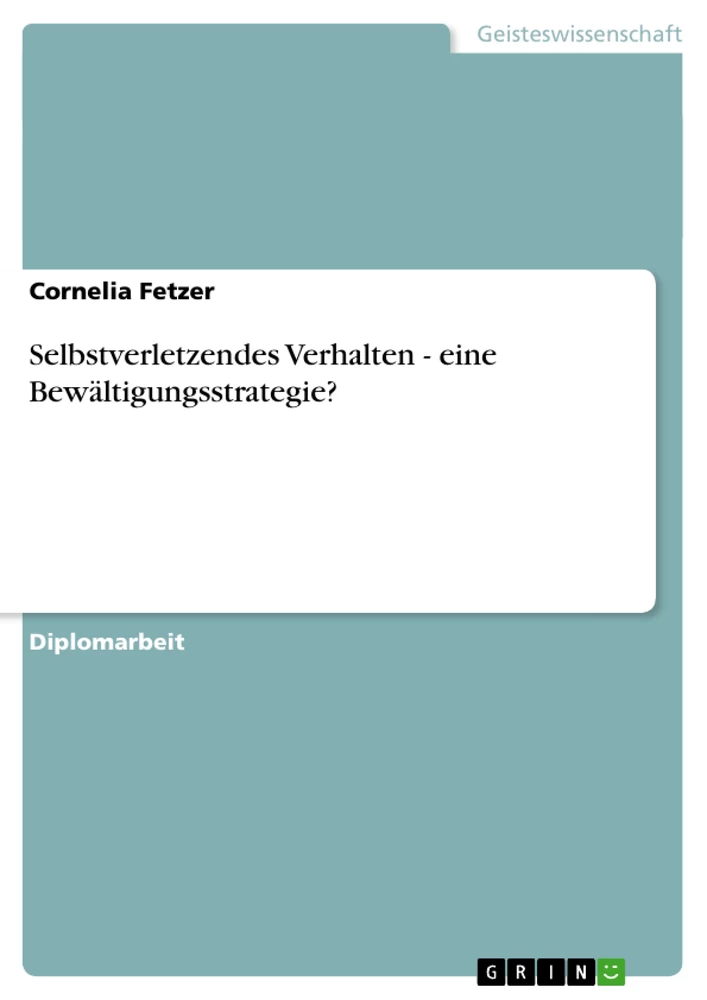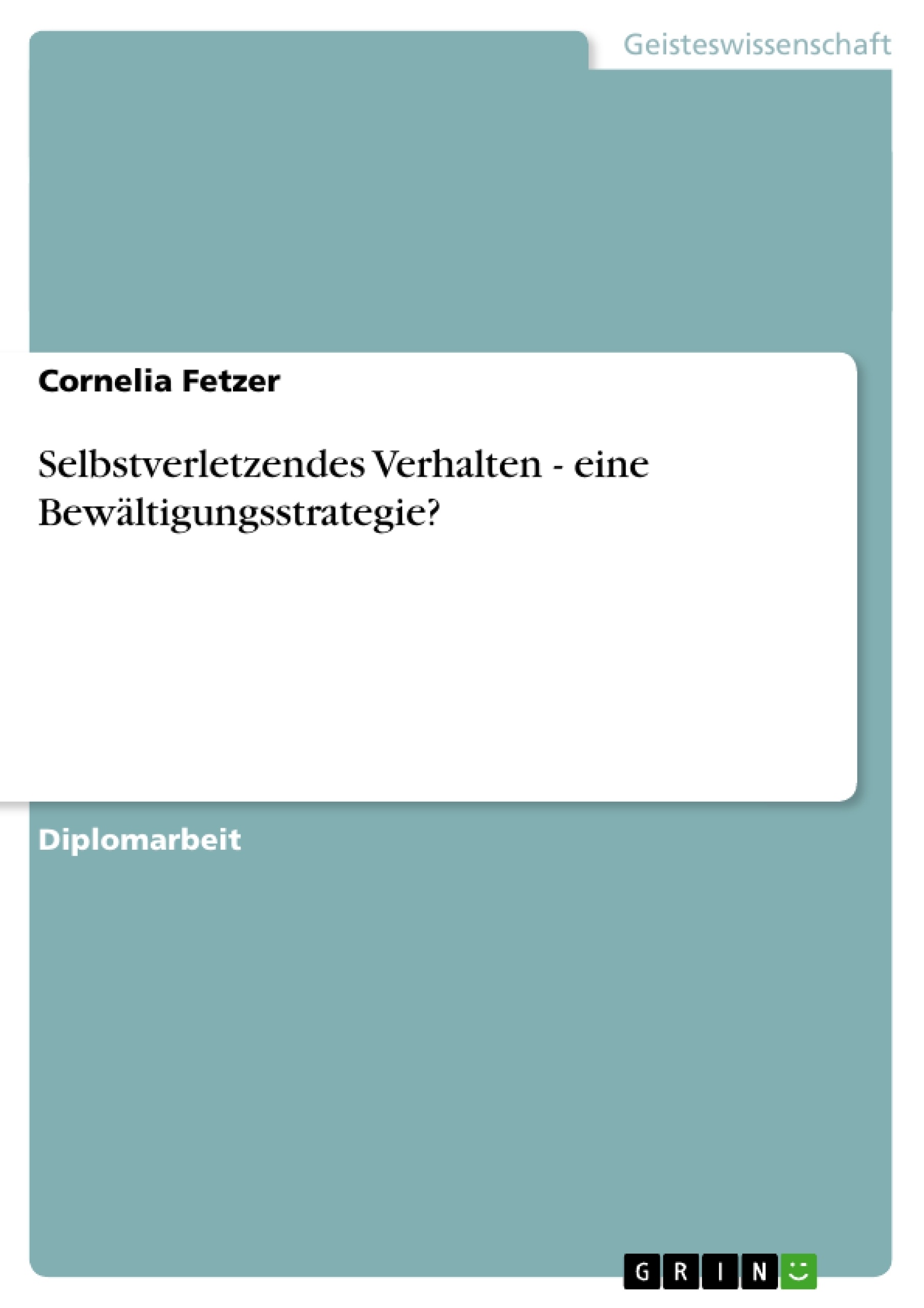[...] Dabei liegt der Fokus auf der Zielgruppe von jugendlichen Mädchen, da diese Verhaltensweise vorwiegend beim weiblichen Geschlecht verzeichnet wird und deren Beginn häufig mit Eintritt in die Pubertät einhergeht. Durch diese Arbeit soll eine Antwort darauf gefunden werden, ob und wie Selbstverletzendes Verhalten eine Bewältigungsstrategie für Mädchen sein kann und welche Möglichkeiten und Grenzen es im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit gibt, mit Betroffenen zu arbeiten. Nach der Einleitung und Hinführung zur Thematik findet eine erste Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit des Selbstverletzenden Verhaltens statt. Da verschiedene, unterschiedlich bewertete Synonyme in der Literatur verwendet werden, wird in diesem ersten Kapitel begründet, warum die Autorin fortlaufend den Begriff des Selbstverletzenden Verhaltens verwendet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Phänomenologie von Selbstverletzendem Verhalten. Nach einer kurzen diagnostischen Zuordnung werden verschiedenen Formen von Selbstverletzendem Verhalten skizziert, wobei der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der offenen Selbstverletzung liegt. Da Selbstverletzungen in aller Regel nach traumatischen Erfahrungen in Erscheinung treten, wird dann der Versuch gemacht, diesen Zusammenhang aus unterschiedlichen Bereichen zu beleuchten. Im Anschluss daran werden verschiedenen Motive aufgezeigt, die Betroffene dazu bringen, sich selbst zu verletzen. Einen großen Bereich nehmen dann die interpersonalen und intrapersonalen Funktionen von Selbstverletzendem Verhalten ein, die den LeserInnen die Tatsache näher bringen sollen, dass auch selbstschädigende Verhaltensweisen zur Bewältigung bestimmter Situationen herangezogen werden und trotz destruktiver Anteile als entlastend empfunden werden können. Das Kapitel schließt mit verschiedenen Aspekten, wie z.B. der Symbolik, der Geschlechtsspezifität oder dem Suchtcharakter von selbstverletzendem Verhalten ab. Im dritten Kapitel werden verschiedene Theorien dargestellt, die Erklärungsansätze bieten sollen, warum und wie es zu Selbstverletzendem Verhalten bei jugendlichen Mädchen kommen kann. Das vierte Kapitel soll Aufschluss darüber geben, wie im Alltag der Sozialen Arbeit mit Betroffenen von Selbstverletzendem Verhalten umgegangen werden kann bzw. soll und welche speziellen Aufgaben SozialarbeiterInnen dabei zukommen. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Resümee über die Auseinandersetzung mit der dargestellten Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begrifflichkeit von Selbstverletzendem Verhalten
- 2. Phänomenologie des Selbstverletzenden Verhaltens
- 2.1 Diagnostische Zuordnung
- 2.2 Formen von Selbstverletzendem Verhalten
- 2.2.1 Offenes Selbstverletzendes Verhalten
- 2.2.2 Heimliches bzw. artifizielles Selbstverletzendes Verhalten
- 2.2.3 Erweiterte artifizielle Erkrankungen als spezifische Formen von Selbstverletzendem Verhalten
- 2.2.3.1 Münchhausen-Syndrom
- 2.2.3.2 Münchhausen by - proxy - Syndrom
- 2.3 Selbstverletzendes Verhalten als Traumafolge
- 2.3.1 Selbstwert und Körperbild
- 2.3.2 Selbstverletzendes Verhalten nach psychischer und / oder physischer Misshandlung
- 2.3.3 Selbstverletzendes Verhalten nach sexuellem Missbrauch
- 2.4 Motive für Selbstverletzendes Verhalten
- 2.5 Psychodynamische Funktionen von Selbstverletzendem Verhalten
- 2.5.1 Intrapersonale Funktionen
- 2.5.1.1 Selbstverletzendes Verhalten als Selbstfürsorge und Ressource
- 2.5.1.2 Selbstverletzendes Verhalten als Ventil
- 2.5.1.3 Selbstverletzendes Verhalten als Antidepressivum
- 2.5.1.4 Selbstverletzendes Verhalten als Antidissoziativum
- 2.5.1 Intrapersonale Funktionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des Selbstverletzenden Verhaltens (SVV) bei jugendlichen Mädchen und untersucht, ob und wie dieses Verhalten als Bewältigungsstrategie dienen kann. Die Arbeit analysiert verschiedene Erklärungsansätze für SVV und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit mit betroffenen Mädchen in der Sozialen Arbeit.
- Begriffliche Abgrenzung und Definition von Selbstverletzendem Verhalten
- Phänomenologie und Formen von Selbstverletzendem Verhalten
- Zusammenhang zwischen Selbstverletzendem Verhalten und Traumatisierung
- Motive und Funktionen von Selbstverletzendem Verhalten
- Theorien und Erklärungsansätze für Selbstverletzendes Verhalten bei jugendlichen Mädchen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Selbstverletzenden Verhaltens ein und skizziert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- 1. Begrifflichkeit von Selbstverletzendem Verhalten: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Selbstverletzenden Verhaltens und setzt sich kritisch mit verschiedenen Synonymen auseinander.
- 2. Phänomenologie des Selbstverletzenden Verhaltens: Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Formen von Selbstverletzendem Verhalten, wobei der Schwerpunkt auf der offenen Selbstverletzung liegt. Er untersucht außerdem den Zusammenhang zwischen SVV und traumatischen Erfahrungen, analysiert verschiedene Motive für SVV und geht auf die psychodynamischen Funktionen von SVV ein.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, jugendliche Mädchen, Bewältigungsstrategie, Trauma, psychische Gesundheit, Soziale Arbeit, psychodynamische Funktionen, intrapersonale Funktionen, Theorien, Erklärungsansätze.
- Quote paper
- Cornelia Fetzer (Author), 2004, Selbstverletzendes Verhalten - eine Bewältigungsstrategie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30280