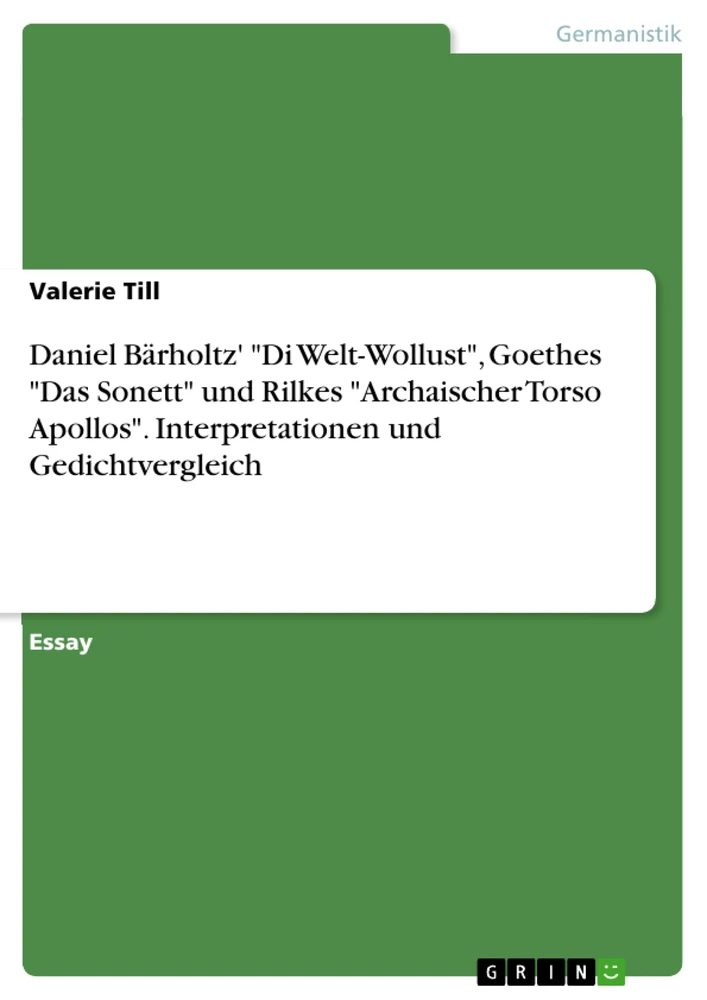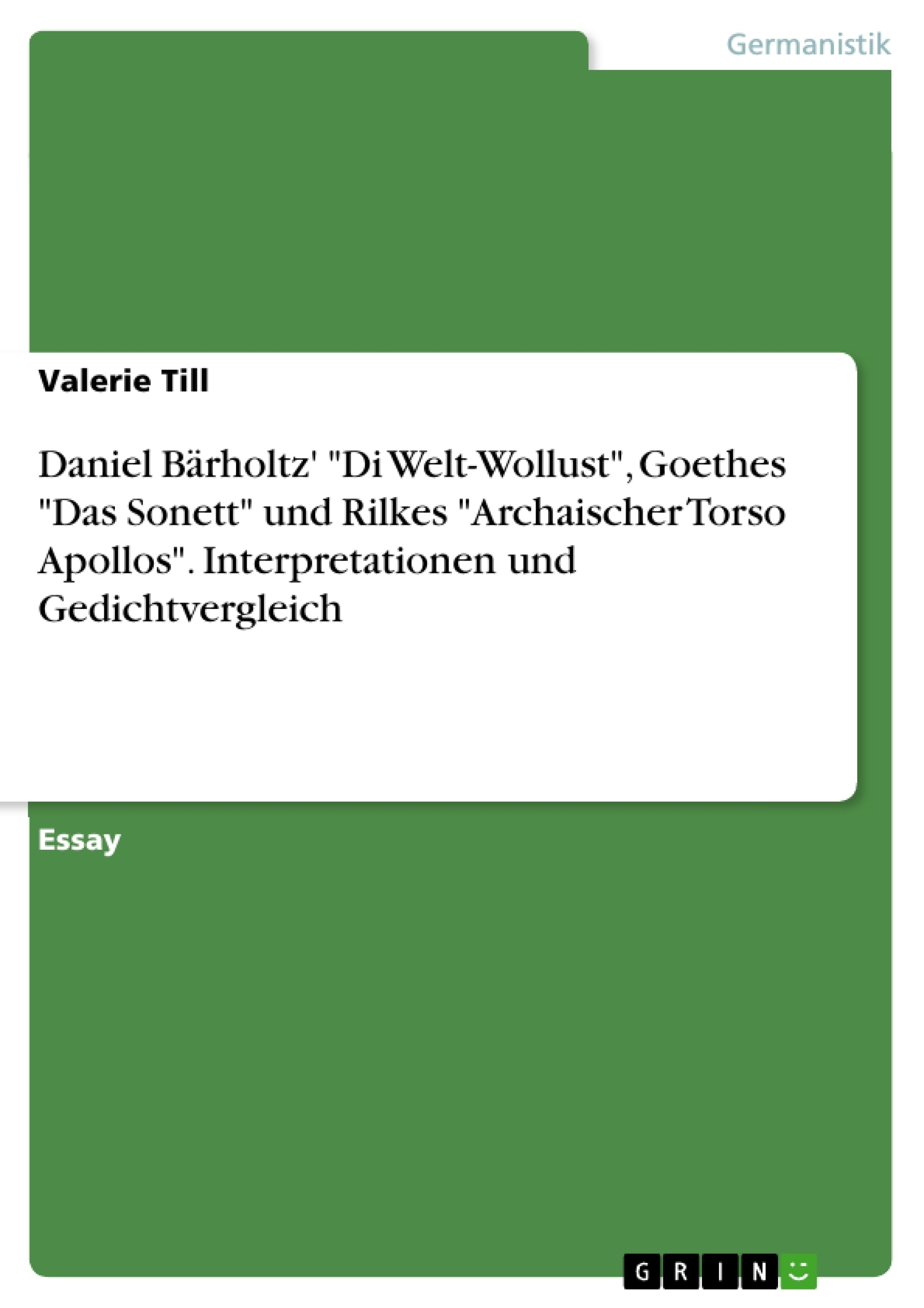Lyrische Texte, in denen Worte durch Reime, Metrik, Stilfiguren und Semantik miteinander verknüpft sind, nennt man überstrukturiert. Sie können auf der Inhalts- sowie auf der Ausdrucksebene analysiert werden.
Das sprachliche Zeichen nach Ferdinand de Saussure ist arbiträr, d.h. nicht durch Lautmalerei entstanden, sondern willkürlich gewählt. Eine Umstellung der Buchstaben innerhalb eines Wortes ist nicht möglich, da ansonsten der Sinn verloren gehen würde. Demnach ist das sprachliche Zeichen linear.
Da die Beziehung von Signifikat und Signifikant durch Gesellschaft und Normen konventionalisiert ist, ist jede Bezeichnung an ihren Gegenstand gebunden und unveränderlich.
Die Bedeutung eines Gedichtes erschließt sich durch die Betrachtung der Äquivalenzen und Oppositionen. Analysiert man einen lyrischen Text auf der Ebene des Signifikats (Inhaltsebene), wird zunächst die Denotation, also die geläufigste Grundbedeutung eines Ausdrucks betrachtet. Jeder Ausdruck erzeugt beim Leser unterschiedliche Assoziationen, diese beruhen auf den subjektiven Erfahrungen und können positiv oder negativ konnotiert sein. In Gedichten wird mithilfe von Metaphern, Metonymien und Symbolen eine andere Bedeutung eines Ausdrucks generiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die lyrische Überstrukturierung nach Jürgen Link
- II. Das Sonett
- III. Paul Fleming: Bei einer Leichen
- IV. Gedichtinterpretation
- a. Daniel Bärholtz: Di Welt-Wollust
- b. Johann Wolfgang Goethe: Das Sonett
- c. Rainer Maria Rilke: Archaischer Torso Apollos
- V. Gedichtvergleich
- VI. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Sonett als lyrische Form in der deutschen Literatur, anhand von ausgewählten Beispielen aus dem Barock und der Romantik. Dabei wird die lyrische Überstrukturierung nach Jürgen Link als analytisches Werkzeug eingesetzt, um die spezifischen Merkmale der Sonette zu beleuchten.
- Lyrische Überstrukturierung
- Das Sonett als Gedichtform
- Barock und Romantik in der Lyrik
- Motiv der Vergänglichkeit
- Analyse von Gedichtbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I. behandelt die lyrische Überstrukturierung nach Jürgen Link, wobei die Bedeutung sprachlicher Strukturen für die Interpretation lyrischer Texte hervorgehoben wird. Kapitel II. stellt die Gedichtform des Sonetts vor und betrachtet ihre historische Entwicklung und typischen Merkmale. Kapitel III. analysiert das Sonett „Bei einer Leichen“ von Paul Fleming und untersucht dessen thematische Schwerpunkte und formalen Elemente. Kapitel IV. widmet sich der Interpretation dreier Sonette: „Di Welt-Wollust“ von Daniel Bärholtz, „Das Sonett“ von Johann Wolfgang Goethe und „Archaischer Torso Apollos“ von Rainer Maria Rilke. Im Fokus stehen hier jeweils die spezifischen Interpretationen und die besondere Bedeutung der lyrischen Überstrukturierung in den einzelnen Gedichten.
Schlüsselwörter
Lyrische Überstrukturierung, Sonett, Barock, Romantik, Vergänglichkeit, Daniel Bärholtz, Paul Fleming, Johann Wolfgang Goethe, Rainer Maria Rilke, Gedichtinterpretation, Analyse, Metrik, Reimschema, Inhaltsebene, Ausdrucksseite, Signifikat, Signifikant.
- Quote paper
- Valerie Till (Author), 2014, Daniel Bärholtz' "Di Welt-Wollust", Goethes "Das Sonett" und Rilkes "Archaischer Torso Apollos". Interpretationen und Gedichtvergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302179