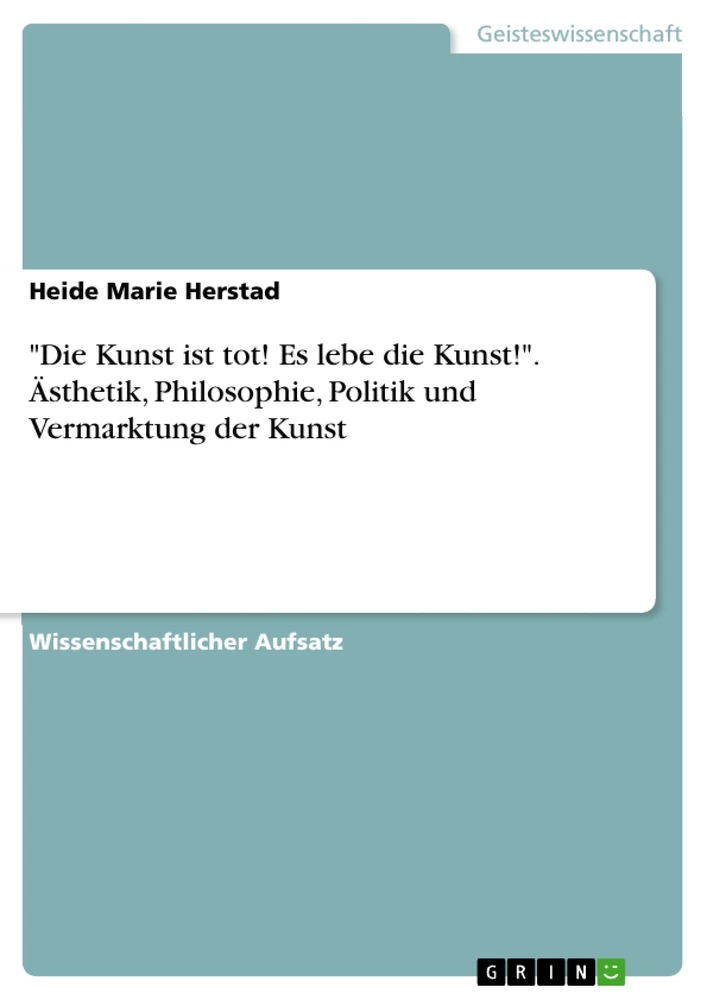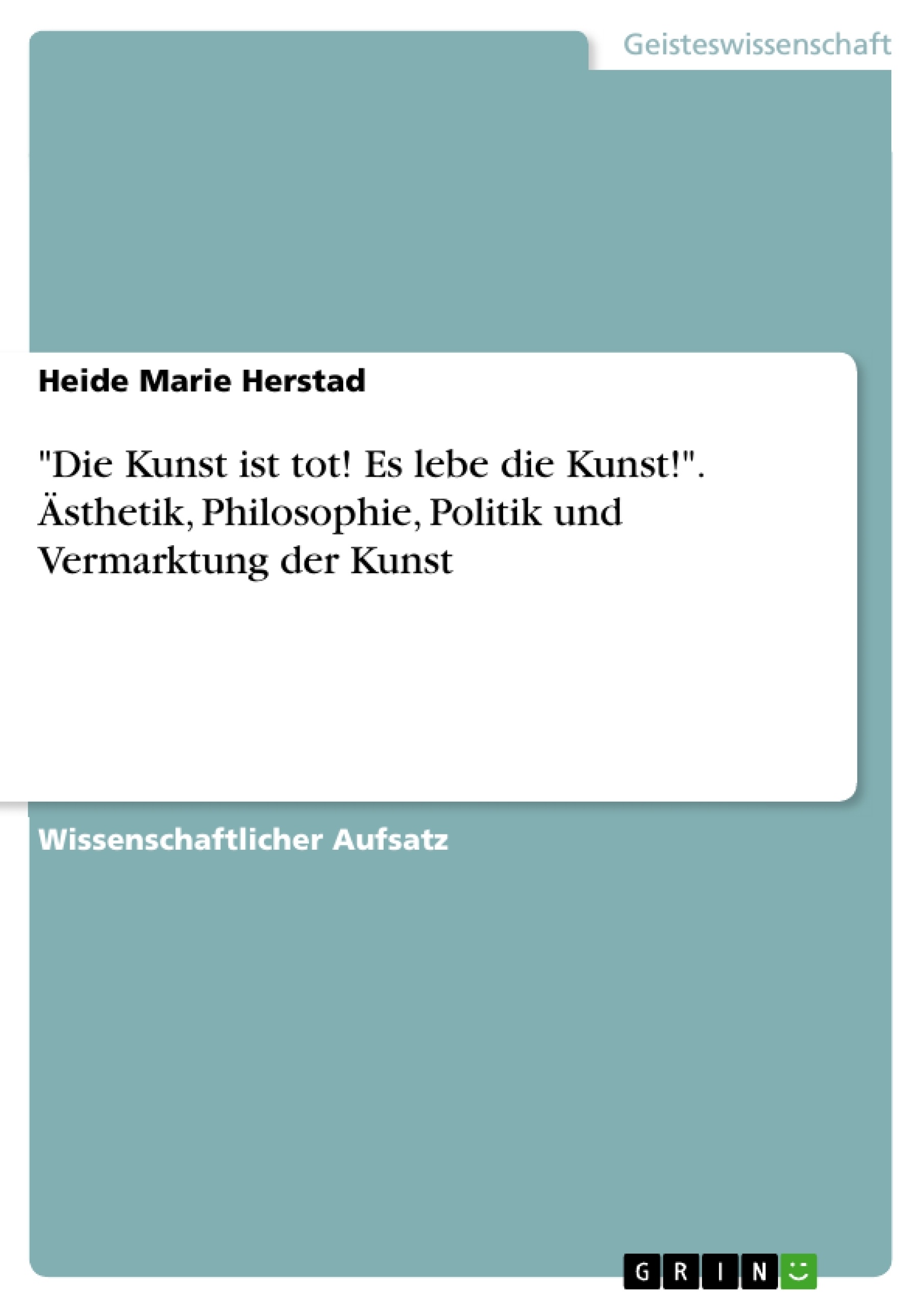Die Kunst ist tot! Es lebe die Kunst!
Kunst wurde im Laufe der Jahrtausende immer wieder zu Grabe getragen. Kunst als Teil des Lebens und einer Lebensvorstellung ist immer noch lebendig. Kunst als politisches Mittel war eine Demonstration der Größe Gottes und der Größe des Menschen. Kunst war eine Demonstration von Macht, Ehrwürdigkeit und Erhabenheit. Kunst schlug im demokratischen Zeitalter um in Kunstindustrie und künstlerische Reproduktion. Kunst ist heute die Jagd nach einem besseren Leben, nach einer Vergeistigung des Lebens und einer Ästhetisierung des Alltags. Kunst kann als Aktivierung des Lebens und als psychosomatische Reinigung verstanden werden. (Vgl. Shusterman, 2000). Kunst als Reflexion auf sich selbst verflüchtigte sich in die Theorie und Philosophie. Kunst als praktische Verwirklichung der Kunst zerbröselte in der Sucht nach dem Neuen.
Die Kunst erhielt einen funktionalen Wert. Sie sollte unendliche Abgründe im Menschen aufdecken und entdecken und die exotische Außenwelt des anderen in einer sich globalisierenden Welt ausloten. Kunst verschwindet mit der Idee des Abendlandes und taucht in immer neuen Gewändern von östlicher Weisheit, von mythologischer Erkenntnis und vom Credo einer globalen Toleranz auf.
Kunst als Träger kultureller Werte wird darin zum Träger der Transformation von Ideen und zum Träger der Transformation und Veränderung des Menschen.
Kunst als Mittel zur Transformation reflektiert auf keine Wirklichkeit mehr, sondern verflüchtigt sich in die Transformation der Transformation. Wirklichkeit entwirklicht spiegelt sich nicht in Kunst, sondern nur in der Idee der Veränderung von Wirklichkeit. Kunst auf den Menschen fixiert, verweilt in der reinen Nabelschau. Kunst an die politischen, sozialen, kulturellen und philosophischen Ereignisse gebunden lebt und stirbt mit ihrer jeweiligen Funktion. Kunst zur Autonomie erklärt schwebt im luftleeren Raum. Kunst wird funktionslos und gegenstandslos. Kunst reflektiert dann nur auf sich selbst.
Die Kunst ist tot! Sie wurde schon von Platon an den Schandpfahl gebunden und aus der feinen Gesellschaft rausgeschmissen. Sie wurde über die Jahrhunderte ständig aufs Neue zu Grabe getragen.
Die Kunst lebt immer noch! Die Kunst lebt solange der Mensch in immer neuer Realisierung seiner selbst sein In-der-Welt-Sein und seine Vergänglichkeit in sich ständig wandelnden Formen zu begreifen versucht.
Inhaltsverzeichnis
- Das Ende der Kunst
- Kunst in der Antike
- Platon und die Nachahmung der Wirklichkeit
- Aristoteles und die Transformation des Menschen
- Kunst im Mittelalter
- Kunst in der Renaissance
- Kunst in der Aufklärung
- Leibniz und die sinnliche Erkenntnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Entwicklung des Kunstbegriffs von der Antike bis zur Moderne und Postmoderne. Er untersucht, wie der Mensch im Laufe der Jahrhunderte Kunst in Relation zu seinem Weltverständnis verstand und wie sich der Tanz als Kunst in die Debatte um Kunstreflexion, Kunstphilosophie und Ästhetik einordnen lässt.
- Die Entwicklung des Kunstbegriffs in verschiedenen Epochen
- Die Rolle der Nachahmung und Transformation in der Kunst
- Der Einfluss von Platon und Aristoteles auf die Kunsttheorie
- Die Verbindung von Kunst und Weltverständnis
- Die Integration des Tanzes in die Kunstdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Diskussion über das Ende der Kunst und stellt fest, dass es immer etwas anderes bedeutet, abhängig davon, was unter Kunst verstanden wird. Der Text analysiert dann die ersten Kunstdiskussionen in der Antike, die Kunst als Nachahmung der Wirklichkeit verstanden haben. Platon kritisierte diese Nachahmungskunst, weil sie die Wahrheit der Ideen verfälschte. Aristoteles hingegen sah in Kunst die Transformation des Menschen durch die Wirkung von Emotionen wie Furcht und Mitleid. Der Text beleuchtet die Entwicklung des Kunstverständnisses im Mittelalter und in der Renaissance, wo die platonische Tradition weiterhin dominierte. Mit der Aufklärung wurde die ästhetische Kunstbetrachtung als Teil der Metaphysik verstanden. Der Text schließt mit einer Diskussion über Leibniz, der die sinnliche Erkenntnis aufwertete und Kunst als Produkt sinnlicher Aktivität und als Seinsmodus des Menschen sah.
Schlüsselwörter
Kunstbegriff, Antike, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Platon, Aristoteles, Nachahmung, Transformation, Weltverständnis, Tanz, Ästhetik, Seinsmodus.
- Quote paper
- Dr. phil. MA Heide Marie Herstad (Author), 2005, "Die Kunst ist tot! Es lebe die Kunst!". Ästhetik, Philosophie, Politik und Vermarktung der Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302113