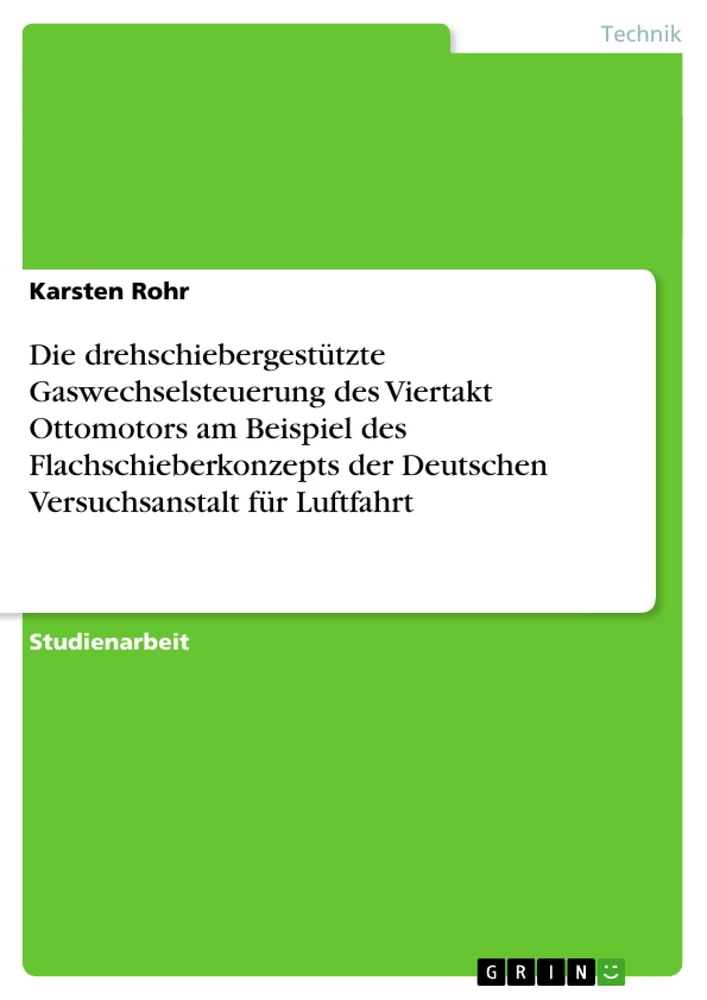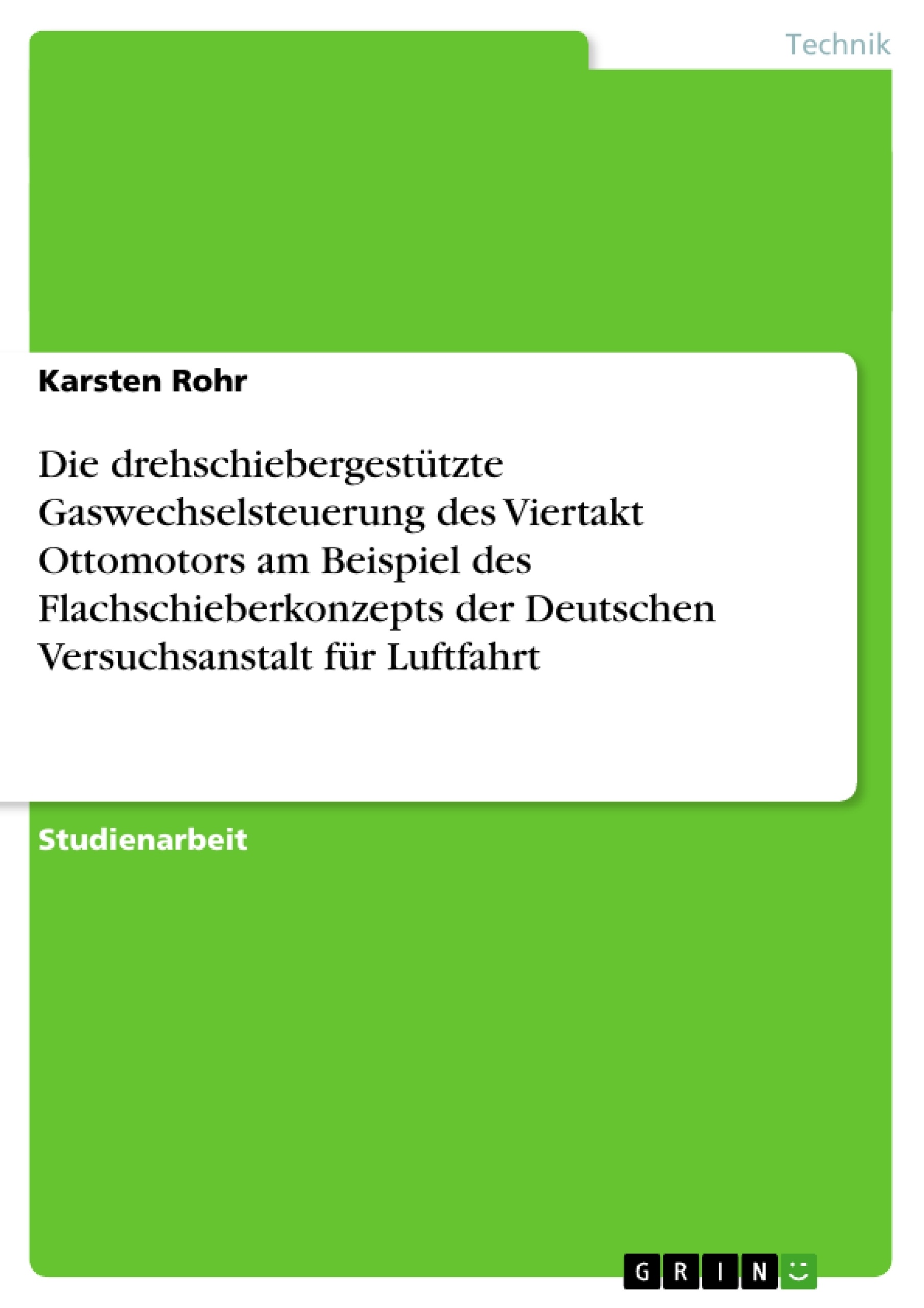„Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß die bei Drehschiebersteuerung auftretenden Schwierigkeiten zu beheben sind. Der Schiebermotor wird daher in absehbarer Zeit zu verwirklichen sein, seine großen
Die ständige Nachfrage nach höherer Leistungsfähigkeit der Flugmotoren bei gleichzeitiger Verringerung von Gewicht und Ausmaßen lieferte die Initialzündung der Entwicklung von Schiebermotoren. Auf der Suche nach Mehrleistung durch größere Steuerquerschnitte und beschleunigten Eröffnungsverlauf stießen die Ingenieure auf die Grenzen der Belastbarkeit damaliger Ventilsteuerungen. Zur Einhaltung der genannten Kriterien verpflichtet, konnten sie nicht auf eine bloße Vergrößerung des Hubraums des Triebwerks zurückgreifen. Neue Wege der Leistungssteigerung mussten erforscht werden.
Einige Ergebnisse dieses Prozesses sollen T hema dieser Arbeit sein. Eine bloße Auflistung aller Konstruktionsvorschläge kann keinen Einblick in die Herausforderung der Entwicklung von Schiebermotoren bieten. Um ein Verständnis für die Hinwendung der Ingenieure zu selbigen zu schaffen, wird zuerst a uf die Problematik ventilgestützter Gaswechselsteuerung nach damaligem Kenntnisstand eingegangen, um anschließend eine vorgeschlagene Klassifizierung aufgrund ihres Hauptunterscheidungsmerkmals zu beleuchten. Eine darauf folgende Auseinandersetzung mit der größten Herausforderung in der Entwicklung von Drehschiebermotoren, der Abdichtung der Steuerorgane gegen den Verbrennungsdruck und deren mögliche Lösung ist für die spätere Beurteilung einiger weniger, ausgeführter Modelle notwendig. Besondere Beachtung kommt hierbei der Flachschiebersteuerung der DVL 3 zu, deren ausgereifte und betriebssichere Konstruktion sich schlussendlich nicht in der Zahl der ausgeführten Motoren widerspiegelt.
Ein Betrachtungspunkt dieser Arbeit soll somit die Klärung der Frage sein, welches die Probleme der Steuerung des Gaswechsels durch Drehschieber sind, die ihre weitere Verbreitung und praktische Umsetzung verhinderte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vor- und Nachteile gebräuchlicher Gaswechselsteuerung
- 3. Klassifizierung der Schiebersteuerung
- 3.1 Niederdruckschieber
- 3.2 Hochdruckschieber
- 4. Die Herausforderung der Abdichtung und Schmierung
- 5. Verschiedene Modelle gleichförmig bewegter Schiebersteuerung
- 5.1 Walzenschieber
- 5.2 Baer-Walzenschieber
- 5.4 Bristol Planschieber
- 6. DVL-Flachschieber
- 6.1 Allgemeine Konstruktionsmerkmale
- 6.2 Berechnung der Steueröffnungen
- 6.3 Die Gestaltung der Dichtelemente
- 6.4 Beurteilung des DVL-Flachschiebers
- 6.5 Weiterentwicklungsmöglichkeiten des DVL-Flachschiebers
- 6.6 Motorkonstruktionen unter Verwendung des DVL-Flachschieberkonzepts
- 6.6.1 V4-Motor
- 6.6.2 Junkers-Kreismotor
- 7. Resümee
- 8. Abbildungsverzeichnis
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die drehschiebergestützte Gaswechselsteuerung im Viertakt-Ottomotor, insbesondere die Herausforderungen ihrer Konstruktion am Beispiel des Flachschieberkonzepts der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL). Ziel ist es, die Probleme aufzuzeigen, die die Verbreitung dieser Technologie trotz ihrer potenziellen Vorteile bisher verhindert haben.
- Vergleich von Drehschieber- und Ventilsteuerung
- Herausforderungen der Abdichtung und Schmierung bei Drehschiebern
- Konstruktionsmerkmale und -probleme des DVL-Flachschiebers
- Bewertung des DVL-Flachschieberkonzepts und seiner Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Beispiele für Motorkonstruktionen mit DVL-Flachschiebern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der drehschiebergestützten Gaswechselsteuerung ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die geringe Verbreitung dieser Technologie trotz ihrer potenziellen Vorteile. Sie verweist auf frühere positive Einschätzungen der Technologie und hebt die Bedeutung der Abdichtung als Kernproblem hervor. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die Herausforderungen der Drehschiebersteuerung zu verstehen und zu analysieren.
2. Vor- und Nachteile gebräuchlicher Gaswechselsteuerung: Dieses Kapitel vergleicht die konventionelle Ventilsteuerung mit der Drehschiebersteuerung. Es werden die Nachteile der Ventilsteuerung ausführlich dargelegt, darunter hohe mechanische Belastung, geringe Öffnungsquerschnitte, hohe thermische Belastung der Ventile, Wärmebeeinflussung der Frischgase und erhöhte Klopfneigung. Im Gegenzug werden die Vorteile der Drehschiebersteuerung hervorgehoben: geringere mechanische Belastung, größere Öffnungsquerschnitte, geringere thermische Belastung und weniger Geräuschentwicklung. Der Kontrast der beiden Systeme bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Drehschiebertechnologie.
3. Klassifizierung der Schiebersteuerung: Dieses Kapitel präsentiert eine Klassifizierung der Schiebersteuerung, indem es Niederdruck- und Hochdruckschieber unterscheidet. Es legt die Grundlage für ein tiefergehendes Verständnis der unterschiedlichen Designs und ihrer spezifischen Herausforderungen. Die detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Arten von Schiebern dient als Grundlage für den Vergleich mit dem DVL-Flachschieber in späteren Kapiteln.
4. Die Herausforderung der Abdichtung und Schmierung: Das Kapitel fokussiert sich auf die entscheidende Herausforderung bei Drehschiebermotoren: die Abdichtung gegen den Verbrennungsdruck. Es untersucht verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem und unterstreicht dessen Bedeutung für die Praxistauglichkeit der Technologie. Dies ist ein zentraler Punkt, der die spätere Diskussion um den DVL-Flachschieber entscheidend beeinflusst.
5. Verschiedene Modelle gleichförmig bewegter Schiebersteuerung: Das Kapitel stellt verschiedene Modelle gleichförmig bewegter Schiebersteuerungen vor, wie z.B. Walzenschieber und den Bristol Planschieber. Diese Beispiele dienen dem Vergleich und der Einordnung des DVL-Flachschiebers in den Kontext existierender Technologien. Die Beschreibung der verschiedenen Ansätze verdeutlicht die Bandbreite der Lösungsversuche für die Herausforderungen der Drehschiebersteuerung.
6. DVL-Flachschieber: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das DVL-Flachschieberkonzept. Es beschreibt die allgemeinen Konstruktionsmerkmale, die Berechnung der Steueröffnungen, die Gestaltung der Dichtelemente, und bewertet die Vor- und Nachteile dieses spezifischen Designs. Zusätzlich werden Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Beispiele für Motorkonstruktionen unter Verwendung dieses Konzepts (V4-Motor und Junkers-Kreismotor) präsentiert. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Analyse der Stärken und Schwächen des DVL-Flachschiebers und seiner Relevanz im Kontext der Gesamtproblematik.
Schlüsselwörter
Drehschiebersteuerung, Viertakt-Ottomotor, Gaswechsel, Abdichtung, Schmierung, DVL-Flachschieber, Ventilsteuerung, Motorkonstruktion, Leistungsfähigkeit, Vergleich, Hochdruckschieber, Niederdruckschieber.
FAQ: Seminararbeit über Drehschiebergestützte Gaswechselsteuerung
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die drehschiebergestützte Gaswechselsteuerung im Viertakt-Ottomotor, insbesondere die Herausforderungen ihrer Konstruktion am Beispiel des Flachschieberkonzepts der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL). Das Hauptziel ist die Analyse der Gründe für die geringe Verbreitung dieser Technologie trotz potenzieller Vorteile.
Welche Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich von Drehschieber- und Ventilsteuerung, die Herausforderungen der Abdichtung und Schmierung bei Drehschiebern, die Konstruktionsmerkmale und -probleme des DVL-Flachschiebers, eine Bewertung des DVL-Flachschieberkonzepts und dessen Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie Beispiele für Motorkonstruktionen mit DVL-Flachschiebern.
Welche Arten von Schiebersteuerungen werden klassifiziert?
Die Arbeit klassifiziert Schiebersteuerungen in Niederdruck- und Hochdruckschieber und beschreibt verschiedene Modelle gleichförmig bewegter Schiebersteuerungen wie Walzenschieber und Bristol Planschieber.
Welche Herausforderungen werden bei der Drehschiebersteuerung besonders hervorgehoben?
Die größte Herausforderung ist die Abdichtung gegen den Verbrennungsdruck. Die Arbeit untersucht verschiedene Lösungsansätze und deren Bedeutung für die Praxistauglichkeit der Technologie.
Was ist der Fokus des Kapitels über den DVL-Flachschieber?
Das Kapitel konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse des DVL-Flachschieberkonzepts, einschließlich der Konstruktionsmerkmale, der Berechnung der Steueröffnungen, der Gestaltung der Dichtelemente, der Vor- und Nachteile, der Weiterentwicklungsmöglichkeiten und von Beispielen für Motorkonstruktionen (V4-Motor und Junkers-Kreismotor).
Welche Vor- und Nachteile der Drehschieber- und Ventilsteuerung werden verglichen?
Die Ventilsteuerung weist Nachteile wie hohe mechanische Belastung, geringe Öffnungsquerschnitte, hohe thermische Belastung der Ventile, Wärmebeeinflussung der Frischgase und erhöhte Klopfneigung auf. Die Drehschiebersteuerung bietet Vorteile wie geringere mechanische Belastung, größere Öffnungsquerschnitte, geringere thermische Belastung und weniger Geräuschentwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Drehschiebersteuerung, Viertakt-Ottomotor, Gaswechsel, Abdichtung, Schmierung, DVL-Flachschieber, Ventilsteuerung, Motorkonstruktion, Leistungsfähigkeit, Vergleich, Hochdruckschieber, Niederdruckschieber.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis der Seminararbeit?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der Seminararbeit und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Literaturverzeichnis.
Welche konkreten Motorkonstruktionen werden im Zusammenhang mit dem DVL-Flachschieber vorgestellt?
Die Arbeit nennt den V4-Motor und den Junkers-Kreismotor als Beispiele für Motorkonstruktionen, die das DVL-Flachschieberkonzept verwenden.
- Quote paper
- Dipl.-Päd. Karsten Rohr (Author), 2004, Die drehschiebergestützte Gaswechselsteuerung des Viertakt Ottomotors am Beispiel des Flachschieberkonzepts der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30174