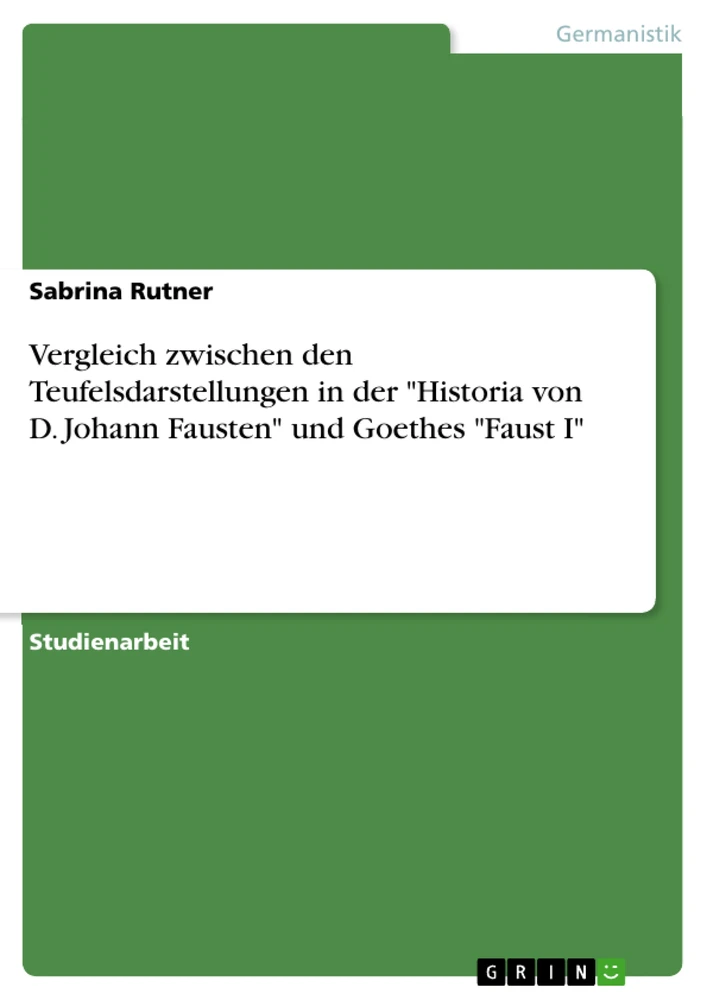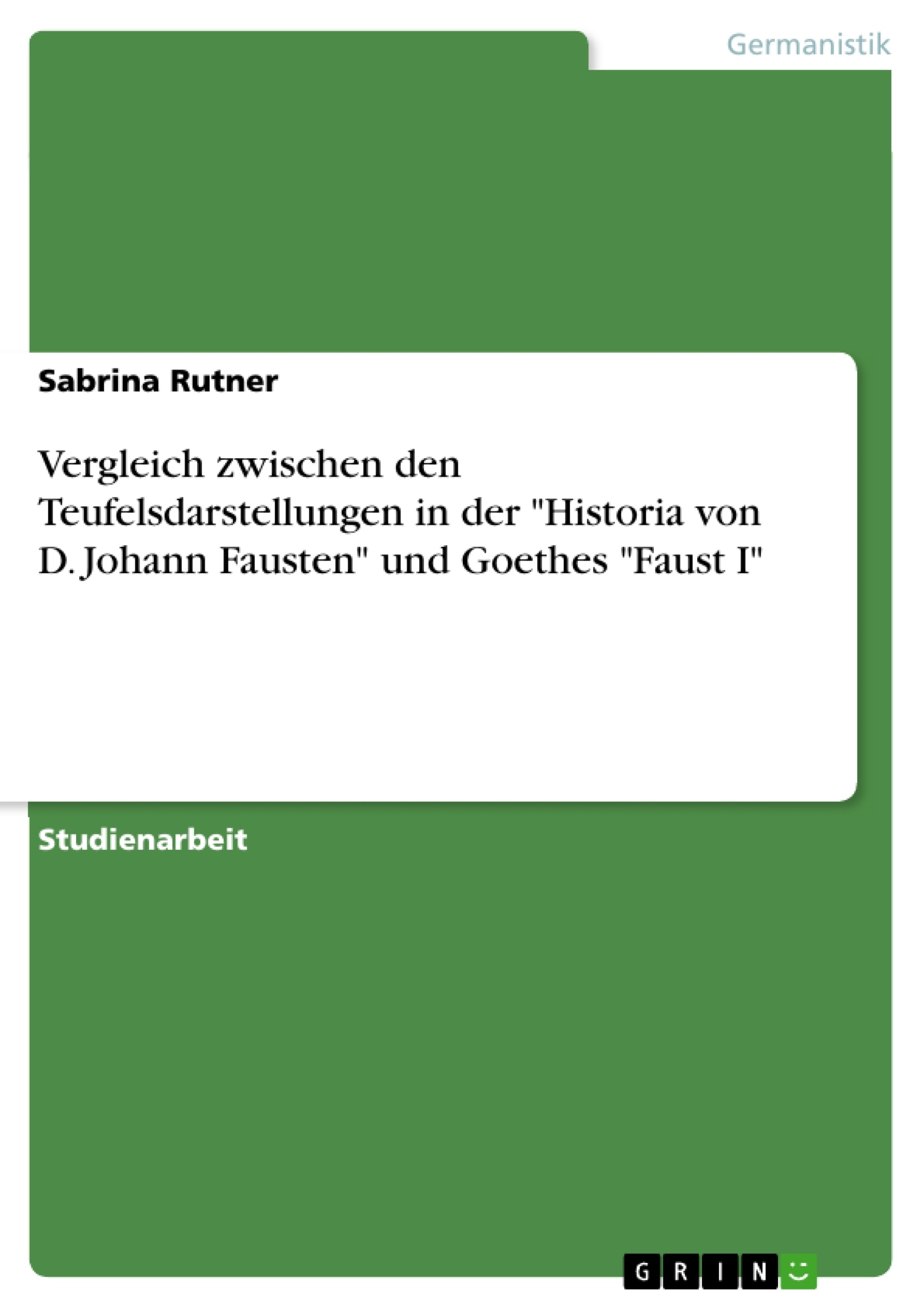Durch welche unterschiedlichen Gestalten ist der Mephistopheles in der "Historia" und in Goethes "Faust I" repräsentiert und welche Funktion nimmt die Zurschaustellung der Verwandlungskunst des Teufels ein? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für das Verständnis des Teufels ziehen und welchem Wandel ist die Teufelsdarstellung bei Goethe unterworfen?
Um diese Fragen beantworten zu können, werden die beiden Werke in der vorliegenden Arbeit vergleichend analysiert werden. In einem ersten Schritt kurz der religiöse Kontext aufgezeigt werden, in den die Teufelsdarstellung der "Historia" eingebettet ist. Anschließend werden die verschiedenen Gestalten untersucht, die Mephistopheles – insbesondere bei seiner Beschwörung – annimmt. Auch die Funktion der teuflischen Verwandlungskunst soll an dieser Stelle thematisiert werden. Es wird sich herausstellen, dass Mephistopheles am häufigsten als Affe erscheint, sodass diese Gestalt einer ausführlichen Analyse unterzogen wird. Neben Mephistopheles treten in der "Historia" auch zahlreiche andere höllische Geister auf, die verschiedenste tierische Gestalten annehmen und Teil der teuflischen Inszenierung sind. Aus diesem Grund bedürfen auch die vielfältigen Erscheinungs- und Verwandlungsformen dieser Teufel einer genaueren Untersuchung.
Der zweite Teil der Arbeit wird sich mit Goethes "Faust I" beschäftigen. Hier soll zunächst erläutert werden, wie sich die Vorstellung von Hölle und Teufel in der Epoche der Aufklärung gewandelt hat. Anschließend soll herausgearbeitet werden, welche verschiedenen Gestalten Mephistopheles in Goethes "Faust I" annimmt und warum er nicht mehr in seiner traditionellen Teufelsgestalt auftritt. Die anschließende Schlussbetrachtung soll die erarbeiteten Ergebnisse kurz zusammenfassen und klären, ob die gestellten Fragen beantwortet werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teuflische Erscheinungsformen in der Historia von D. Johann Fausten
- Die Erscheinungsformen und Verwandlungskünste Mephistopheles
- Der Teufel als Affe
- Die Gestalten der höllischen Geister
- Die Teufelsgestalt des Mephistopheles in Goethes Faust I
- „Des Pudels Kern“
- Mephistopheles traditionelle Teufelsgestalt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedlichen Darstellungen des Teufels, insbesondere Mephistopheles, in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I". Ziel ist ein vergleichender Analyse der Teufelsgestalten und deren Wandel über die Jahrhunderte. Die Arbeit beleuchtet die Funktion der Verwandlungskünste des Teufels und die Bedeutung der verschiedenen Erscheinungsformen im Kontext der jeweiligen Epoche.
- Vergleichende Analyse der Teufelsgestalten in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I"
- Die Funktion der Verwandlungskünste Mephistopheles
- Der Wandel der Teufelsdarstellung von der spätmittelalterlichen zur Aufklärungsepoche
- Die Bedeutung der Tiergestalten als Sinnbilder des Bösen
- Der Einfluss des religiösen und kulturellen Kontextes auf die Teufelsdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Teufelsdarstellungen in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I" ein. Sie beschreibt den langen und vielschichtigen Einfluss der Faust-Thematik in der Literatur und hebt die Forschungslücke bezüglich eines direkten Vergleichs der Teufelsgestalten in beiden Werken hervor. Die Arbeit formuliert Forschungsfragen, die die unterschiedlichen Erscheinungsformen Mephistopheles und die Funktion seiner Verwandlungskünste untersuchen sollen, sowie den Wandel der Teufelsdarstellung bei Goethe.
Teuflische Erscheinungsformen in der Historia von D. Johann Fausten: Dieses Kapitel untersucht die teuflischen Erscheinungsformen in der "Historia", eingebettet in den religiösen Kontext des christlichen Mittelalters. Die Darstellung des Teufels ist stark von den theologischen Vorstellungen dieser Epoche geprägt und verwendet Allegorien. Höllische Teufel erscheinen in Tiergestalten oder als Mischwesen, wobei die Tiergestalten als Sinnbilder teuflischer Laster interpretiert werden. Die Vielfalt der Erscheinungsformen spiegelt die Vielschichtigkeit des Bösen wider, wobei den verschiedenen Gestalten unterschiedliche Funktionen zukommen. Der Teufel Mephistopheles, als Unterteufel, wird detailliert betrachtet, seine erste Erscheinung als ein großes, theatralisches Schauspiel, das sowohl erschreckt als auch fasziniert.
Die Teufelsgestalt des Mephistopheles in Goethes Faust I: Dieses Kapitel analysiert Mephistopheles in Goethes "Faust I" im Kontext des Wandels der Vorstellung von Hölle und Teufel während der Aufklärung. Es untersucht die unterschiedlichen Gestalten, die Mephistopheles annimmt und die Gründe, warum er nicht mehr in seiner traditionellen Teufelsgestalt erscheint. Im Gegensatz zur "Historia" wird der Fokus auf die differenzierte Darstellung und die psychologische Komplexität Mephistopheles gelegt.
Schlüsselwörter
Mephistopheles, Teufelsdarstellung, Historia von D. Johann Fausten, Goethe, Faust I, Verwandlungskunst, Allegorie, Tiergestalten, christliche Theologie, Aufklärung, Hölle, Böse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Teuflische Erscheinungsformen in der Historia von D. Johann Fausten und Goethes Faust I"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert vergleichend die Darstellung des Teufels, insbesondere Mephistopheles, in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I". Im Fokus steht der Wandel der Teufelsgestalt über die Jahrhunderte und die Funktion der Verwandlungskünste Mephistopheles im jeweiligen historischen und kulturellen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Erscheinungsformen Mephistopheles in beiden Werken, die Bedeutung der Verwandlungskünste, den Einfluss des religiösen und kulturellen Kontextes auf die Teufelsdarstellung (Mittelalter vs. Aufklärung), und die Funktion von Tiergestalten als Sinnbilder des Bösen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Teufelsdarstellung in der spätmittelalterlichen "Historia" und der Aufklärungsepoche Goethes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die teuflischen Erscheinungsformen in der "Historia von D. Johann Fausten", ein Kapitel über Mephistopheles in Goethes "Faust I", und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Forschungslücke und formuliert die Forschungsfragen. Das zweite Kapitel analysiert die vielfältigen, oft tierischen Erscheinungsformen des Teufels in der "Historia", während das dritte Kapitel die differenziertere und psychologisch komplexere Darstellung Mephistopheles bei Goethe untersucht.
Wie wird der Teufel in der "Historia von D. Johann Fausten" dargestellt?
In der "Historia" erscheint der Teufel stark von den theologischen Vorstellungen des christlichen Mittelalters geprägt. Er manifestiert sich in vielfältigen Gestalten, oft als Mischwesen oder Tier, die als Allegorien für teuflische Laster interpretiert werden können. Mephistopheles' erste Erscheinung wird als großes, theatralisches Schauspiel beschrieben.
Wie unterscheidet sich die Darstellung des Teufels bei Goethe?
Goethes Darstellung des Mephistopheles steht im Kontext der Aufklärung und weicht von der traditionellen Teufelsgestalt ab. Der Fokus liegt auf der differenzierten Darstellung und der psychologischen Komplexität des Charakters, im Gegensatz zur eher allegorischen Darstellung in der "Historia".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Mephistopheles, Teufelsdarstellung, Historia von D. Johann Fausten, Goethe, Faust I, Verwandlungskunst, Allegorie, Tiergestalten, christliche Theologie, Aufklärung, Hölle, Böse.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das übergeordnete Ziel ist eine vergleichende Analyse der Teufelsgestalten in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I", um den Wandel der Teufelsdarstellung über die Jahrhunderte und die jeweilige Funktion der Teufelsgestalten im Kontext der jeweiligen Epoche zu beleuchten.
- Quote paper
- Sabrina Rutner (Author), 2014, Vergleich zwischen den Teufelsdarstellungen in der "Historia von D. Johann Fausten" und Goethes "Faust I", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301733