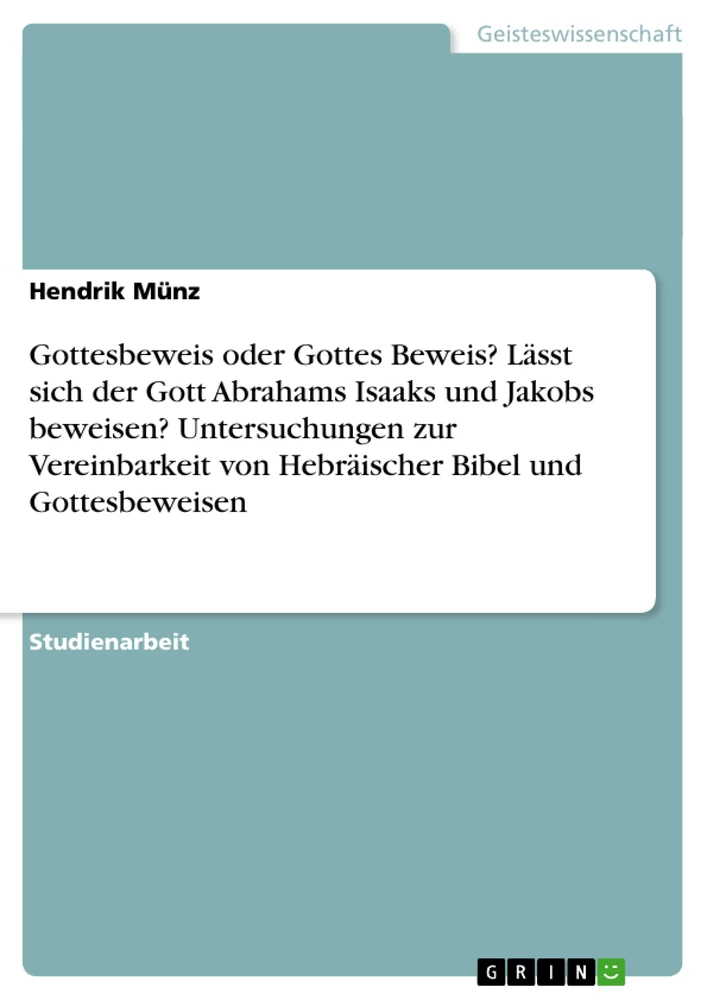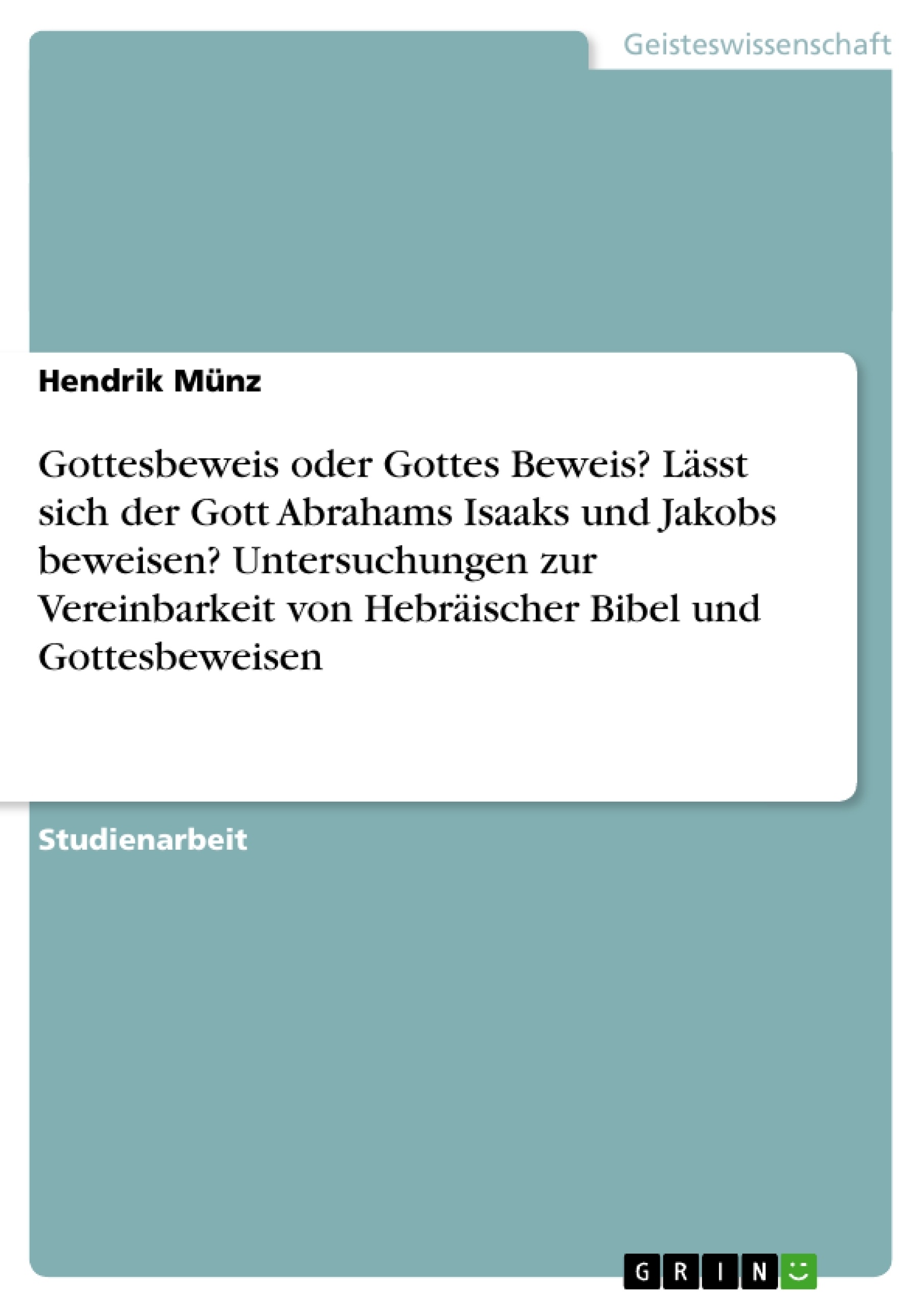Die Säkularisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass der gesellschaftliche Einfluss der Kirchen stark abgenommen hat, die christliche Position in politischen Debatten immer schwächer beachtet und als eine neben zahlreichen anderen Positionen gesehen wird. So wird in unseren pluralistischen Gesellschaften Christsein nur noch als private Entscheidung angesehen.
„Wo aber Christsein auf eine private Entscheidung reduziert wird, haben Christen keine Basis mehr, die Gesellschaft zum Beispiel in ethischen Fragen auf Gottes Ordnung hinzuweisen.“ Es stellt sich aus kirchlicher Sicht also die Frage, wie man das Fortschreiten des Autoritätsverlustes der Kirche einschränken und die Relevanz der eigenen Position für die Gesellschaft begründen kann, wie man es legitimieren kann, in einer vielstimmigen Zeit von Gott zu reden. Heutzutage sind bei Gläubigen apologetische Fähigkeiten sehr gefragt. Dieses gestiegene Bedürfnis nach Apologetik führte in den letzten dreißig Jahren vor allem im angelsächsischen Raum zu einer Renaissance der Gottesbeweise.
Diese Beobachtungen und die Tatsache, dass ich mich in meinem gemeindlichen Alltag immer häufiger mit der Frage nach Gottes Existenz konfrontiert sah, veranlassten mich zu einer intensiven Beschäftigung mit einzelnen Gottesbeweisen.
Im Rahmen dieser Studien begegneten mir wiederholt in den einzelnen Beweisgängen Passagen, die es mir schwierig erscheinen ließen, das Wesen, dessen Existenz dort nachgewiesen werden sollte, mit dem Gott der Bibel zu identifizieren. Zudem entstanden immer größere Bedenken im Blick auf die Art und Weise, in der Aussagen über Gott gemacht wurden, zumal ich den diesen Aussagen zugrunde liegenden Prozess des Erkenntnisgewinns für theologisch zweifelhaft hielt. Daher erschien es mir sinnvoll, an die Bibel die Frage zu stellen, ob und – wenn ja – wie der Gott, von dem sie erzählt, beweisbar ist.
Den Abschluss des ersten Teils meiner Untersuchungen, auf den ein zweiter sich mit dem Neuen Testament befassender folgen soll, bildet diese Arbeit zur Hebräischen Bibel, die prüfen soll, ob diese Urkunde Gottesbeweise zulässt oder gar enthält.
Ein zweites Ziel dieser Arbeit ist es, einige Kriterien zu entwickeln, mit deren Hilfe neue apologetische Versuche daraufhin untersucht werden können, ob sie mit der Hebräischen Bibel vereinbar sind. So könnte es möglich werden, eine zeitgemäße Apologetik zu entwickeln, die der Theologie der Hebräischen Bibel gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Popularität und Relevanz der Gottesbeweise
- Die klassischen Gottesbeweise
- Genese und Rezeption der klassischen Gottesbeweise
- Der ontologische Gottesbeweis des Anselm von Canterbury (1033 bis 1109) als erster vollständiger christlicher Gottesbeweis
- Reaktionen auf Anselms Beweis und Gegenentwürfe
- Differenzierung der drei Gottesbeweise gemäß ihrer Vorgehensweise: Narrativ-argumentative vs. kontemplativ-argumentative Methode
- Argumente wider und für die Vereinbarkeit der angeführten Gottesbeweise und der hebräischen Bibel
- Argumente gegen die Billigung von Gottesbeweisen
- Karl Barths Bedenken gegenüber nahezu allen formalen Gottesbeweisen
- Formal-logischer Einwand
- Kein Bedarf für Gottesbeweise in der hebräischen Bibel
- Argumente für die Billigung von Gottesbeweisen
- DtJes. 4021-26: Ein Gottesbeweis in der hebräischen Bibel?
- Weitere Vorformen von Gottesbeweisen in der hebräischen Bibel
- Jer. 3320-25: Gottes Bundestreue als Trost für Bedrängte
- Prov. 829: Die Nähe der Weisheit zum Schöpfer
- Kein ausdrückliches Verbot von Gottesbeweisen in der hebräischen Bibel
- Gottesbeweise und das Fremdgötterverbot (Ex. 203, Dtn. 57)
- Gottesbeweise und das Bilderverbot (Ex. 204-6, Dtn. 58-10)
- Gottesbweise und das Verbot des Namensmissbrauches (Ex. 207, Dtn. 511)
- Vereinbarkeit von Hebräischer Bibel und Gottesbeweisen unter Wahrung bestimmter Kriterien
- Anforderungen an Gottesbeweise und Apologetik von Seiten der Hebräischen Bibel
- Das Verhüllungskriterium
- Das Selbsterschließungskriterium
- Das Autonomiekriterium
- Die adäquate Vorgehensweise im Blick auf Gottesbeweise und Apologetik
- Gottes Beweis statt Gottesbeweis: Der ontologische Gottesbeweis als der hebräischen Bibel am nächsten stehender Gottesbeweis
- Kriterien für eine der hebräischen Bibel gerecht werdende Apologetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie der Gott der Bibel beweisbar ist, insbesondere im Kontext der Hebräischen Bibel. Das Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Gottesbeweisen und der hebräischen Bibel zu untersuchen und Kriterien für eine zeitgemäße Apologetik zu entwickeln, die der Theologie der Hebräischen Bibel gerecht wird.
- Die Relevanz der Gottesbeweise in der modernen Welt
- Die Kritik an Gottesbeweisen aus der Sicht von Theologen wie Karl Barth
- Die Suche nach möglichen Gottesbeweisen in der hebräischen Bibel
- Die Entwicklung von Kriterien für eine apologetische Vorgehensweise, die mit der hebräischen Bibel vereinbar ist
- Der ontologische Gottesbeweis als Beispiel für einen Gottesbeweis, der der hebräischen Bibel näher steht
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz der Gottesbeweise in einer pluralistischen und zunehmend säkularen Gesellschaft. Die Arbeit stellt dar, wie die modernen Wissenschaften und die individualisierte Lebensweise die Frage nach Gottes Existenz neu stellen und ein Bedürfnis nach apologetischen Fähigkeiten erzeugen.
- Kapitel zwei behandelt die klassischen Gottesbeweise, insbesondere den ontologischen Gottesbeweis des Anselm von Canterbury. Es werden deren Entstehung, Rezeption und unterschiedliche Methoden dargestellt, um sie im weiteren Verlauf der Arbeit auf ihre Vereinbarkeit mit der hebräischen Bibel zu prüfen.
- Kapitel drei beschäftigt sich mit Argumenten, die sowohl für als auch gegen die Billigung von Gottesbeweisen sprechen. Die Arbeit analysiert kritische Stimmen, wie zum Beispiel Karl Barths Bedenken gegenüber formalen Gottesbeweisen, und untersucht gleichzeitig, ob die hebräische Bibel selbst Elemente enthält, die als Gottesbeweise interpretiert werden können.
- Kapitel vier stellt Anforderungen an Gottesbeweise und apologetische Ansätze aus der Sicht der hebräischen Bibel vor. Die Arbeit erläutert drei wichtige Kriterien: das Verhüllungskriterium, das Selbsterschließungskriterium und das Autonomiekriterium.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Themen wie Gottesbeweise, Apologetik, hebräische Bibel, Theologie, ontologischer Gottesbeweis, Karl Barth, Säkularisierung, Pluralismus, moderne Gesellschaft, religiöse Fragen, Apologetische Fähigkeiten, Theologie der hebräischen Bibel, Kriterien für apologetische Vorgehensweisen, Gottes Beweis statt Gottesbeweis.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Münz (Autor:in), 2004, Gottesbeweis oder Gottes Beweis? Lässt sich der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs beweisen? Untersuchungen zur Vereinbarkeit von Hebräischer Bibel und Gottesbeweisen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30173