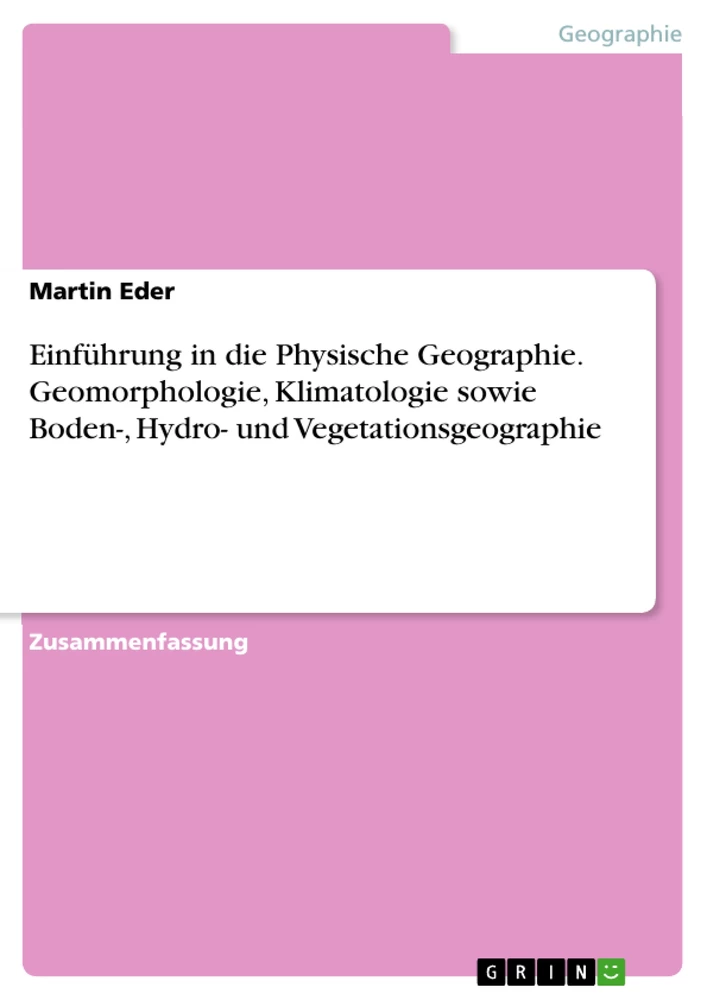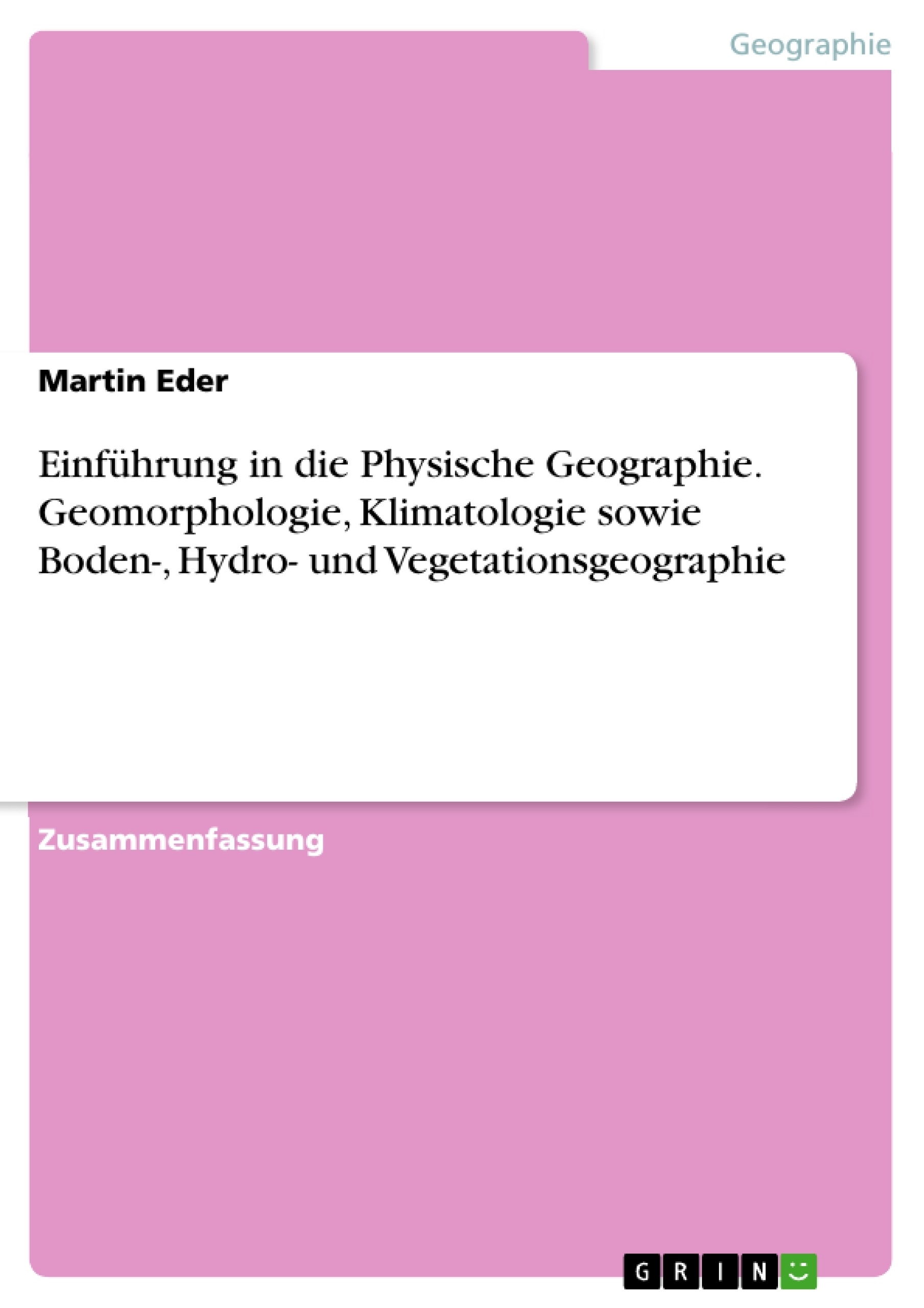Diese Lernzusammenfassung umfasst das Thema "Physische Geographie" in Stichpunkten. Dabei werden die folgenden Bereiche behandelt:
Geomorphologie,
Klimatologie,
Bodengeographie,
Hydrogeographie und
Vegetationsgeographie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Geologie / Geomorphologie
- 1 Einführung
- 1.1 Definition Geomorphologie
- 1.2 Reliefformen
- 1.3 Forschungsansätze
- 1.4 Erdgeschichtliche Zeiteinteilung
- 1.5 Methoden der Zeitbestimmung
- 1.5.1 Relative Datierung
- 1.5.2 Absolute Datierung
- 1.6 Landschaftsformende Prozesse
- 1.7 Schalenbau der Erde
- 2 Minerale
- 2.1 Übersicht
- 2.2 Definition Mineral
- 2.3 Wichtige Minerale
- 2.4 Eigenschaften
- 3 Gesteine
- 3.1 Definition Gestein
- 3.2 Gesteinsarten
- 3.2.1 Magmatit
- 3.2.2 Sedimentgestein
- 3.2.3 Metamorphit
- 3.3 Kreislauf der Gesteine
- 4 Verwitterung
- 4.1 Definition Verwitterung
- 4.2 Arten der Verwitterung
- 4.2.1 Physikalische Verwitterung
- 4.2.2 Chemische Verwitterung
- 4.3 Verwitterungsintensität
- 5 Plattentektonik
- 5.1 Definition Plattentektonik
- 5.2 Grundlagen
- 5.2.1 Erdkruste
- 5.2.2 Lithosphäre
- 5.3 Plattenbewegung
- 5.3.1 Geotektonische Hypothesen
- 5.3.2 Typen der Plattengrenzen
- 5.4 Folgen der Plattentektonik
- 6 Vulkanismus
- 6.1 Definition Vulkanismus
- 6.2 Arten des Vulkanismus
- 6.3 Ablauf eines Vulkanausbruchs
- 6.4 Lavatypen und Vulkanform
- 7 Plutonismus
- 7.1 Definition Plutonismus
- 7.2 Unterscheidung nach Größe und Lage
- 8 Orogenese
- 8.1 Definition Orogenese
- 8.1.1 Andinische Gebirgsbildung
- 8.1.2 Alpidische Gebirgsbildung
- 8.2 Faltenbildung
- 8.3 Formen
- 8.4 Block- und Bruchtektonik
- 8.4.1 Definition Block- und Bruchtektonik
- 8.4.2 Grundformen
- 8.4.3 Arten
- 8.5 Überblick über die Gebirgstypen
- 9 Geomorphologische Formungsprozesse
- 9.1 Gravitative Massenbewegung
- 9.1.1 Definition Gravitative Massenbewegung
- 9.1.2 Einflussfaktoren
- 9.1.3 Arten der Massenbewegung
- 9.2 Fluviale Formen und Prozesse
- 9.2.1 Wasserhaushalt
- 9.2.2 Fließgeschwindigkeit
- 9.3 Äolische Formen und Prozesse
- 9.3.1 Äolische Prozesse
- 9.4 Glaziale Formen und Prozesse
- 9.4.1 Formen der Gletscherbewegung
- 9.4.2 Glaziale Erosionsformen
- 9.4.3 Glaziale Akkumulationsformen: Moränen
- 9.5 Periglaziale Formen und Prozesse
- 9.5.1 Periglaziale Kleinformen
- 9.5.2 Periglaziale Mesoformen
- 9.6 Litorale Formen und Prozesse
- 9.6.1 Wellen
- 9.6.2 Gezeiten (Tide)
- 9.6.3 Küstenmorphologie
- 9.7 Formbildung durch Lösungsprozesse: Karst
- 9.7.1 Kohlensäureverwitterung
- 9.7.2 Mischungskorrosion
- 9.7.3 Oberirdische Erscheinungen (Oberflächenkarst)
- 9.7.4 Unterirdische Erscheinungen (Tiefenkarst)
- 10 Skulpturform vs. Strukturform
- II. Klimatologie
- 1 Definitionen und Begriffsklärungen
- 1.1 Meteorologie – Klimatologie
- 1.2 Wetter – Witterung – Klima
- 1.3 Klimaelemente – Klimafaktoren
- 1.4 Teilgebiete der Klimatologie
- 1.5 Räumliche Dimensionen des Klimas
- 2 Klimasystem
- 3 Atmosphäre
- 3.1 Definition „Atmosphäre“
- 3.2 Zusammensetzung
- 3.3 Aufbau
- 3.4 Zusammensetzung der Troposphäre
- 4 Strahlungs- und Wärmehaushalt der Erde
- 4.1 Astronomische und physikalische Grundlagen
- 4.1.1 Solarkonstante
- 4.1.2 Strahlungsenergie
- 4.2 Strahlungshaushalt
- 4.2.1 Energie-/Strahlungsspektrum
- 4.2.2 Strahlungsbilanzgleichung
- 4.2.3 Energiehaushalt von Erdoberfläche und Atmosphäre
- 5 Klimaelemente
- 5.1 Lufttemperatur
- 5.2 Wasserdampf
- 5.3 Wolken- und Niederschlagsbildung
- 5.3.1 Temperaturgradient der Troposphäre
- 5.3.2 Niederschlagsklassifizierung
- 5.3.3 Klimadiagramme
- 6 Luftbewegungen
- 6.1 Entstehung
- 6.2 Überblick über wirksame Kräfte
- 6.3 Horizontale Luftbewegung
- 6.3.1 Kleinräumig
- 6.3.2 Großräumig (global)
- 6.4 Vertikale Luftbewegung
- 6.5 Drucksysteme
- 6.5.1 Thermische Entstehung
- 6.5.2 Dynamische Entstehung
- 7 Planetarische Zirkulation
- 7.1 Überblick
- 7.1.1 Entstehung
- 7.1.2 Planetarische Frontalzone
- 7.2 Tropische Zirkulation
- 7.3 Außertropische Zirkulation
- 7.4 Planetarischer Überblick
- 8 Klimaklassifikation
- 9 Mesoklima: Kleinräumige Zirkulationssysteme
- 9.1 Landwind – Seewind
- 9.2 Hang-Windsysteme
- 9.3 Berg-Tal-Windsysteme
- 9.4 Föhnwind
- III. Bodenkunde
- 1 Einleitung
- 1.1 Begriff Boden (Pedon)
- 1.1.1 Ökosystematische Stellung des Bodens
- 1.1.2 Abgrenzung des Bodens
- 1.1.3 Definition „Boden“ (Pedon)
- 1.2 Bodenfunktionen
- 1.3 Bezeichnung der Bodenhorizonte
- 1.4 Überblick über die Pedogenese
- 2 Bodenbildende Faktoren
- 2.1 Relief
- 2.2 Mensch
- 2.3 Gestein
- 2.4 Klima
- 2.5 Organismen
- 2.5.1 Vegetation
- 2.5.2 Bodenlebewelt (Edaphon)
- 2.6 Zeit
- 3 Bodenbildende Prozesse
- 3.1 Transformationsprozesse
- 3.1.1 Verwitterung
- 3.1.2 Zersetzung
- 3.1.3 Humifizierung
- 3.1.4 Mineralneubildung – Tonmineralneubildung – Verlehmung
- 3.1.5 Gefügebildung
- 3.1.6 Verbraunung
- 3.2 Translokationsprozesse
- 3.2.1 Tonverlagerung (Lessivierung)
- 3.2.2 Podsolierung (Verlagerung organischer Substanz und Metalloxiden)
- 3.2.3 Salz-, Kalk- und Gipsverlagerung
- 3.2.4 Turbation
- 3.2.5 Oberflächenverlagerung
- 3.3 Überblick über bodenbildende Prozesse und Klimabedingungen
- 4 Bodenvolumen
- 4.1 Substanzvolumen
- 4.1.1 Mineralische Bodensubstanz
- 4.1.2 Organische Bodensubstanz
- 4.2 Porenvolumen
- 4.2.1 Bodenluft
- 4.2.2 Bodenwasser
- 5 Bodenacidität
- 6 Ionenaustausch
- 7 Bodentypen
- 7.1 Bezeichnungen der Horizontmerkmale
- 7.2 Rohböden / Ah – C Böden
- 7.3 Schwarzerde (Tschermosem)
- 7.4 Braunerde
- 7.5 Parabraunerde / Lessivé
- 7.6 Podsole
- 7.7 Gley
- IV. Hydrogeographie
- 1 Globale Wasserverteilung
- 2 Physikalische und chemische Eigenschaften von Wasser
- 2.1 Aggregatszustände des Wassers
- 2.2 Dichteanomalie des Wassers
- 2.2.1 Süßwasser
- 2.2.2 Salzwasser
- 3 Der Wasserkreislauf
- 4 Die Weltmeere
- 4.1 Allgemeines
- 4.1.1 Salzgehalt
- 4.1.2 Vertikale Schichtung
- 4.2 Meeresströmungen
- 4.2.1 Oberflächenströmung
- 4.2.2 Tiefenströmung und Thermohaline Zirkulation
- 4.3 Produktivität
- 4.4 Regulation des Kohlenstoffkreislaufs
- 5 Seen
- 5.1 Morphologische Gliederung der Seetypen
- 5.2 Seezonierung
- 5.2.1 in Abhängigkeit von Licht
- 5.2.2 in Abhängigkeit von Temperatur
- 5.3 Thermisch bedingte Zirkulation
- 6 Flüsse
- 6.1 Wasserhaushalt von Flüssen
- 6.2 Einzugsgebiet von Flüssen
- 6.3 Typische Entwässerungsnetze
- 6.4 Abfluss
- 6.4.1 Abflussganglinie
- 6.4.2 Abflussregime
- 6.4.3 Einfluss von Form des Einzugsgebiets und Bifurkationsindex
- 6.5 Unterteilung von Flüssen
- 6.5.1 hinsichtlich der Wasserführung im Jahresverlauf
- 6.5.2 hinsichtlich Quellort, Verlauf und Mündung
- 7 Gletscher, Schnee und Eis
- 8 Unterirdische Wasserspeicher und -leiter
- 8.1 Grundwasserbewegung
- 8.2 Grundwasserexfiltration
- 8.3 Grundwasserneubildung
- 9 Atmosphäre und Biosphäre
- V. Vegetationsgeographie
- 1 Systematik
- 2 Fortpflanzung und Ausbreitung
- 3 Arealkunde
- 3.1 Definition Areal und Abgrenzung zu Habitat
- 3.2 Arealbildung
- 3.3 Progressive und regressive Areale
- 3.4 Arealgestalt
- 3.5 Vom Areal zum Florenreich
- 3.5.1 Arealtyp
- 3.5.2 Florenreich
- 4 Vegetationstypen und ihre Klassifizierung
- 4.1 Pflanzenformationen nach Ellenberg & Müller-Dombois (1967)
- 4.2 Lebensformen nach Raunkiaer (1904)
- 4.3 Vegetationszonen der Erde
- Landschaftsformende Prozesse und ihre geologischen Grundlagen
- Das Klimasystem und seine räumliche und zeitliche Variabilität
- Bodenbildungsprozesse und Bodentypen
- Der Wasserkreislauf und seine Bedeutung für die verschiedenen Geosysteme
- Vegetationszonen und deren Abhängigkeit von klimatischen und edaphischen Faktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine Einführung in die Physische Geographie. Die Zielsetzung besteht darin, grundlegende Konzepte und Prozesse der Geomorphologie, Klimatologie, Bodenkunde und Hydrogeographie sowie der Vegetationsgeographie zu erläutern. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Erdsystemen und den daraus resultierenden Landschaftsformen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Geologie / Geomorphologie: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Geomorphologie, indem es Reliefformen, Forschungsansätze und die erdgeschichtliche Zeiteinteilung erläutert. Es beschreibt Minerale und Gesteine, Verwitterungsprozesse, die Plattentektonik, Vulkanismus, Plutonismus und Orogenese. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entstehung und Entwicklung von Landschaftsformen durch endogene und exogene Prozesse gewidmet, inklusive detaillierter Erklärungen zu Massenbewegungen, fluvialen, äolischen, glazialen, periglazialen und litoralen Prozessen sowie Karstlandschaften. Die Gegenüberstellung von Struktur- und Skulpturformen rundet das Kapitel ab.
II. Klimatologie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Klimasystem der Erde, beginnend mit Definitionen und Begriffsklärungen zu Meteorologie und Klimatologie, Wetter, Witterung und Klima. Es untersucht die Atmosphäre, den Strahlungs- und Wärmehaushalt der Erde, inklusive Albedo und Abstrahlung. Die Klimaelemente Lufttemperatur, Wasserdampf und Wolken- und Niederschlagsbildung werden detailliert erklärt, ebenso wie Luftbewegungen, die planetarische Zirkulation, Klimaklassifikation und mesoklimatische Zirkulationssysteme.
III. Bodenkunde: Dieses Kapitel widmet sich der Bodenkunde. Es definiert den Begriff "Boden" und seine ökologischen Funktionen und beschreibt die bodenbildenden Faktoren (Relief, Mensch, Gestein, Klima, Organismen und Zeit). Bodenbildende Prozesse, darunter Transformationsprozesse (Verwitterung, Zersetzung, Humifizierung, Mineralneubildung, Gefügebildung) und Translokationsprozesse (Tonverlagerung, Podsolierung, Salzverlagerung, Turbation) werden ausführlich erläutert. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion über das Bodenvolumen, Bodenacidität, Ionenaustausch und verschiedenen Bodentypen.
IV. Hydrogeographie: Dieses Kapitel befasst sich mit der globalen Wasserverteilung und den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Es beschreibt den Wasserkreislauf, die Weltmeere (Salzgehalt, vertikale Schichtung, Meeresströmungen), Seen (Seezonierung, thermische Zirkulation), Flüsse (Wasserhaushalt, Einzugsgebiet, Abfluss, Abflussregime) und Gletscher, Schnee und Eis als Wasserspeicher. Auch unterirdische Wasserspeicher und -leiter, Grundwasserbewegung, Exfiltration und Neubildung werden beleuchtet.
V. Vegetationsgeographie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Vegetationsgeographie. Es behandelt die Systematik von Pflanzen, deren Fortpflanzung und Ausbreitung, die Arealkunde (Arealbildung, progressive und regressive Areale, Arealgestalt), und den Übergang vom Areal zum Florenreich. Abschließend werden Vegetationstypen und ihre Klassifizierung nach verschiedenen Kriterien diskutiert.
Schlüsselwörter
Physische Geographie, Geomorphologie, Klimatologie, Bodenkunde, Hydrogeographie, Vegetationsgeographie, Landschaftsformen, Klimaelemente, Bodenbildungsprozesse, Wasserkreislauf, Vegetationstypen, Plattentektonik, Vulkanismus, Verwitterung, Gesteine, Minerale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Kompakte Übersicht Physische Geographie"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die Physische Geographie. Er behandelt die wichtigsten Teilgebiete Geomorphologie, Klimatologie, Bodenkunde, Hydrogeographie und Vegetationsgeographie. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Erdsystemen und den daraus resultierenden Landschaftsformen. Der Text beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden in der Geologie/Geomorphologie behandelt?
Das Kapitel "Geologie/Geomorphologie" legt die Grundlagen der Geomorphologie, indem es Reliefformen, Forschungsansätze und die erdgeschichtliche Zeiteinteilung erläutert. Es beschreibt Minerale und Gesteine, Verwitterungsprozesse, die Plattentektonik, Vulkanismus, Plutonismus und Orogenese. Es werden detaillierte Erklärungen zu Massenbewegungen, fluvialen, äolischen, glazialen, periglazialen und litoralen Prozessen sowie Karstlandschaften gegeben. Struktur- und Skulpturformen werden gegenübergestellt.
Was sind die Schwerpunkte der Klimatologie-Sektion?
Die Klimatologie-Sektion befasst sich mit dem Klimasystem der Erde. Es beginnt mit Definitionen und Begriffsklärungen zu Meteorologie und Klimatologie, Wetter, Witterung und Klima. Es werden die Atmosphäre, der Strahlungs- und Wärmehaushalt der Erde (inkl. Albedo und Abstrahlung), die Klimaelemente Lufttemperatur, Wasserdampf und Wolken- und Niederschlagsbildung, Luftbewegungen, die planetarische Zirkulation, Klimaklassifikation und mesoklimatische Zirkulationssysteme behandelt.
Welche Aspekte der Bodenkunde werden behandelt?
Das Kapitel zur Bodenkunde definiert den Begriff "Boden" und seine Funktionen. Es beschreibt die bodenbildenden Faktoren (Relief, Mensch, Gestein, Klima, Organismen, Zeit) und bodenbildende Prozesse wie Transformationsprozesse (Verwitterung, Zersetzung, Humifizierung, Mineralneubildung, Gefügebildung, Verbraunung) und Translokationsprozesse (Tonverlagerung, Podsolierung, Salzverlagerung, Turbation, Oberflächenverlagerung). Das Kapitel behandelt auch Bodenvolumen, Bodenacidität, Ionenaustausch und verschiedene Bodentypen.
Was sind die Inhalte der Hydrogeographie?
Die Hydrogeographie-Sektion behandelt die globale Wasserverteilung und die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Der Wasserkreislauf, die Weltmeere (Salzgehalt, vertikale Schichtung, Meeresströmungen), Seen (Seezonierung, thermische Zirkulation), Flüsse (Wasserhaushalt, Einzugsgebiet, Abfluss, Abflussregime), Gletscher, Schnee und Eis als Wasserspeicher sowie unterirdische Wasserspeicher und -leiter (Grundwasserbewegung, Exfiltration, Neubildung) werden erklärt.
Welche Themen werden in der Vegetationsgeographie behandelt?
Das Kapitel zur Vegetationsgeographie behandelt die Systematik der Pflanzen, ihre Fortpflanzung und Ausbreitung. Die Arealkunde (Arealbildung, progressive und regressive Areale, Arealgestalt) und der Übergang vom Areal zum Florenreich werden erläutert. Schließlich werden Vegetationstypen und deren Klassifizierung nach verschiedenen Kriterien diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Physische Geographie, Geomorphologie, Klimatologie, Bodenkunde, Hydrogeographie, Vegetationsgeographie, Landschaftsformen, Klimaelemente, Bodenbildungsprozesse, Wasserkreislauf, Vegetationstypen, Plattentektonik, Vulkanismus, Verwitterung, Gesteine, Minerale.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text eignet sich als Einführung in die Physische Geographie für Studierende und alle, die sich einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Teilgebiete verschaffen möchten.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist übersichtlich in fünf Hauptkapitel (Geologie/Geomorphologie, Klimatologie, Bodenkunde, Hydrogeographie, Vegetationsgeographie) unterteilt, welche jeweils in Unterkapitel mit detaillierten Erklärungen gegliedert sind. Zusätzlich beinhaltet er ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
- Quote paper
- Martin Eder (Author), 2015, Einführung in die Physische Geographie. Geomorphologie, Klimatologie sowie Boden-, Hydro- und Vegetationsgeographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301717