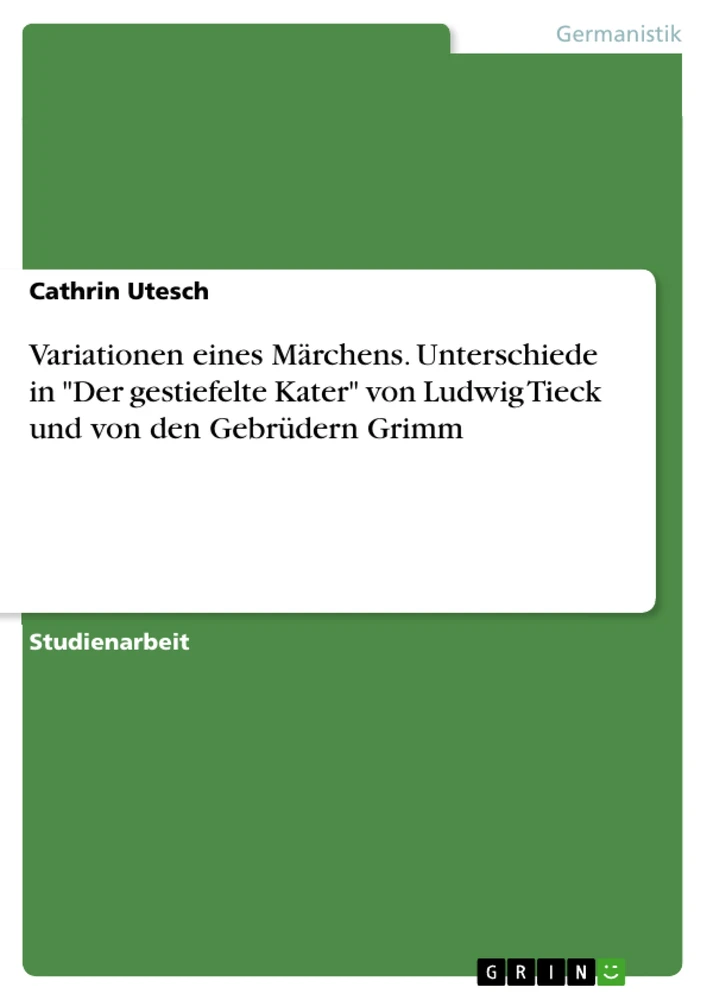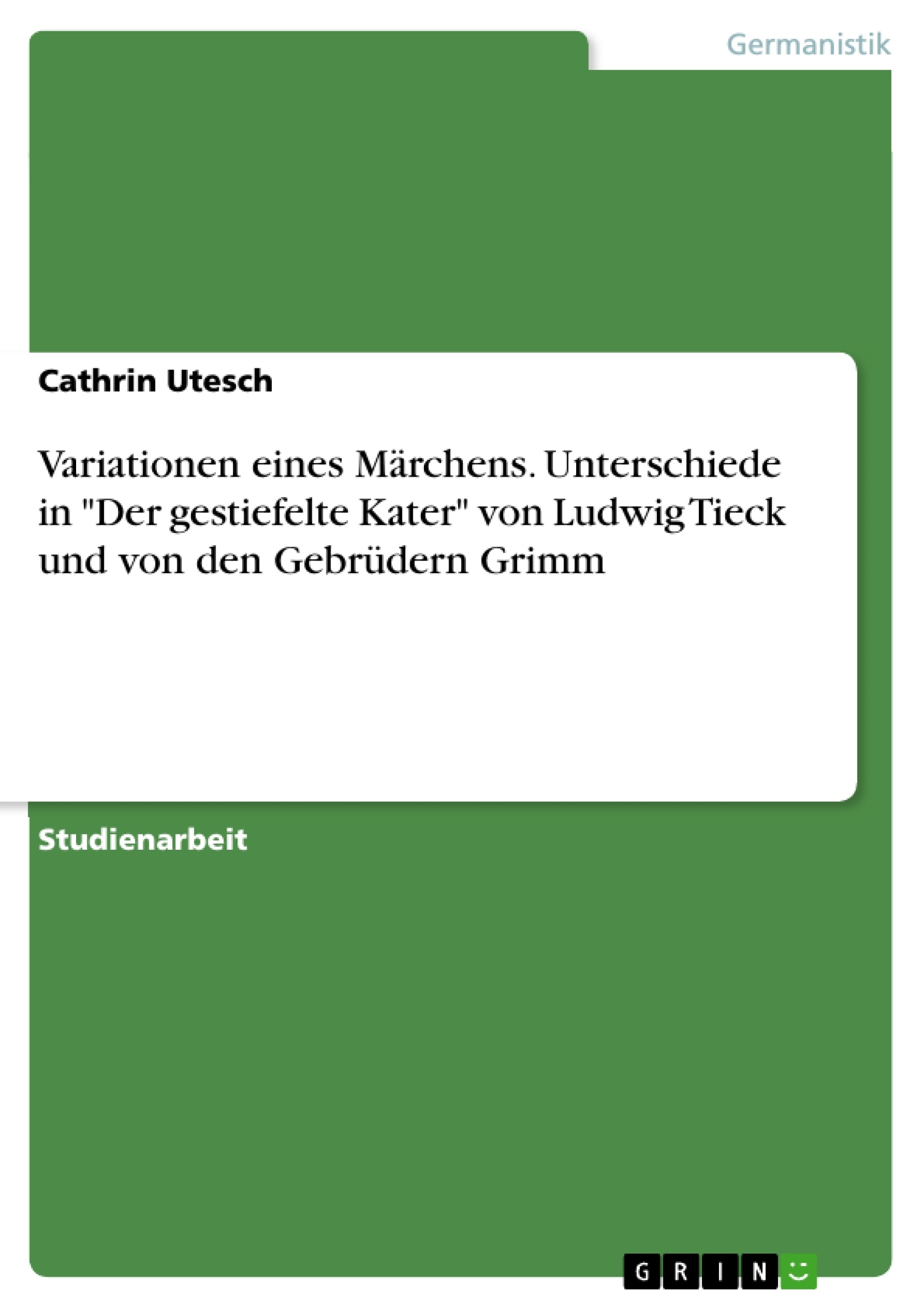Der karnevaleske Titel "Der gestiefelte Kater" verspricht zunächst, ein Katzenmärchen zu sein, das nahezu jeder kennt. Man vermutet dahinter eine kindgerechte Geschichte, die darstellt, wie ein Kater einem armen Müllerssohn zu Reichtum und Ehre verhalf. Doch sollen hier zwei Versionen der beliebten Katzengeschichte untersucht werden: "Der gestiefelte Kater" von Ludwig Tieck, veröffentlicht 1797, und das gleichnamige Kindermärchen der Brüder Grimm, veröffentlicht im Jahre 1812. Beide Märchen entstanden etwa zur gleichen Zeit, tragen denselben Titel, erzählen dieselbe Geschichte und weisen doch bemerkenswerte Unterschiede auf.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Fragen: Inwieweit und warum unterscheiden sich diese zwei Werke also teilweise recht eminent voneinander? Was genau macht Tiecks romantische Ironie aus und wie funktioniert sie? Handelt es sich wirklich, wie Karl Pestalozzi sagt, um eine „Demonstration des Scheiterns der Kommunikation zwischen Dichter und Publikum“? Außerdem sollen die Intentionen der unterschiedlichen Ausgestaltungen des "Katerstoffs" betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyse
- 2.1 Genese der Märchen
- 2.2 Formale Unterschiede
- 2.3 Inhaltliche Unterschiede
- 2.4 Romantische Ironie bei Tieck und sein Publikum
- 2.5 Intentionen der Autoren
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die beiden Märchenversionen „Der gestiefelte Kater“ von Ludwig Tieck und den Brüdern Grimm, die beide im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden. Die Analyse untersucht die Unterschiede zwischen den beiden Werken und die verschiedenen Intentionen der Autoren. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Tiecks romantische Ironie und ihre Funktion im Stück gelegt.
- Genese der Märchen und ihre unterschiedliche Entstehungsgeschichte
- Formale Unterschiede zwischen Tiecks Kunstmärchen und dem Volksmärchen der Brüder Grimm
- Inhaltliche Unterschiede in Bezug auf die Darstellung der Figuren und die Interpretation der Geschichte
- Tiecks romantische Ironie und ihre Bedeutung für die Rezeption des Werkes
- Die Intentionen der Autoren in der Gestaltung des „Gestiefelten Katers“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Versionen des „Gestiefelten Katers“ von Ludwig Tieck und den Brüdern Grimm vor und benennt die zentralen Fragestellungen der Analyse. Kapitel 2 analysiert die Entstehungsgeschichte der beiden Märchen. Die Genese von Tiecks „Gestiefelten Kater“ wird als Kunstmärchen beschrieben, das auf einer französischen Vorlage von Charles Perrault basiert. Die Grimm-Version hingegen entsteht aus mündlicher Überlieferung und wird als Volksmärchen charakterisiert. Kapitel 2.2 untersucht die formalen Unterschiede zwischen den beiden Werken, wobei insbesondere auf die Rahmenhandlung und die ironischen Elemente in Tiecks Stück eingegangen wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: „Der gestiefelte Kater“, Ludwig Tieck, Brüder Grimm, Kunstmärchen, Volksmärchen, Romantische Ironie, Intentionen der Autoren, Genese der Märchen, formale Unterschiede, inhaltliche Unterschiede.
- Citar trabajo
- Cathrin Utesch (Autor), 2013, Variationen eines Märchens. Unterschiede in "Der gestiefelte Kater" von Ludwig Tieck und von den Gebrüdern Grimm, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301563