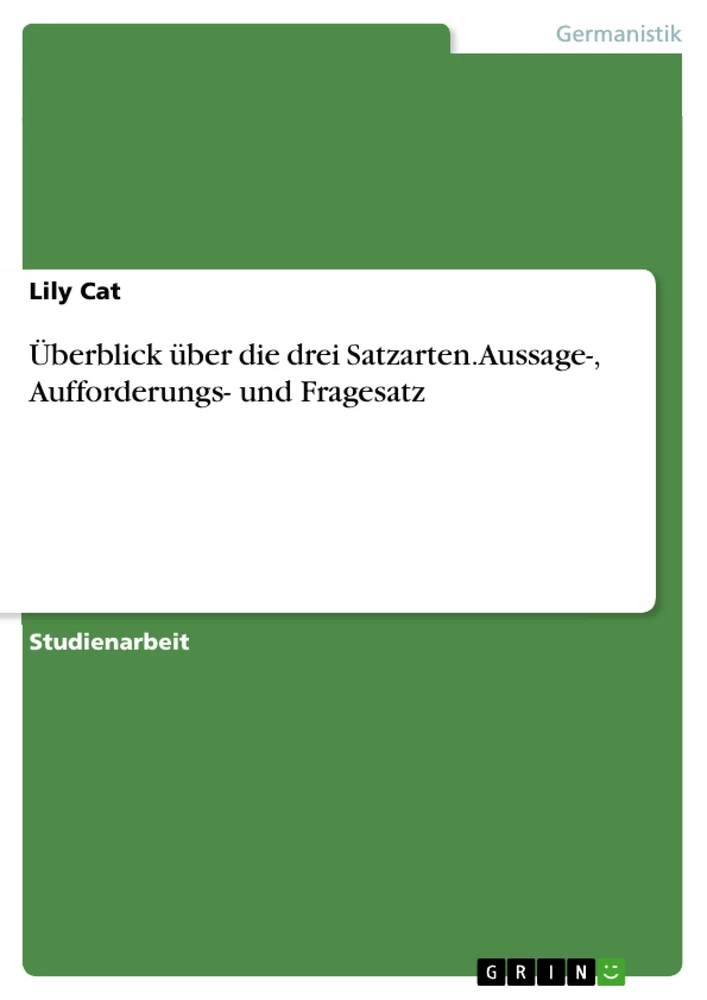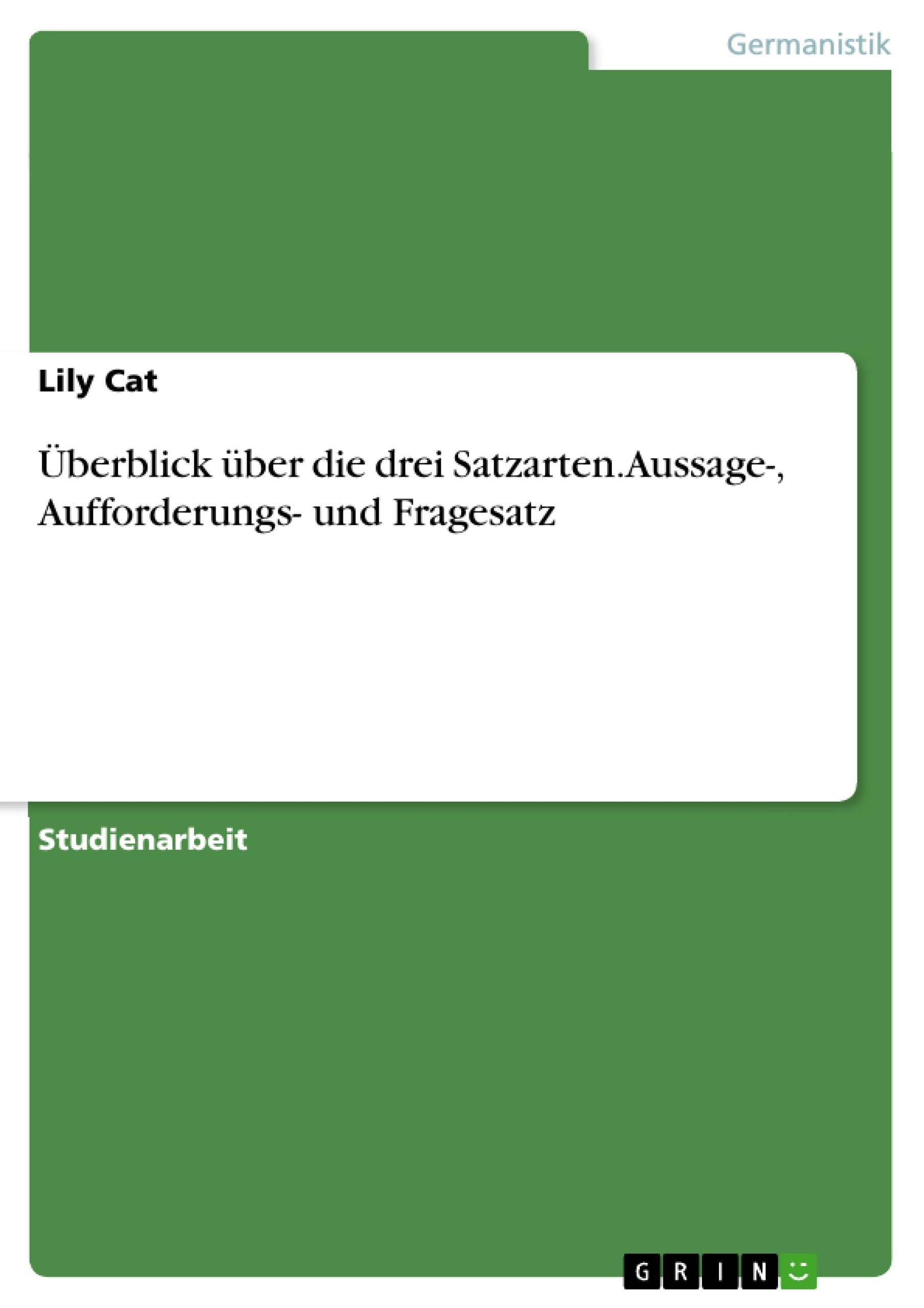In dieser wissenschaftlichen Arbeit werden die drei Satzarten Aussage-, Aufforderungs- und Fragesatz genauer untersucht, auch einige Arten, die nicht zur traditionellen Satzlehre gehören, werden hierbei genannt. Manche Grammatiken zählen noch Wunsch- und Ausrufesatz zu den Grundarten dazu, diese werden in dieser Seminararbeit nur kurz definiert, für die weitere Bearbeitung jedoch nicht berücksichtigt.
Zunächst werden die einzelnen Funktionen und die Kriterien genannt. Dabei werden auch die Schwierigkeiten der Definitionen herausgearbeitet, es wird erkennbar, dass die scheinbar eindeutigen Merkmale Grenzen besitzen. Im Folgenden wird auf Alternativen zu den drei Satzarten eingegangen, wobei diese andere Definitionen und Kriterien benutzen, eine Alternative stützt sich auf die Form, die andere auf die Funktion und eine weitere Lösung gliedert Sätze nach den dazugehörigen Satzzeichen.
Es sollen auch die Vor- und Nachteile der Ausweichmöglichkeiten behandelt werden. Im Schlussteil werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Alternativen beurteilt. Als Literatur dienten hier das Werk „Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten“ von Matthias Granzow-Emden und das gemeinsame Buch „Grammatik der deutschen Sprache“ von Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann und Bruno Strecker. Auch „Handbuch der deutschen Grammatik“, geschrieben von Harald Weydt und Elke Hentschel, und „Konzepte der Satzkonnexion“ von Angelika Wöllstein dienten als Hilfsmittel für das Verständnis von den Satzarten. Besonders wurde das Werk „Satz, Satzarten, Satzglieder“ von Kjell-Åke Forsgren genutzt. Grundliteratur war das von Peter Eisenberg verfasste Werk „Der Satz – Grundriss der deutschen Grammatik“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Drei Satzarten
- Der Aussagesatz
- Der Fragesatz
- Entscheidungsfrage
- W-Frage
- Aufforderungssatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die drei traditionellen Satzarten (Aussage-, Frage- und Aufforderungssatz) im Deutschen und beleuchtet alternative Klassifikationsansätze. Die Arbeit analysiert die Kriterien zur Definition der Satzarten und deren Grenzen, bewertet die Vor- und Nachteile verschiedener Klassifizierungssysteme, und fasst die Ergebnisse zusammen.
- Definition und Kriterien der drei traditionellen Satzarten
- Schwierigkeiten bei der Definition von Satzarten
- Alternative Klassifikationsansätze für Satzarten
- Bewertung der Vor- und Nachteile verschiedener Klassifikationen
- Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: eine detaillierte Untersuchung der drei Haupttypen deutscher Sätze – Aussagesätze, Fragesätze und Aufforderungssätze – sowie einer Betrachtung von weniger etablierten Satztypen. Es werden die Schwierigkeiten bei der Definition dieser Satzarten und die Grenzen ihrer scheinbar klaren Merkmale angesprochen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit alternativen Klassifikationsmethoden und deren Vor- und Nachteile befasst, und kündigt eine abschließende Bewertung an. Die Einleitung verweist auf die verwendete Literatur, welche eine Vielzahl an Werken zur deutschen Grammatik umfasst.
Die Drei Satzarten: Dieses Kapitel legt die Grundlage, indem es die drei grundlegenden Satzarten im Deutschen einführt: Aussagesatz, Fragesatz und Aufforderungssatz. Es betont ihre kommunikative Funktion und die grammatikalischen Merkmale (Subjekt, Prädikat, Objekt etc.), die ihre Unterscheidung ermöglichen. Die Ausführungen betonen die Notwendigkeit von intuitiven Sprachkenntnissen sowohl beim Sprecher als auch beim Hörer für ein korrektes Verständnis der jeweiligen Satzart. Das Kapitel dient als Orientierungshilfe für den täglichen Sprachgebrauch und legt den Grundstein für die tiefergehende Analyse der einzelnen Satzarten in den folgenden Kapiteln.
Der Aussagesatz: Das Kapitel konzentriert sich auf den Aussagesatz und seine charakteristischen Merkmale. Es erklärt die typische Satzstellung und die Verwendung von Partikeln und Adverbien. Besondere Aufmerksamkeit wird den Ausnahmen gewidmet, in denen das finite Verb an erster Stelle steht, wie in informellen Kontexten oder in Titeln. Das Kapitel analysiert die Funktion des Aussagesatzes als Werkzeug zur Beschreibung von Sachverhalten und Ereignissen und zeigt seine weitverbreitete Verwendung, auch in Antworten auf Fragesätze. Die Diskussion der Betonungsmuster rundet die umfassende Beschreibung des Aussagesatzes ab.
Der Fragesatz: Dieses Kapitel differenziert zwischen Entscheidungs- und W-Fragen, indem es ihre jeweiligen Funktionen und formalen Merkmale untersucht. Entscheidungsfragen erwarten eine einfache Ja-/Nein-Antwort und weisen eine steigende Intonation auf. Im Gegensatz dazu verwenden W-Fragen Interrogativpronomen oder -adverbien und erfordern eine detailliertere Antwort. Das Kapitel erörtert verschiedene Untertypen von Entscheidungs- und W-Fragen, wie z.B. Prüfungsfragen und Echofragen, und hebt die Unterschiede in ihrer Intonation und Satzstruktur hervor. Die Analyse unterstreicht die Bedeutung des Kontextes für das Verständnis der Fragesätze.
Aufforderungssatz: Der Fokus liegt auf dem Aufforderungssatz und seiner Funktion, Handlungen beim Adressaten hervorzurufen. Das Kapitel erläutert die verschiedenen Ausdrucksformen von Aufforderungen (Befehle, Bitten, Ratschläge, Vorschläge) und die Verwendung von Partikeln zur Verstärkung der Wirkung. Im Gegensatz zu den anderen Satzarten wird hier die Rolle des Imperativs und die spezifischen grammatikalischen Merkmale des Aufforderungssatzes hervorgehoben. Die Bedeutung der kommunikativen Absicht des Sprechers steht im Zentrum der Ausführungen.
Schlüsselwörter
Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Satzarten, Satzlehre, Grammatik, deutsche Sprache, Satzstellung, kommunikative Funktion, Intonation, Alternative Klassifikationen, Satzzeichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsche Satzarten
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die drei traditionellen Satzarten im Deutschen: Aussagesatz, Fragesatz und Aufforderungssatz. Sie analysiert deren Definitionen, Kriterien und Grenzen, bewertet alternative Klassifizierungssysteme und fasst die Ergebnisse zusammen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den drei Satzarten mit detaillierten Beschreibungen und Beispielen, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Satzarten werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die drei grundlegenden Satzarten: Aussagesatz, Fragesatz und Aufforderungssatz. Innerhalb des Kapitels "Fragesatz" wird weiter zwischen Entscheidungsfragen und W-Fragen unterschieden.
Wie werden die Satzarten definiert und unterschieden?
Die Arbeit beschreibt die Definition und die Unterscheidungsmerkmale jeder Satzart anhand grammatikalischer Kriterien wie Satzstellung, Verwendung von Partikeln und Adverbien, Intonation und kommunikativer Funktion. Sie betont auch die Bedeutung des Kontextes und der intuitiven Sprachkenntnisse für das Verständnis.
Gibt es alternative Klassifikationsansätze für Satzarten?
Ja, die Arbeit erwähnt und bewertet alternative Klassifizierungssysteme für Satzarten, ohne jedoch spezifische Alternativen im Detail darzustellen. Der Fokus liegt auf der traditionellen Dreiteilung.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Definition von Satzarten?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Definition von Satzarten und die Grenzen ihrer scheinbar klaren Merkmale. Ausnahmen und Grenzfälle werden angesprochen, z.B. die Satzstellung im Aussagesatz.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist eine detaillierte Untersuchung der drei Haupttypen deutscher Sätze und eine Betrachtung der Schwierigkeiten bei deren Definition und Klassifizierung. Die Arbeit bewertet die Vor- und Nachteile verschiedener Klassifizierungssysteme.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Satzarten, Satzlehre, Grammatik, deutsche Sprache, Satzstellung, kommunikative Funktion, Intonation, Alternative Klassifikationen, Satzzeichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in eine Einleitung, Kapitel zu den drei Satzarten (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz), eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Das Kapitel zu den Fragesätzen unterteilt sich in Entscheidungsfragen und W-Fragen.
Welche Aspekte des Aussagesatzes werden behandelt?
Das Kapitel zum Aussagesatz behandelt die typische Satzstellung, die Verwendung von Partikeln und Adverbien, Ausnahmen von der Satzstellung und die Funktion des Aussagesatzes als Werkzeug zur Beschreibung von Sachverhalten und Ereignissen.
Welche Aspekte des Fragesatzes werden behandelt?
Das Kapitel zum Fragesatz unterscheidet zwischen Entscheidungsfragen und W-Fragen, untersucht deren Funktionen und formalen Merkmale, erörtert Untertypen wie Prüfungsfragen und Echofragen, und hebt die Unterschiede in Intonation und Satzstruktur hervor.
Welche Aspekte des Aufforderungssatzes werden behandelt?
Das Kapitel zum Aufforderungssatz erläutert verschiedene Ausdrucksformen von Aufforderungen (Befehle, Bitten, Ratschläge, Vorschläge), die Verwendung von Partikeln und die Rolle des Imperativs.
- Quote paper
- Lily Cat (Author), 2012, Überblick über die drei Satzarten. Aussage-, Aufforderungs- und Fragesatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301440