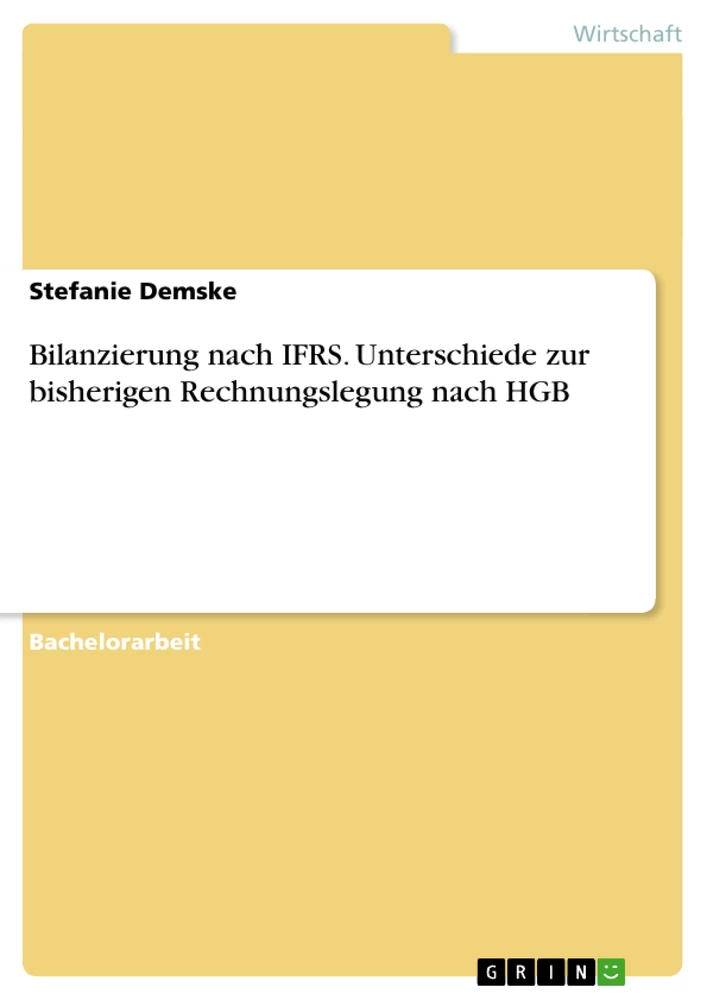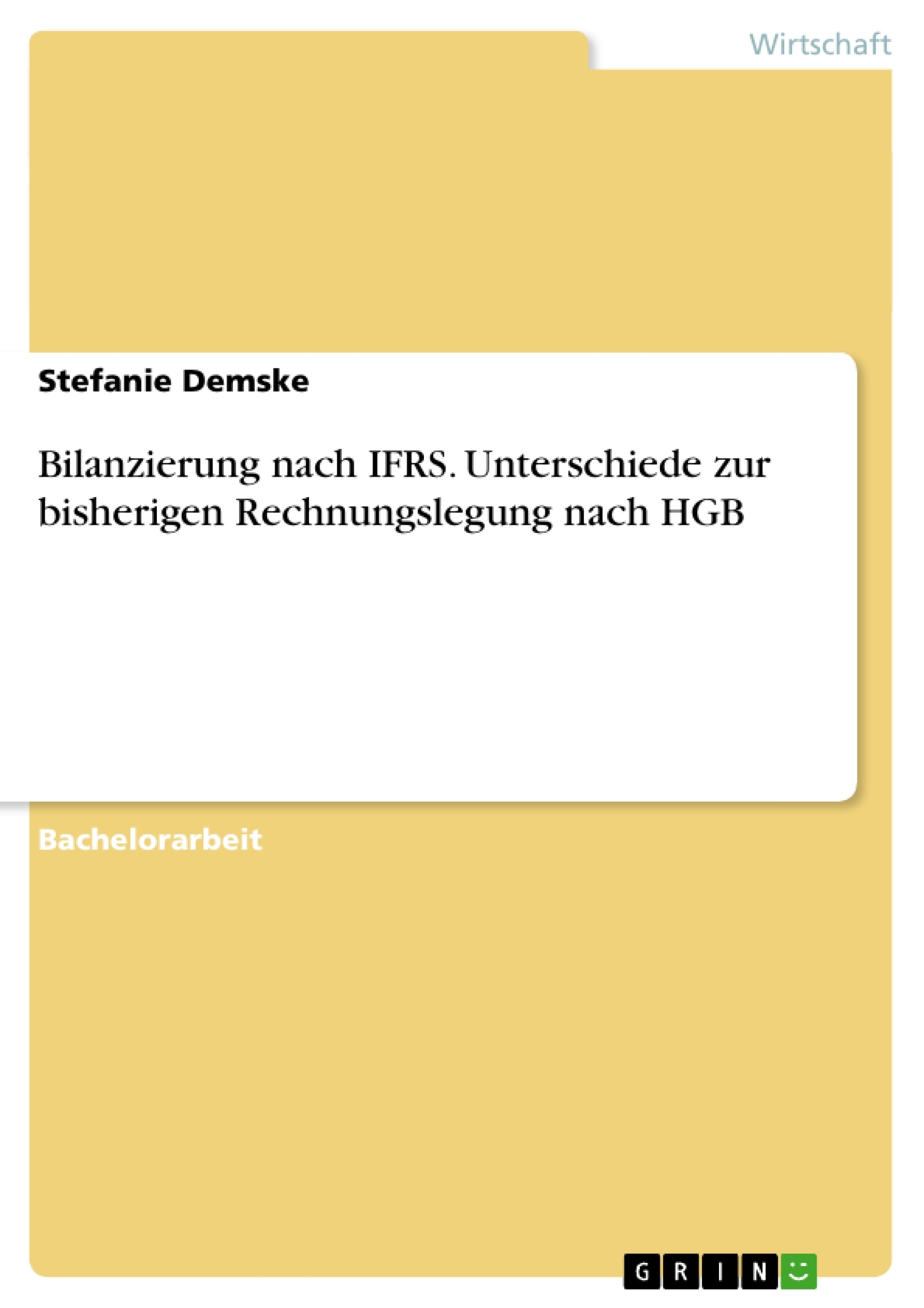Die Entwicklung der Wirtschaft ging im Laufe der vergangenen Jahre oder auch Jahrzehnte immer mehr in Richtung Globalisierung. So haben viele Unternehmen Teile ihrer Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagert. Gerade vor der EU - Osterweiterung zum 1. Mai 2004 ist diese Problematik wieder sehr aktuell geworden. Und sie wird in Zukunft auch immer an Aktualität gewinnen. Oftmals gründen Unternehmen, die in Deutschland produzieren, aus verkaufstaktischen Gründen sowie steuerlichen und rechtlichen Aspekten Tochterunternehmen im Ausland, die allein für den Vertrieb zuständig sind.
So kann es sein, dass ein deutsches Unternehmen in Ungarn und Polen produzieren lässt und in drei seiner Hauptabnehmerländer Tochtergesellschaften zum Vertrieb aufbaut. So ist ein deutscher Konzern mit fünf Tochtergesellschaften entstanden. Jede der fünf Niederlassungen berichtet nun nach ihren nationalen Rechnungslegungsstandards an die Muttergesellschaft in Deutschland, die selber nach dem deutschen Recht bilanziert. Somit wird das Konzernreporting schnell unübersichtlich, ineffizient und teuer. Darüber hinaus benötigt das Unternehmen mehr Zeit, um auf eventuelle Fehlentwicklungen reagieren zu können. Mit dieser Entwicklung der Globalisierung hat sich auch die internationale Rechnungslegung entwickelt. In den letzten Jahren ist dieser Prozess als regelrecht rasant zu bezeichnen. Den bisherigen Höhepunkt erlebten die International Financial Reporting Standards (IFRS) mit der EG Verordnung im Jahre 2002, in der festgelegt wurde, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen in der EU ab 2005 Konzernabschlüsse nur noch nach IFRS aufstellen müssen.
Die folgende Arbeit stellt die Bilanzierung nach IFRS der bisherigen deutschen Bilanzierung entsprechend dem deutschen Rechnungslegungsstandard nach dem HGB gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zusammensetzung des IASC und Verbreitung der IFRS
- 2.1. Organisation des IASC
- 2.1.1. IASB
- 2.1.2. Trustees
- 2.1.3. IFRIC
- 2.1.4. Advisory Committees
- 2.2. Verbreitung und Anwendung der IFRS
- 2.1. Organisation des IASC
- 3. Systematik der IFRS
- 3.1. Vorwort (Preface)
- 3.2. Rahmenkonzept (Framework)
- 3.3. Standards
- 3.4. Interpretationen des IFRIC
- 4. Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen
- 4.1. Bewertungsgrundlagen
- 4.1.1. Anschaffungskosten
- 4.1.2. Herstellungskosten
- 4.2. Bilanzgliederung
- 4.3. Anlagevermögen
- 4.3.1. Sachanlagen
- 4.3.2. Immaterielle Vermögensgegenstände
- 4.4. Vorräte
- 4.5. Rückstellungen
- 4.5.1. Überblick
- 4.5.2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 4.5.3. Steuerrückstellungen
- 4.5.4. Sonstige Rückstellungen
- 4.1. Bewertungsgrundlagen
- 5. Spezialthemen
- 5.1. Leasing
- 5.2. Latente Steuern
- 6. Ergebnis der Gegenüberstellung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Unterschiede zwischen der Bilanzierung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) und den bisherigen Regelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Bilanzierungsmethoden und deren Auswirkungen zu vermitteln.
- Vergleich der Bewertungsmethoden nach IFRS und HGB
- Analyse der Bilanzgliederung nach IFRS und HGB
- Untersuchung der Bilanzierung spezifischer Bilanzpositionen (z.B. Anlagevermögen, Vorräte, Rückstellungen)
- Behandlung von Spezialthemen wie Leasing und latente Steuern
- Aufzeigen der praktischen Unterschiede und Implikationen für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Vergleichs zwischen IFRS und HGB für Unternehmen. Sie umreißt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
2. Zusammensetzung des IASC und Verbreitung der IFRS: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur des International Accounting Standards Committee (IASC) und die Verbreitung der International Financial Reporting Standards (IFRS). Es beleuchtet die Organisation des IASC, einschließlich IASB, Trustees, IFRIC und Advisory Committees, sowie die internationale Anwendung der IFRS.
3. Systematik der IFRS: Das Kapitel erläutert die systematische Struktur der IFRS, bestehend aus Vorwort, Rahmenkonzept, Standards und Interpretationen des IFRIC. Es liefert einen Überblick über die hierarchische Ordnung und die Bedeutung der einzelnen Bestandteile für die Anwendung der IFRS.
4. Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und vergleicht die Ansatz- und Bewertungsmethoden verschiedener Bilanzpositionen nach IFRS und HGB. Es behandelt detailliert die Bewertungsgrundlagen (Anschaffungskosten, Herstellungskosten), die Bilanzgliederung, das Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände), Vorräte und Rückstellungen (einschließlich Pensionen, Steuern und sonstige Rückstellungen). Jedes Unterkapitel stellt die jeweiligen Regelungen nach HGB und IFRS gegenüber und hebt die zentralen Unterschiede hervor, beispielsweise in Bezug auf die Wahl der Bewertungsmethoden und deren Auswirkungen auf die Bilanz.
5. Spezialthemen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf spezifische Bilanzierungsthemen, die besondere Herausforderungen für Unternehmen darstellen. Es vergleicht die Behandlung von Leasingverträgen und latenten Steuern nach IFRS und HGB. Die Analyse umfasst verschiedene Leasingarten und die zugehörigen Bilanzierungsmethoden, sowie die Berücksichtigung latenter Steuern in der Bilanz.
Schlüsselwörter
IFRS, HGB, Bilanzierung, Bewertung, Anlagevermögen, Vorräte, Rückstellungen, Leasing, latente Steuern, Rechnungslegung, International Accounting Standards, Handelsgesetzbuch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Vergleich IFRS und HGB
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit vergleicht die Bilanzierung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Sie untersucht die Unterschiede in den Bewertungsmethoden, der Bilanzgliederung und der Behandlung spezifischer Bilanzpositionen wie Anlagevermögen, Vorräte und Rückstellungen. Besondere Schwerpunkte sind Leasing und latente Steuern. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Bilanzierungsmethoden und deren Auswirkungen zu vermitteln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Zusammensetzung des IASC und Verbreitung der IFRS, Systematik der IFRS (Rahmenkonzept, Standards, Interpretationen), Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen (inkl. Bewertungsgrundlagen, Bilanzgliederung, Anlagevermögen, Vorräte, Rückstellungen), sowie Spezialthemen wie Leasing und latente Steuern. Ein Vergleich der IFRS- und HGB-Regelungen bildet den Kern der Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Zusammensetzung des IASC und Verbreitung der IFRS, Systematik der IFRS, Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen, Spezialthemen (Leasing und latente Steuern) und Ergebnis der Gegenüberstellung und Ausblick. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche Bilanzpositionen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Bilanzierung von Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände), Vorräten und Rückstellungen (inkl. Pensionen, Steuern und sonstige Rückstellungen) nach IFRS und HGB und vergleicht die jeweiligen Bewertungsmethoden.
Welche Spezialthemen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Spezialthemen Leasing (inkl. verschiedener Leasingarten und Bilanzierungsmethoden) und latente Steuern, und vergleicht deren Behandlung nach IFRS und HGB.
Welche Bewertungsgrundlagen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Bewertungsgrundlagen Anschaffungskosten und Herstellungskosten nach IFRS und HGB.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Unterschiede zwischen der Bilanzierung nach IFRS und HGB zu vermitteln und die praktischen Implikationen für Unternehmen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: IFRS, HGB, Bilanzierung, Bewertung, Anlagevermögen, Vorräte, Rückstellungen, Leasing, latente Steuern, Rechnungslegung, International Accounting Standards, Handelsgesetzbuch.
Wo finde ich weitere Informationen über IFRS und HGB?
Die Arbeit liefert einen Überblick über IFRS und HGB. Für detailliertere Informationen wird auf die entsprechenden Fachliteratur und Regelwerke verwiesen (implizit durch die detaillierte Darstellung der Themen).
- Quote paper
- Stefanie Demske (Author), 2004, Bilanzierung nach IFRS. Unterschiede zur bisherigen Rechnungslegung nach HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30139