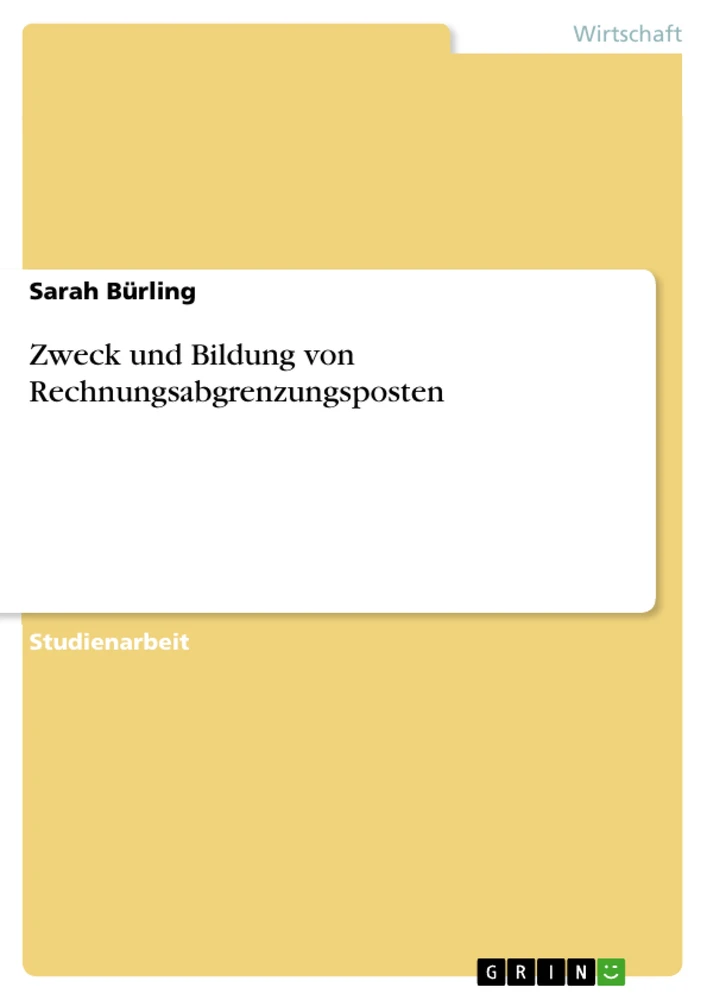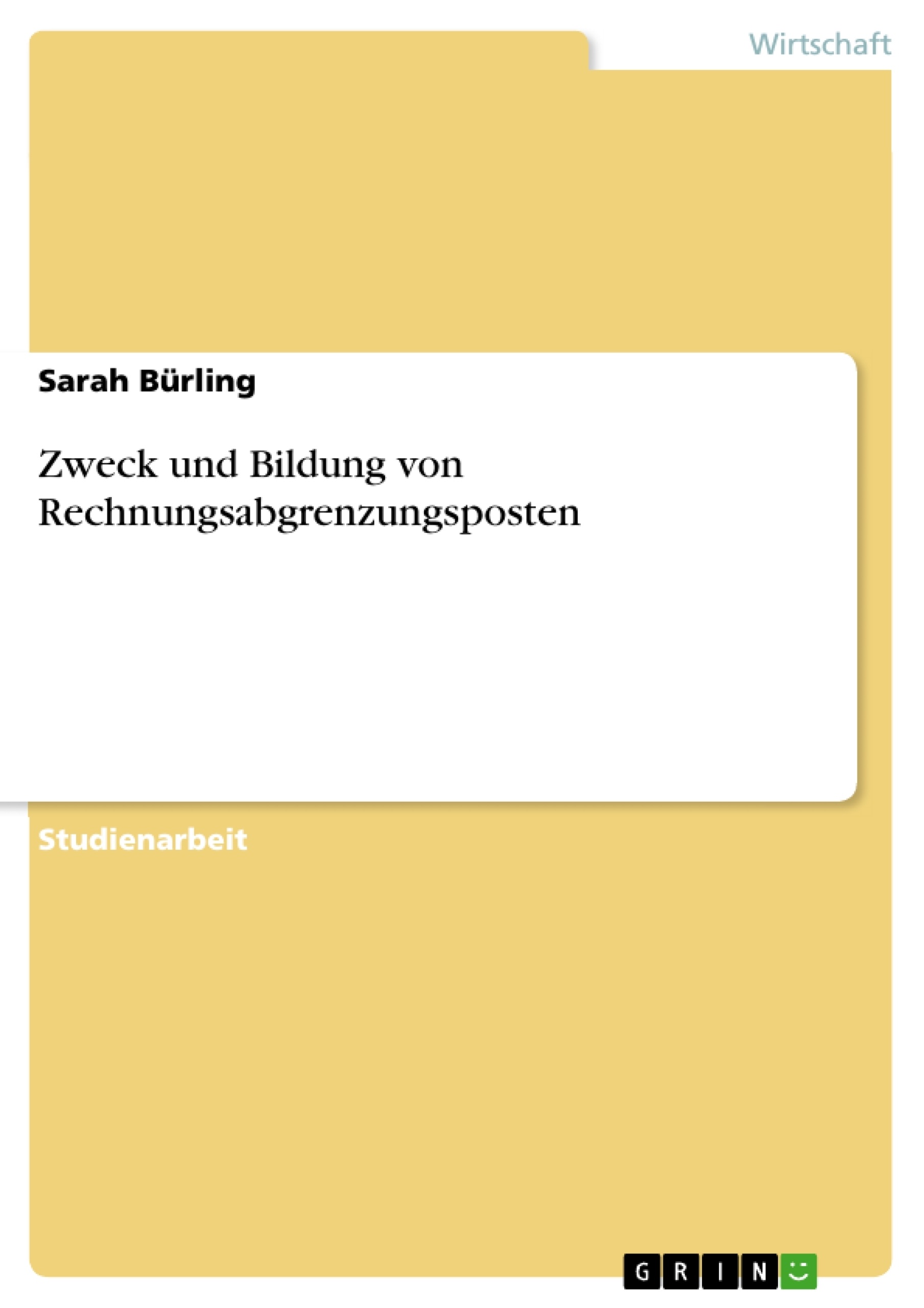Im Rahmen dieser Seminararbeit werden Zweck und Bildung von RAP vorgestellt und dessen Funktion erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den verschiedenen Ansatzkriterien der RAP laut HGB und IFRS. Darauf aufbauend wird anhand von Bilanzen veranschaulicht, wie sich die RAP laut den vorliegenden Regelwerken auswirken und welche Bedeutung sie in der jeweiligen Bilanzierungsform (HGB / IFRS) haben.
Laut dem Handelsgesetzbuch ist prinzipiell jeder Kaufmann dazu verpflichtet, jährlich einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und GuV, zu erstellen. Gem. § 241a HGB werden Ausnahmen für Einzelhandelskaufleute gebildet.
Die Rechnungslegungsziele des handelsrechtlichen Jahresabschlusses sind erstrangig auf die Interessen der Gläubiger ausgelegt. Dieses sind insbesondere die Informationsfunktion, die Steuerbemessungsfunktion und die Regelung der Ausschüttungsbemessung. Aufgrund der wachsenden Globalisierung der kapitalmarktorientierten Unternehmen gewinnen die internationalen Rechnungslegungsstandards zunehmend an Bedeutung. Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften der IFRS aufzustellen. Das hauptsächliche Rechnungslegungsziel des Abschlusses nach den IFRS-Vorschriften ist die Vermittlung von Informationen für mögliche Investoren.
Somit ist jeder, der dazu verpflichtet ist einen Jahresabschluss aufzustellen, in der Pflicht diesen periodengerecht zu ermitteln und die Regelvorschriften der RAP zu beachten. RAP sind für die periodengerechte Erfolgsermittlung von besonderer Bedeutung, da sie die Aufwendungen und Erträge in die jeweiligen Geschäftsjahre zuordnen und somit einen periodengerechten Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gewähren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Begriff
- 2.1. Allgemeine Definition
- 2.2. Arten der Rechnungsabgrenzung
- 2.2.1. Antizipative Rechnungsabgrenzungsposten
- 2.2.2. Transitorische Rechnungsabgrenzungsposten
- 3. Rechnungsabgrenzungsposten nach HGB
- 3.1. Ansatz
- 3.2. Voraussetzungen
- 3.2.1. Ausgaben und Einnahmen vor dem Abschlussstichtag
- 3.2.2. Aufwand und Ertrag nach dem Abschlussstichtag
- 3.2.3. Bestimmte Zeit
- 3.3. Ausweis in der Bilanz
- 3.4. Auflösung
- 4. Rechnungsabgrenzungsposten nach IFRS
- 4.1. Ansatz
- 4.2. Voraussetzungen
- 4.2.1. Kriterien abstrakter Bilanzierungsfähigkeit
- 4.2.2. Kriterien konkreter Bilanzierungsfähigkeit
- 4.3. Ausweis in der Bilanz
- 5. Handhabung der RAP im Unternehmen anhand praktischer Beispiele
- 5.1. Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- 5.1.1. Jahresabschluss nach HGB
- 5.1.2. Konzernabschluss nach IFRS
- 5.2. BMW AG (Konzernabschluss nach IFRS)
- 5.3. Siemens AG (Jahresabschluss nach HGB)
- 5.1. Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- 6. Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Zweck und Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) im Kontext des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in den Ansatzkriterien und der Auswirkung auf die Bilanzierung unter HGB und IFRS. Anhand praktischer Beispiele aus der Unternehmenslandschaft wird die Anwendung der RAP veranschaulicht.
- Periodengerechte Erfolgsermittlung durch RAP
- Unterschiedliche Ansatzkriterien von RAP nach HGB und IFRS
- Auswirkung von RAP auf die Bilanz
- Praktische Anwendung von RAP in Unternehmen
- Vergleich der Bilanzierung unter HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) ein und betont deren Bedeutung für die periodengerechte Erfolgsermittlung. Es hebt die Unterschiede in den Rechnungslegungszielen des HGB (gläubigerorientiert) und der IFRS (investororientiert) hervor und begründet die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der RAP unter beiden Regelwerken. Die Arbeit kündigt die Fokussierung auf die Ansatzkriterien und die praktische Anwendung der RAP an.
2. Begriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Rechnungsabgrenzungspostens und seine Funktion bei der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Es differenziert zwischen antizipativen und transitorischen RAP, erläutert die jeweiligen Charakteristika und gibt Beispiele für aktive und passive Posten beider Arten. Die Unterscheidung verdeutlicht die Komplexität der RAP und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bilanzierung.
3. Rechnungsabgrenzungsposten nach HGB: Dieses Kapitel beschreibt die Vorschriften des HGB bezüglich des Ansatzes, der Voraussetzungen und des Ausweises von RAP in der Bilanz. Es analysiert die Kriterien für die Bildung von RAP, betont die Bedeutung der zeitlichen Zuordnung von Aufwand und Ertrag und erläutert die Auflösung der RAP. Die Diskussion der HGB-Regularien legt den Grundstein für den späteren Vergleich mit den IFRS-Vorschriften.
4. Rechnungsabgrenzungsposten nach IFRS: Dieses Kapitel widmet sich den IFRS-Vorschriften für RAP, untersucht die Kriterien der Bilanzierungsfähigkeit (abstrakt und konkret) und erklärt den Ausweis in der Bilanz. Der Vergleich mit den HGB-Regeln verdeutlicht die Unterschiede in der Anwendung und Interpretation der RAP unter internationaler und nationaler Rechnungslegung. Die detaillierte Darstellung der IFRS-Kriterien ermöglicht ein umfassendes Verständnis der internationalen Rechnungslegungspraxis.
5. Handhabung der RAP im Unternehmen anhand praktischer Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von verschiedenen Unternehmen (Borussia Dortmund, BMW, Siemens), um die praktische Anwendung von RAP unter HGB und IFRS zu verdeutlichen. Die Analyse der Jahresabschlüsse zeigt, wie Unternehmen die RAP in der Praxis handhaben und welche Auswirkungen dies auf die Bilanz hat. Die konkrete Anwendung der theoretischen Konzepte macht die Thematik greifbarer.
Schlüsselwörter
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), periodengerechte Erfolgsermittlung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), antizipative RAP, transitorische RAP, aktive RAP, passive RAP, Ansatzkriterien, Bilanzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Rechnungsabgrenzungsposten nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Rechnungsabgrenzungsposten (RAP). Sie untersucht deren Zweck und Bildung im Kontext des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der International Financial Reporting Standards (IFRS), beleuchtet die Unterschiede in den Ansatzkriterien und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung unter beiden Regelwerken und veranschaulicht die Anwendung anhand praktischer Beispiele.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: periodengerechte Erfolgsermittlung durch RAP, unterschiedliche Ansatzkriterien von RAP nach HGB und IFRS, Auswirkungen von RAP auf die Bilanz, praktische Anwendung von RAP in Unternehmen und einen Vergleich der Bilanzierung unter HGB und IFRS. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der Problemstellung, der Definition von RAP (inklusive antizipativer und transitorischer RAP), der Behandlung von RAP nach HGB (Ansatz, Voraussetzungen, Ausweis und Auflösung), der Behandlung von RAP nach IFRS (Ansatz, Voraussetzungen und Ausweis) sowie der praktischen Anwendung anhand von Fallstudien (Borussia Dortmund, BMW, Siemens).
Was sind Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)?
Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Sie ermöglichen es, den Erfolg eines Geschäftsjahres korrekt abzubilden, auch wenn die Zahlung oder der Erhalt von Leistungen zeitlich vom Geschäftsjahr abweicht. Die Arbeit unterscheidet zwischen antizipativen (vorausschauend) und transitorischen (überleitend) RAP.
Wie unterscheiden sich RAP nach HGB und IFRS?
Die Seminararbeit vergleicht die Ansatzkriterien und die Ausweisung von RAP nach HGB und IFRS. Es werden die Unterschiede in den jeweiligen Vorschriften und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung herausgearbeitet. Während das HGB einen gläubigerorientierten Ansatz verfolgt, sind die IFRS eher investororientiert. Dies führt zu unterschiedlichen Anforderungen an die Bildung und Ausweisung von RAP.
Welche praktischen Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die Handhabung von RAP anhand von Fallstudien dreier Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (Jahresabschluss nach HGB und Konzernabschluss nach IFRS), BMW AG (Konzernabschluss nach IFRS) und Siemens AG (Jahresabschluss nach HGB). Dies veranschaulicht die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Problemstellung, Begriffsbestimmung (inkl. Unterteilung in antizipative und transitorische RAP), RAP nach HGB (Ansatz, Voraussetzungen, Ausweis, Auflösung), RAP nach IFRS (Ansatz, Voraussetzungen, Ausweis), Praktische Beispiele (Borussia Dortmund, BMW, Siemens) und eine thesenförmige Zusammenfassung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), periodengerechte Erfolgsermittlung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), antizipative RAP, transitorische RAP, aktive RAP, passive RAP, Ansatzkriterien, Bilanzierung.
- Quote paper
- Sarah Bürling (Author), 2014, Zweck und Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301057