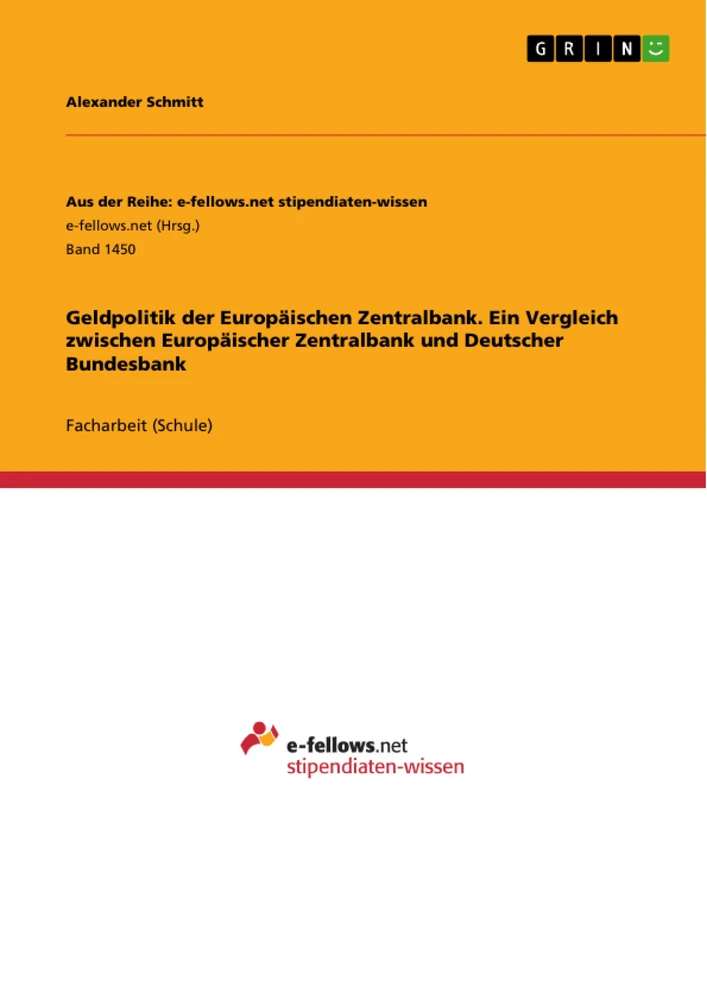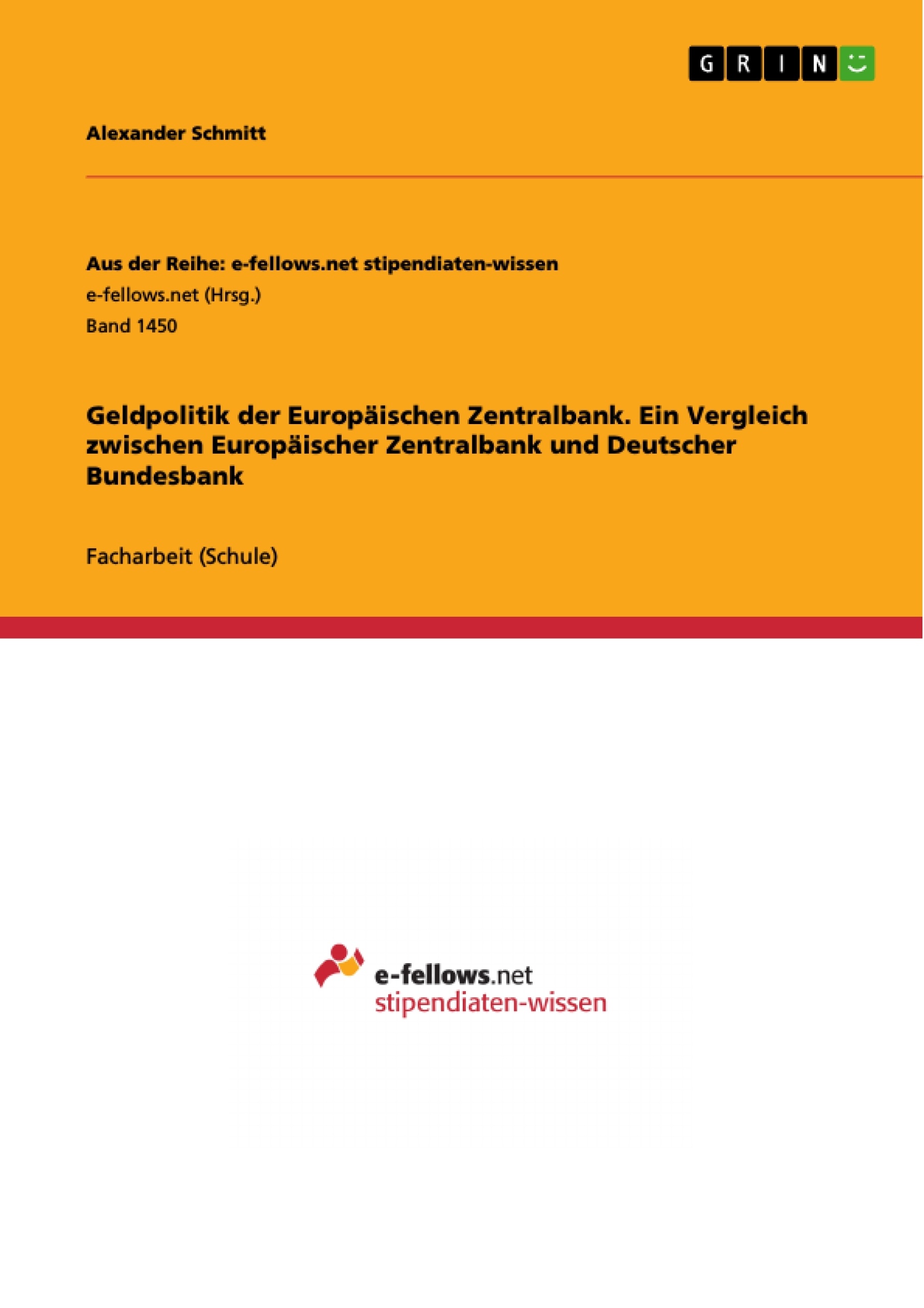Die Deutsche Bundesbank hatte vor der Einführung des Euros als Buchgeld am 1. Januar 1999 und dem Kompetenzverlust durch den Vertrag über die Europäische Union (1993) die geldpolitischen Befugnisse in Deutschland inne. Die nationale Zentralbank Deutschlands war aufgrund ihrer geldpolitischen Aufgaben und Funktionen eine der bedeutendsten Institutionen für die deutsche Wirtschaft. So trug sie, unter anderem durch ihre strenge Geldpolitik, zur starken deutschen Wirtschaft bei. Aufgrund der führenden Position Deutschlands in Europa, auch als damaliger Exportweltmeister, nahm die Deutsche Bundesbank sogar Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Deswegen spielte sie eine bedeutende Rolle in der internationalen Wirtschaft.
Im Zuge einer fortschreitenden europäischen Integration über die Europäische Union wurde eine gemeinsame Währung in Europa, der Euro, eingeführt. Diese Einführung einer gemeinsamen Währung führte dazu, dass eine neue zentrale geldpolitische Institution entstand, die der neue „Hüter“ des Euros werden sollte. Diese neue Institution sollte die geldpolitischen Aufgaben der beteiligten nationalen Zentralbanken übernehmen. Dabei entstand die Europäische Zentralbank 1998 als Organ der Europäischen Union. Durch die direkte Entstehung der Europäischen Zentralbank aus den nationalen Zentralbanken heraus, waren hier die erprobten und erfolgreichen Systeme der nationalen Zentralbanken maßgebend. Das erfolgreiche System der Deutsche Bundesbank hatte deshalb essentiellen Einfluss auf den Aufbau und die Reglementierungen der Europäischen Zentralbank.
Aufgrund dieser Tatsache ist ein Vergleich der Deutschen Bundesbank in den frühen 1990igern mit der Europäischen Zentralbank von heute eine überaus interessante Betrachtung und soll vor allem die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Institutionen aufzeigen, nicht zuletzt in der differenzierten Ausgestaltung ihrer Übertragenen geldpolitischen Pflichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entwicklungsgeschichte
- 2 Vergleich der Europäischen Zentralbank mit der Deutschen Bundesbank
- 2.1 Europäische Zentralbank
- 2.1.1 Aufbau
- 2.1.1.1 Die Organe und der institutionelle Rahmen
- 2.1.1.2 Die Sicherung der Unabhängigkeit
- 2.1.2 Das vorrangige Ziel der Preisniveaustabilität
- 2.1.3 Die geldpolitischen Instrumentarien
- 2.1.3.1 Offenmarktgeschäfte
- 2.1.3.2 Ständige Fazilitäten
- 2.1.3.3 Mindestreserve
- 2.1.1 Aufbau
- 2.2 Deutsche Bundesbank
- 2.2.1 Wahl des Betrachtungszeitraums
- 2.2.2 Aufbau
- 2.2.2.1 Die Organe und der institutionelle Rahmen
- 2.2.2.2 Die Sicherung der Unabhängigkeit
- 2.2.3 Das Geldmengenziel als Orientierungsgröße
- 2.2.4 Die geldpolitischen Instrumentarien
- 2.2.4.1 Offenmarktgeschäfte
- 2.2.4.2 Refinanzierungspolitik
- 2.2.4.3 Mindestreservepolitik
- 2.1 Europäische Zentralbank
- 3 Diskussion
- 3.1 Verdeutlichung der Ähnlichkeiten in den beiden Systemen
- 3.2 Vor- und Nachteile sowie Chancen der beiden Systeme
- 4 Verlust der Stabilitätsorientierung als kleine Revolution durch eine evolutionäre Erweiterung der Geldpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Deutschen Bundesbank (DBB) zu vergleichen und zu analysieren, ob die Entstehung der EZB eher eine Revolution oder eine Evolution darstellt. Der Fokus liegt auf dem Aufbau, den Zielen und den geldpolitischen Instrumentarien beider Institutionen.
- Entwicklung der Europäischen Währungsunion und die Rolle der EZB
- Vergleich des institutionellen Aufbaus der EZB und der DBB
- Analyse der geldpolitischen Ziele und Strategien beider Zentralbanken
- Untersuchung der geldpolitischen Instrumente der EZB und der DBB
- Bewertung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Entwicklungsgeschichte: Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Entwicklung der Deutschen Bundesbank vor der Einführung des Euros. Ihre bedeutende Rolle in der deutschen und europäischen Wirtschaft wird hervorgehoben, bevor die Entstehung der EZB im Kontext der europäischen Integration und der Einführung des Euro erläutert wird. Die Arbeit betont den Einfluss des erfolgreichen Systems der Deutschen Bundesbank auf den Aufbau der EZB.
2 Vergleich der Europäischen Zentralbank mit der Deutschen Bundesbank: Dieses Kapitel vergleicht den Aufbau, die Ziele und die geldpolitischen Instrumente der EZB und der DBB. Es werden die Organe, der institutionelle Rahmen und die Mechanismen zur Sicherung der Unabhängigkeit beider Institutionen detailliert untersucht. Der Vergleich umfasst die geldpolitischen Strategien und die eingesetzten Instrumente wie Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreservepolitik. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme werden herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Deutsche Bundesbank (DBB), Geldpolitik, Preisniveaustabilität, Währungsunion, Eurosystem, Offenmarktgeschäfte, Mindestreserve, Unabhängigkeit, europäische Integration, Wirtschafts- und Währungsunion (WWU).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vergleich EZB und DBB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Europäische Zentralbank (EZB) und die Deutsche Bundesbank (DBB) hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Ziele und geldpolitischen Instrumente. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse, ob die Entstehung der EZB eher eine Revolution oder eine Evolution darstellt.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Entwicklungsgeschichte (der DBB und der EZB im Kontext der europäischen Integration); 2. Vergleich der EZB und DBB (Aufbau, Ziele, geldpolitische Instrumente); 3. Diskussion (Ähnlichkeiten, Vor- und Nachteile beider Systeme); 4. Verlust der Stabilitätsorientierung als kleine Revolution durch eine evolutionäre Erweiterung der Geldpolitik.
Welche Aspekte der EZB und DBB werden im Detail verglichen?
Der Vergleich umfasst den institutionellen Aufbau (Organe, institutioneller Rahmen, Sicherung der Unabhängigkeit), die geldpolitischen Ziele (Preisniveaustabilität bei der EZB, Geldmengenziel bei der DBB) und die geldpolitischen Instrumente (Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten/Refinanzierungspolitik, Mindestreservepolitik).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Deutsche Bundesbank (DBB), Geldpolitik, Preisniveaustabilität, Währungsunion, Eurosystem, Offenmarktgeschäfte, Mindestreserve, Unabhängigkeit, europäische Integration, Wirtschafts- und Währungsunion (WWU).
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die EZB und die DBB umfassend zu vergleichen und zu analysieren, um die Entstehung der EZB im Verhältnis zur DBB als revolutionär oder evolutionär einzuordnen. Der Fokus liegt dabei auf den strukturellen Ähnlichkeiten und Unterschieden sowie den jeweiligen geldpolitischen Strategien.
Wie wird die Entwicklung der EZB in der Arbeit dargestellt?
Die Entwicklungsgeschichte beginnt mit einem Überblick über die Deutsche Bundesbank vor dem Euro. Die Entstehung der EZB wird im Kontext der europäischen Integration und der Einführung des Euro erläutert, wobei der Einfluss des DBB-Systems auf den Aufbau der EZB hervorgehoben wird.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit analysiert die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Zentralbanken und bewertet die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme. Die Einordnung der Entstehung der EZB als revolutionär oder evolutionär wird diskutiert.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und listet alle Kapitel und Unterkapitel detailliert auf, inklusive einer Untergliederung der Vergleichsaspekte von EZB und DBB.
- Quote paper
- Alexander Schmitt (Author), 2011, Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ein Vergleich zwischen Europäischer Zentralbank und Deutscher Bundesbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300809