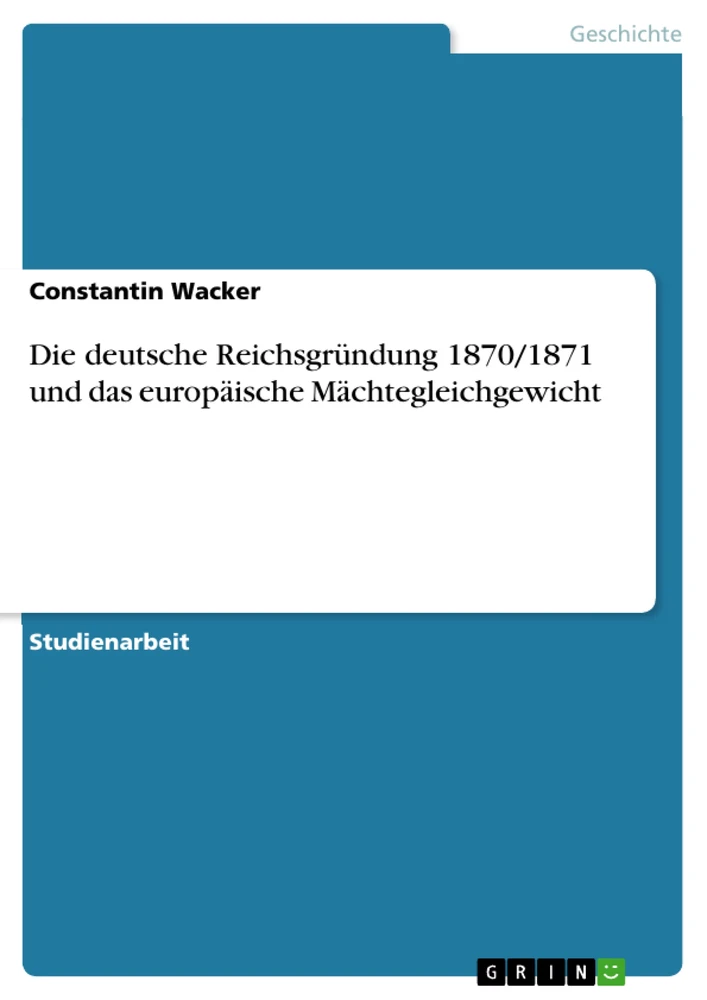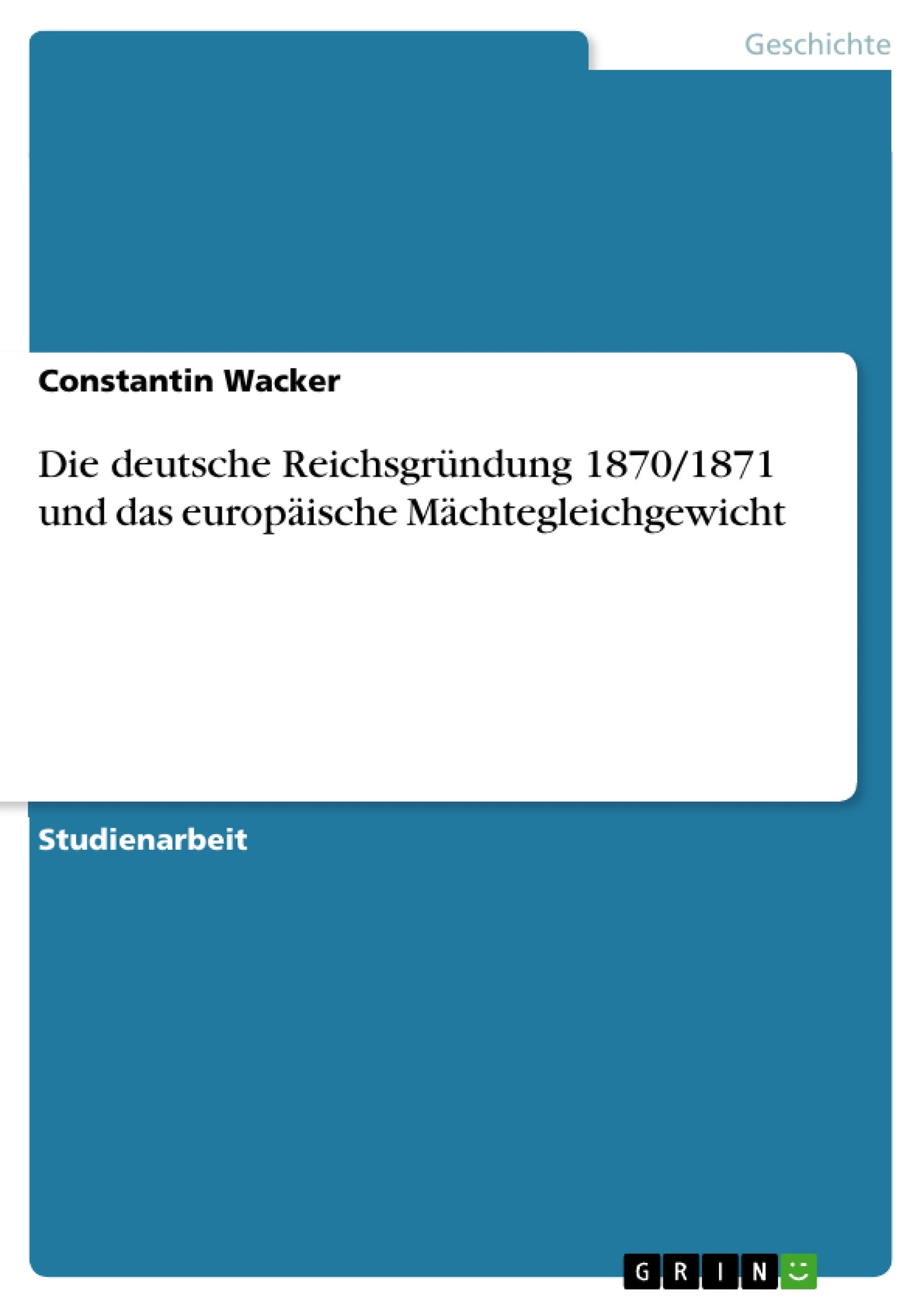Am 18. Januar 1871 hat die Gründung des Deutschen Reiches ihren symbolischen Abschluss in der Kaiserproklamation im Versailler Spiegelsaal gefunden. Im Rückblick erscheint die Herausbildung des deutschen Nationalstaats unter preußischer Suprematie infolge dreier geschlagener „Einigungskriege“ 1864, 1866 und 1870/71 als Ausfluss eines in linearen Bahnen verlaufenden, historisch zwangsläufigen und letztlich alternativlosen Unifikationsprozesses, welcher den jahrhundertelang andauernden Zustand territorialer Zersplitterung überwand. Ebenjene an ihrer Eindimensionalität krankende Perspektive läuft indes Gefahr, der tendenziösen „borussographischen“ Historiographie des Deutschen Kaiserreiches anheim zu fallen, welche Jacob Burkhardt zufolge den der Reichsgründung vorausgehenden Entwicklungen unter teleologischen Gesichtspunkten „einen siegesdeutschen Anstrich“ verliehen sowie 1871 als den Kumulationspunkt einer bei Martin Luther anfangenden „Heilsgeschichte“ glorifiziert habe. Auf diese Weise bildete die mit methodologisch fragwürdigen Standards operierende Geschichtsschreibung nach 1871 Teil einer politisch instrumentalisierten Erinnerungskultur.
Eine einseitig endogene Fixierung auf den ökonomischen, militärischen und politischen Aufstieg Preußens unter der Ägide des „weißen Revolutionärs“ Otto v. Bismarck, wird der Komplexität der Materie in keiner Weise gerecht, vermag sie doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Preußen-Deutschland zu Beginn der 1860er-Jahre nur eine von vielen Lösungsmöglichkeiten der „deutschen Frage“ darstellte. Noch gravierender ist die Außerachtlassung der exogenen Rahmenbedingungen für die Reichsgründung, die in der außen- und geopolitischen Konstellation in Europa zu jener Zeit vorzufinden waren. Ein holistisches Bild des deutschen Einigungsprozesses lässt sich schlechterdings nicht losgelöst von dessen Einbettung in das europäische Großmächtesystem nachzeichnen, dessen Funktionsweise respektive Strukturprinzipien notwendigerweise ebenso integrale Bestandteile geschichtswissenschaftlicher Abhandlungen zu dieser Thematik konstituieren.
In Anbetracht des Zäsurcharakters der Reichsgründung von 1870/71 für die europäische Geschichte setzt sich diese Hausarbeit zum Ziel, schwerpunktmäßig den in den internationalen Beziehungen zu verortenden Ursachen für das Zustandekommen der Reichseinigung auf den Grund zu gehen und diese in ihrer komplexen Wechselwirkung zu den innerpreußischen bzw. innerdeutschen Bedingungsfaktoren zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das europäische Gleichgewichtssystem im 19. Jahrhundert
- Entstehung und Strukturmerkmale
- Akteure
- Strukturwandel im Zeitraum 1815-1856
- Die Ausgangslage um 1862/1863
- Die innerdeutsche Situation
- Deutsche Nationalbewegung
- Preußischer Heeres- und Verfassungskonflikt und die Ernennung Bismarcks zum Ministerpräsident
- Deutscher Dualismus
- Die außenpolitische Situation
- Französische Außenpolitik
- Russische Außenpolitik
- Britische Außenpolitik
- Die innerdeutsche Situation
- Der Deutsche Krieg 1866
- Von Düppel nach Königsgrätz
- Der Deutsche Krieg und seine Folgen
- Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871
- Der deutsch-französische Antagonismus 1866-1868
- Die Hohenzollernkandidatur und der Krieg von 1870/71
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen der deutschen Reichsgründung von 1870/71 im Kontext der internationalen Beziehungen des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die komplexen Wechselwirkungen zwischen innerpreußischen und innerdeutschen Faktoren sowie den außenpolitischen Bedingungen, die zur Reichseinigung führten. Der Fokus liegt auf den 1860er Jahren und relevanten Ereignissen dieser Dekade.
- Das europäische Gleichgewichtssystem im 19. Jahrhundert und seine Rolle bei der deutschen Einigung
- Die innerdeutsche Situation vor der Reichsgründung, insbesondere die Rolle Preußens und die deutsche Nationalbewegung
- Die außenpolitischen Strategien der europäischen Großmächte und deren Reaktion auf Preußens Politik
- Die drei Einigungskriege und ihre Auswirkungen auf das europäische Mächtegleichgewicht
- Bewertung der These eines alternativlosen Einigungsprozesses unter preußischer Führung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Reichsgründung von 1871 in den Kontext der bestehenden Geschichtsschreibung, die oft eine einseitige, preußisch-zentrierte Perspektive einnimmt. Sie kritisiert diese „borussographische“ Sichtweise und betont die Notwendigkeit einer umfassenderen Analyse, die die exogenen Faktoren, insbesondere das europäische Mächtesystem, berücksichtigt. Die Arbeit untersucht die Ursachen der Reichsgründung und deren Einbettung in das internationale System. Die Frage, warum die europäischen Großmächte nicht intervenierten, um Preußens Hegemoniebestrebungen zu verhindern, steht im Mittelpunkt.
Das europäische Gleichgewichtssystem im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung, Struktur und Akteure des europäischen Gleichgewichtssystems im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet dessen Strukturwandel zwischen 1815 und 1856 und legt die Grundlagen für das Verständnis der außenpolitischen Konstellation während der deutschen Einigungskriege. Die Dynamiken und Machtverhältnisse innerhalb des Systems werden detailliert untersucht, um den Kontext der deutschen Reichsgründung zu verdeutlichen.
Die Ausgangslage um 1862/1863: Dieses Kapitel beschreibt die innerdeutsche und außenpolitische Situation um 1862/63. Die innerdeutsche Situation wird durch die Analyse der deutschen Nationalbewegung, den preußischen Heeres- und Verfassungskonflikt und den deutschen Dualismus beleuchtet. Die außenpolitische Situation wird durch die Betrachtung der französischen, russischen und britischen Außenpolitik erörtert. Es wird gezeigt, wie diese Faktoren den Weg zur Reichsgründung beeinflusst haben.
Der Deutsche Krieg 1866: Das Kapitel behandelt den Deutschen Krieg von 1866, von der Schlacht von Düppel bis zur Schlacht bei Königsgrätz. Es analysiert die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Krieges, insbesondere die Auswirkungen auf die deutsche Frage und das europäische Mächtegleichgewicht. Der Krieg wird als entscheidender Schritt auf dem Weg zur Reichsgründung dargestellt und seine strategischen Implikationen werden eingehend untersucht.
Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871: Dieses Kapitel untersucht den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, beginnend mit dem deutsch-französischen Antagonismus nach dem Deutschen Krieg und der Hohenzollernkandidatur. Es analysiert die Ursachen, den Verlauf und die unmittelbaren Folgen des Krieges, der mit der Proklamation des Deutschen Kaiserreichs endete. Der Fokus liegt auf den außenpolitischen Aspekten und deren Bedeutung für die Reichsgründung.
Schlüsselwörter
Deutsche Reichsgründung, Europäisches Mächtegleichgewicht, Bismarck, Preußen, Deutsche Nationalbewegung, Einigungskriege, Außenpolitik, Innerdeutsche Situation, International Beziehungen 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die Deutsche Reichsgründung 1871 im Kontext der Internationalen Beziehungen des 19. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen der deutschen Reichsgründung von 1870/71 im Kontext der internationalen Beziehungen des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die komplexen Wechselwirkungen zwischen innerpreußischen und innerdeutschen Faktoren sowie den außenpolitischen Bedingungen, die zur Reichseinigung führten. Der Fokus liegt auf den 1860er Jahren und relevanten Ereignissen dieser Dekade.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das europäische Gleichgewichtssystem im 19. Jahrhundert und seine Rolle bei der deutschen Einigung, die innerdeutsche Situation vor der Reichsgründung (insbesondere die Rolle Preußens und die deutsche Nationalbewegung), die außenpolitischen Strategien der europäischen Großmächte und deren Reaktion auf Preußens Politik, die drei Einigungskriege und ihre Auswirkungen auf das europäische Mächtegleichgewicht sowie eine Bewertung der These eines alternativlosen Einigungsprozesses unter preußischer Führung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung: Einordnung der Reichsgründung in die Geschichtsschreibung und These der Arbeit. Das europäische Gleichgewichtssystem im 19. Jahrhundert: Entstehung, Struktur und Akteure des Systems sowie dessen Wandel zwischen 1815 und 1856. Die Ausgangslage um 1862/1863: Innerdeutsche (deutsche Nationalbewegung, preußischer Konflikt) und außenpolitische Situation (Frankreich, Russland, Großbritannien). Der Deutsche Krieg 1866: Verlauf und Folgen des Krieges. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871: Antagonismus, Hohenzollernkandidatur, Verlauf und Folgen. Resümee: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Kritikpunkte werden in der Einleitung angesprochen?
Die Einleitung kritisiert die oft einseitige, preußisch-zentrierte ("borussographische") Perspektive in der bisherigen Geschichtsschreibung zur Reichsgründung und plädiert für eine umfassendere Analyse, die exogene Faktoren, insbesondere das europäische Mächtesystem, berücksichtigt. Die Arbeit fragt auch nach den Gründen für das Ausbleiben einer Intervention der europäischen Großmächte gegen Preußens Hegemoniebestrebungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Reichsgründung, Europäisches Mächtegleichgewicht, Bismarck, Preußen, Deutsche Nationalbewegung, Einigungskriege, Außenpolitik, Innerdeutsche Situation, Internationale Beziehungen 19. Jahrhundert.
Welche Rolle spielt das europäische Gleichgewichtssystem in der Hausarbeit?
Das europäische Gleichgewichtssystem wird als zentraler Kontextfaktor für die deutsche Reichsgründung analysiert. Die Arbeit untersucht dessen Einfluss auf die außenpolitischen Strategien der beteiligten Mächte und die Reaktionen auf Preußens Politik.
Welche Bedeutung haben die Einigungskriege für die Argumentation?
Die drei Einigungskriege (Deutscher Krieg 1866 und Deutsch-Französischer Krieg 1870/71) werden als entscheidende Schritte im Prozess der Reichsgründung analysiert. Ihre Ursachen, Verläufe und Folgen für das europäische Mächtegleichgewicht werden detailliert untersucht.
Wie wird die Rolle Preußens bewertet?
Die Rolle Preußens wird im Kontext der innerdeutschen und internationalen Situation analysiert. Die Arbeit hinterfragt die These eines alternativlosen Einigungsprozesses unter preußischer Führung.
- Quote paper
- Constantin Wacker (Author), 2014, Die deutsche Reichsgründung 1870/1871 und das europäische Mächtegleichgewicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300799