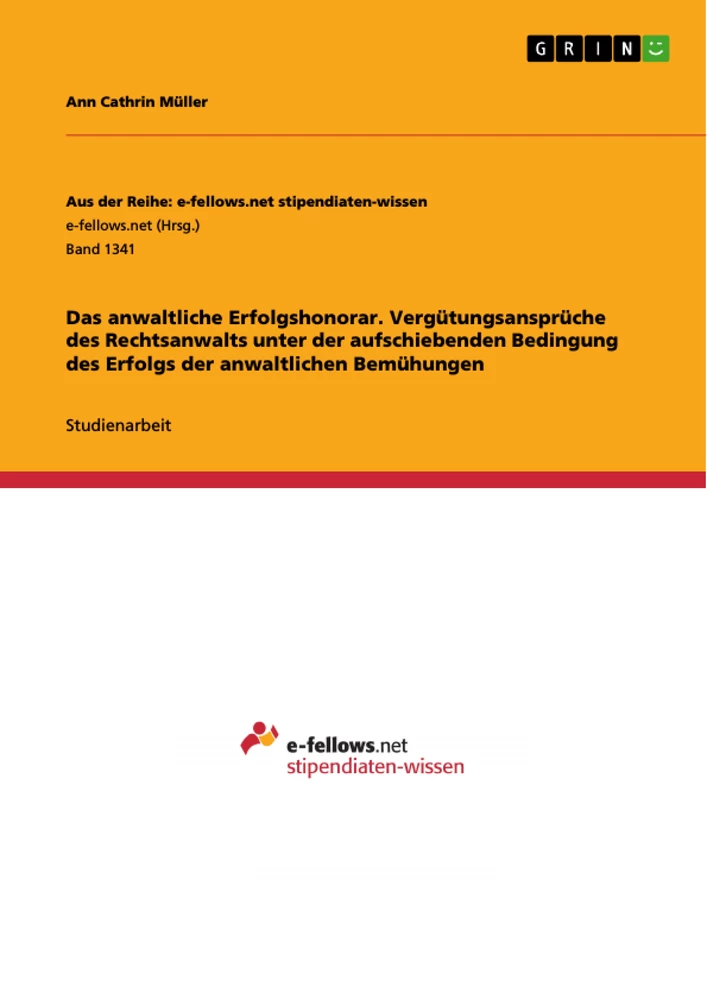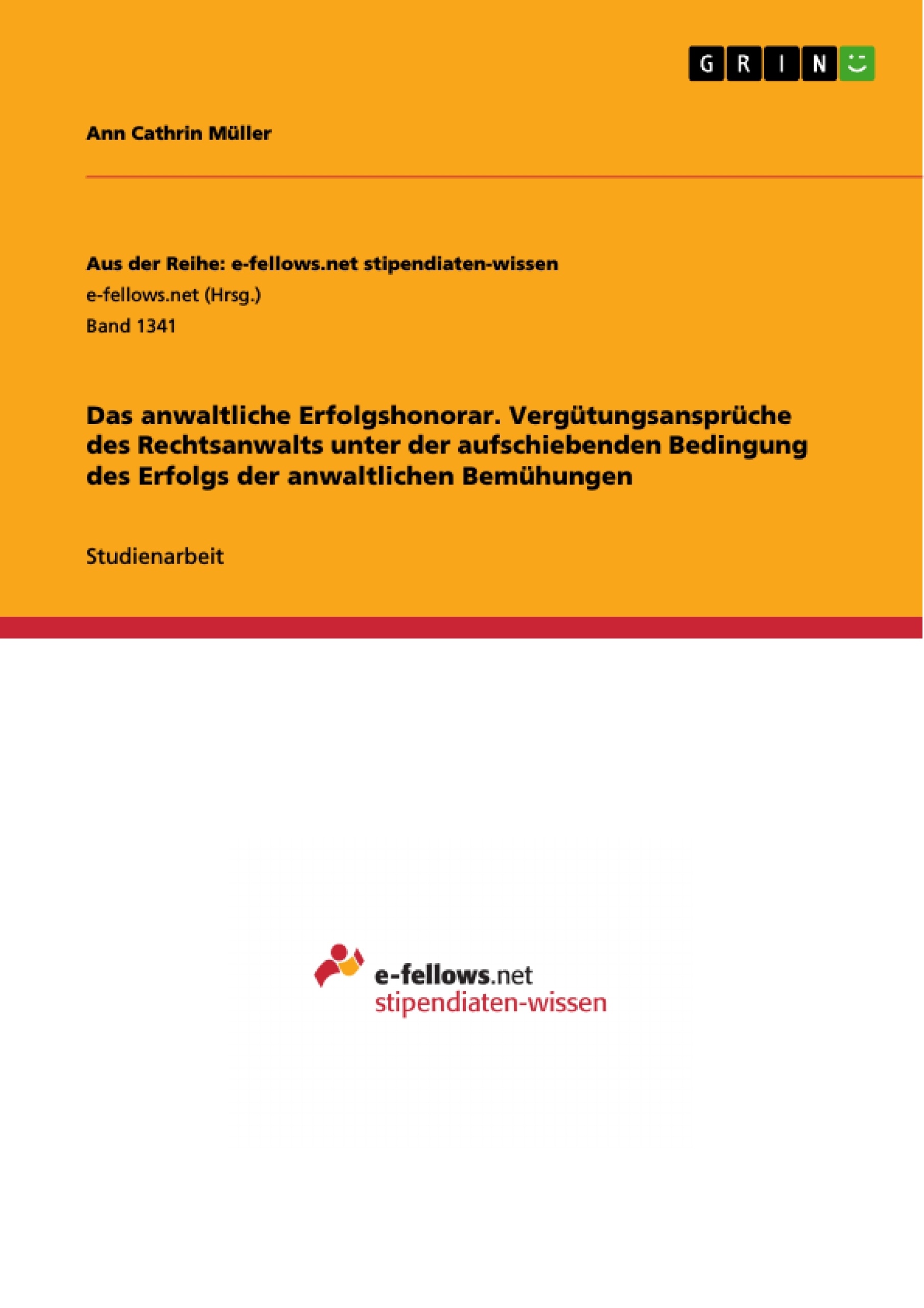Bis zum 1.7.2008 galt auf deutschem Boden ein absolutes Verbot der erfolgsbasierten Vergütung im anwaltlichen Berufsrecht. Die gesetzliche Grundlage fand das Verbot in §49b Abs.2 S.1 BRAO.
In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12.12.2006 erklärte das Gericht das ausnahmslose Verbot der erfolgsabhängigen Vergütung für verfassungswidrig. Nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit hat das Gericht die Norm als geeignet und erforderlich erachtet um bestimmte Interessen des Gemeinwohls zu sichern. So soll durch das Verbot die anwaltliche Unabhängigkeit gewahrt, der Rechtssuchende vor Übervorteilung durch überhöhte Vergütungssätze geschützt und die prozessuale Waffengleichheit aufrechterhalten werden.
Aufgrund dieser Legitimationsgründe ging das Gericht von der Erforderlichkeit und Geeignetheit der Norm aus. Dennoch wurde das Totalverbot als unangemessener Eingriff in den Schutzbereich der verfassungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit aus Art. 12 GG erachtet. Es wurde festgestellt, dass ein derartiges Verbot eine erhebliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte des Rechtssuchenden darstellt. Obgleich die Norm dem Schutze des Mandanten dienen soll, kommt eine derartige Fassung dem Einzelnen gerade nicht zugute.
Das Verfassungsgericht beauftragte den Gesetzgeber bis zum 30. Juni 2008 eine Neuregelung zu schaffen, wonach gewisse Ausnahmetatbestände der erfolgsabhängigen Vergütungsvereinbarung im Anwaltsvertrag zulässig sein sollen. Insbesondere der Fall, dass ein Rechtsanwalt mit der Vereinbarung einer erfolgsbasierten Vergütung besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers Rechnung trage, die diesen sonst davon abhielten, seine Rechte zu verfolgen, ist dabei zu berücksichtigen. Bei diesem Regelungsauftrag wurde dem Gesetzgeber ein weites Ermessen eingeräumt, indem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass auch die Möglichkeit [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Historische Entwicklung des Erfolgshonorars
- B. Einordnung in das gesamte anwaltliche Vergütungsrecht
- I. Allgemeines zum Anwaltsvertrag
- II. Vergütung des Rechtsanwalts
- III. Vergütungsvereinbarungen
- 1) Zeithonorar
- 2) Pauschalhonorar
- 3) Erfolgshonorar
- 4) Zeitpunkt der Vergütungsvereinbarung
- 5) Zwischenergebnis
- C. Allgemeines zum Erfolgshonorar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die rechtliche Entwicklung und Einordnung des Erfolgshonorars im deutschen Anwaltsrecht. Er beleuchtet die historische Entwicklung des Verbots und dessen Aufhebung, die verschiedenen Arten der anwaltlichen Vergütung und die rechtlichen Grundlagen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
- Historische Entwicklung des Erfolgshonorarsverbots und dessen Aufhebung durch das Bundesverfassungsgericht.
- Die verschiedenen Arten der anwaltlichen Vergütung (Zeithonorar, Pauschalhonorar, Erfolgshonorar).
- Die rechtlichen Grundlagen der anwaltlichen Vergütung im BGB und RVG.
- Die Bedeutung der Vertragsfreiheit im Anwaltsrecht.
- Die Abgrenzung des Erfolgshonorars von anderen Vergütungsmodellen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Historische Entwicklung des Erfolgshonorars: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Erfolgshonorars im deutschen Anwaltsrecht. Bis zum 1. Juli 2008 galt ein absolutes Verbot erfolgsbasierter Vergütung, welches das Bundesverfassungsgericht aufgrund eines Verstoßes gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) für verfassungswidrig erklärte. Das Gericht forderte den Gesetzgeber auf, eine Neuregelung zu schaffen, die Ausnahmetatbestände für erfolgsabhängige Vergütungsvereinbarungen zulässt. Die darauf folgende Gesetzesänderung führte zur Zulassung von Erfolgshonoraren unter bestimmten Bedingungen, wobei das ursprüngliche Verbot bis zur Neuregelung weiterhin galt. Die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit des Verbots und die Bedeutung der anwaltlichen Unabhängigkeit und des Schutzes des Mandanten werden detailliert beleuchtet.
B. Einordnung in das gesamte anwaltliche Vergütungsrecht: Dieses Kapitel ordnet das Erfolgshonorar in das gesamte System der anwaltlichen Vergütung ein. Es beginnt mit einer Erläuterung des Anwaltsvertrags als Dienstvertrag nach §§ 611, 675 BGB, mit der Möglichkeit eines Werkvertrags in Ausnahmefällen. Der Schwerpunkt liegt auf der Vergütung des Rechtsanwalts nach § 612 BGB, der vereinbarten oder üblichen Vergütung und der Rolle des RVG als gesetzliche Taxe. Das Kapitel diskutiert die Frage, ob das RVG eine abschließende Regelung darstellt oder ob die Vertragsfreiheit der Parteien weiterhin uneingeschränkt gilt. Es werden die verschiedenen Vergütungsmodelle (Zeithonorar, Pauschalhonorar und Erfolgshonorar) im Detail erklärt und deren Vor- und Nachteile abgewägt. Besonders wird die Bedeutung der Vertragsfreiheit und die Möglichkeit, individuelle Vergütungsvereinbarungen zu treffen, hervorgehoben. Die Fälligkeit der Vergütung nach § 8 RVG wird ebenfalls behandelt.
C. Allgemeines zum Erfolgshonorar: Dieses Kapitel klärt auf, dass das Erfolgshonorar, obwohl gesetzlich explizit benannt, kein eigenständiges Vergütungsmodell darstellt. Vielmehr handelt es sich um ein gewöhnliches Honorar (Zeit-, Pauschal- oder tarifliches Honorar), dessen Anspruchsentstehung von der aufschiebenden Bedingung des Erfolgs im Sinne von § 158 Abs. 1 BGB abhängt. Das Kapitel verdeutlicht die rechtliche Einordnung des Erfolgshonorars und räumt mit Missverständnissen bezüglich seiner Eigenständigkeit auf.
Schlüsselwörter
Erfolgshonorar, Anwaltsrecht, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Vertragsfreiheit, Zeithonorar, Pauschalhonorar, Bundesverfassungsgericht, Berufsfreiheit, Vergütungsvereinbarung, Mandant, Rechtsanwalt.
Häufig gestellte Fragen zum Erfolgshonorar im Anwaltsrecht
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht zum Thema Erfolgshonorar im deutschen Anwaltsrecht. Er behandelt die historische Entwicklung, die rechtliche Einordnung, verschiedene Vergütungsmodelle und die relevanten Gesetzesgrundlagen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text deckt folgende Themen ab: die historische Entwicklung des Verbots und der Zulassung von Erfolgshonoraren, die Einordnung des Erfolgshonorars in das gesamte anwaltliche Vergütungsrecht (inkl. Anwaltsvertrag, Vergütungsvereinbarungen, Zeithonorar, Pauschalhonorar), die rechtlichen Grundlagen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), die Bedeutung der Vertragsfreiheit, die Abgrenzung des Erfolgshonorars zu anderen Modellen und die Klärung von Missverständnissen bezüglich seiner Eigenständigkeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in drei Hauptkapitel gegliedert: A. Historische Entwicklung des Erfolgshonorars; B. Einordnung in das gesamte anwaltliche Vergütungsrecht; C. Allgemeines zum Erfolgshonorar. Kapitel B enthält Unterkapitel zu Allgemeines zum Anwaltsvertrag, Vergütung des Rechtsanwalts und Vergütungsvereinbarungen (inkl. Zeithonorar, Pauschalhonorar, Erfolgshonorar, Zeitpunkt der Vereinbarung und Zwischenergebnis).
Wie ist die historische Entwicklung des Erfolgshonorars dargestellt?
Das Kapitel zur historischen Entwicklung beschreibt das frühere Verbot von Erfolgshonoraren, seine Aufhebung durch das Bundesverfassungsgericht aufgrund eines Verstoßes gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und die anschließende gesetzliche Neuregelung, die Erfolgshonorare unter bestimmten Bedingungen zulässt. Die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit des Verbots und die Bedeutung der anwaltlichen Unabhängigkeit werden detailliert beleuchtet.
Wie wird das Erfolgshonorar im anwaltlichen Vergütungsrecht eingeordnet?
Das Kapitel zur Einordnung beschreibt den Anwaltsvertrag als Dienstvertrag nach §§ 611, 675 BGB (mit Ausnahmen für Werkverträge), die Vergütung nach § 612 BGB, die Rolle des RVG, die verschiedenen Vergütungsmodelle (Zeithonorar, Pauschalhonorar, Erfolgshonorar) und deren Vor- und Nachteile, die Bedeutung der Vertragsfreiheit und die Fälligkeit der Vergütung nach § 8 RVG.
Was ist das Besondere am Erfolgshonorar?
Obwohl gesetzlich erwähnt, ist das Erfolgshonorar kein eigenständiges Vergütungsmodell. Es handelt sich um ein gewöhnliches Honorar (Zeit-, Pauschal- oder tarifliches Honorar), dessen Anspruch von der aufschiebenden Bedingung des Erfolgs (im Sinne von § 158 Abs. 1 BGB) abhängt. Der Text klärt auf, dass es kein eigenständiges Vergütungsmodell ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Erfolgshonorar, Anwaltsrecht, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Vertragsfreiheit, Zeithonorar, Pauschalhonorar, Bundesverfassungsgericht, Berufsfreiheit, Vergütungsvereinbarung, Mandant, Rechtsanwalt.
Welche Gesetzesgrundlagen werden erwähnt?
Der Text bezieht sich auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 611, 675 und 612, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), insbesondere § 8, und die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) wird im Zusammenhang mit der Berufsfreiheit erwähnt.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für Personen gedacht, die sich umfassend über das Thema Erfolgshonorar im deutschen Anwaltsrecht informieren möchten, zum Beispiel Juristen, Rechtsanwälte, Studenten der Rechtswissenschaften oder interessierte Laien.
- Quote paper
- Ann Cathrin Müller (Author), 2015, Das anwaltliche Erfolgshonorar. Vergütungsansprüche des Rechtsanwalts unter der aufschiebenden Bedingung des Erfolgs der anwaltlichen Bemühungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300748