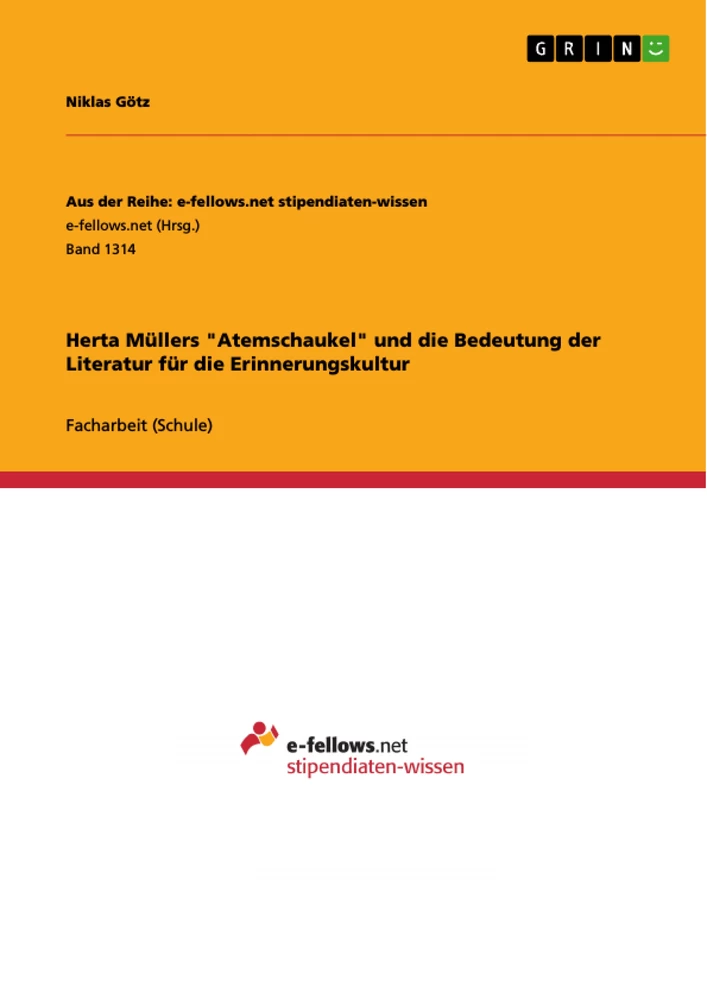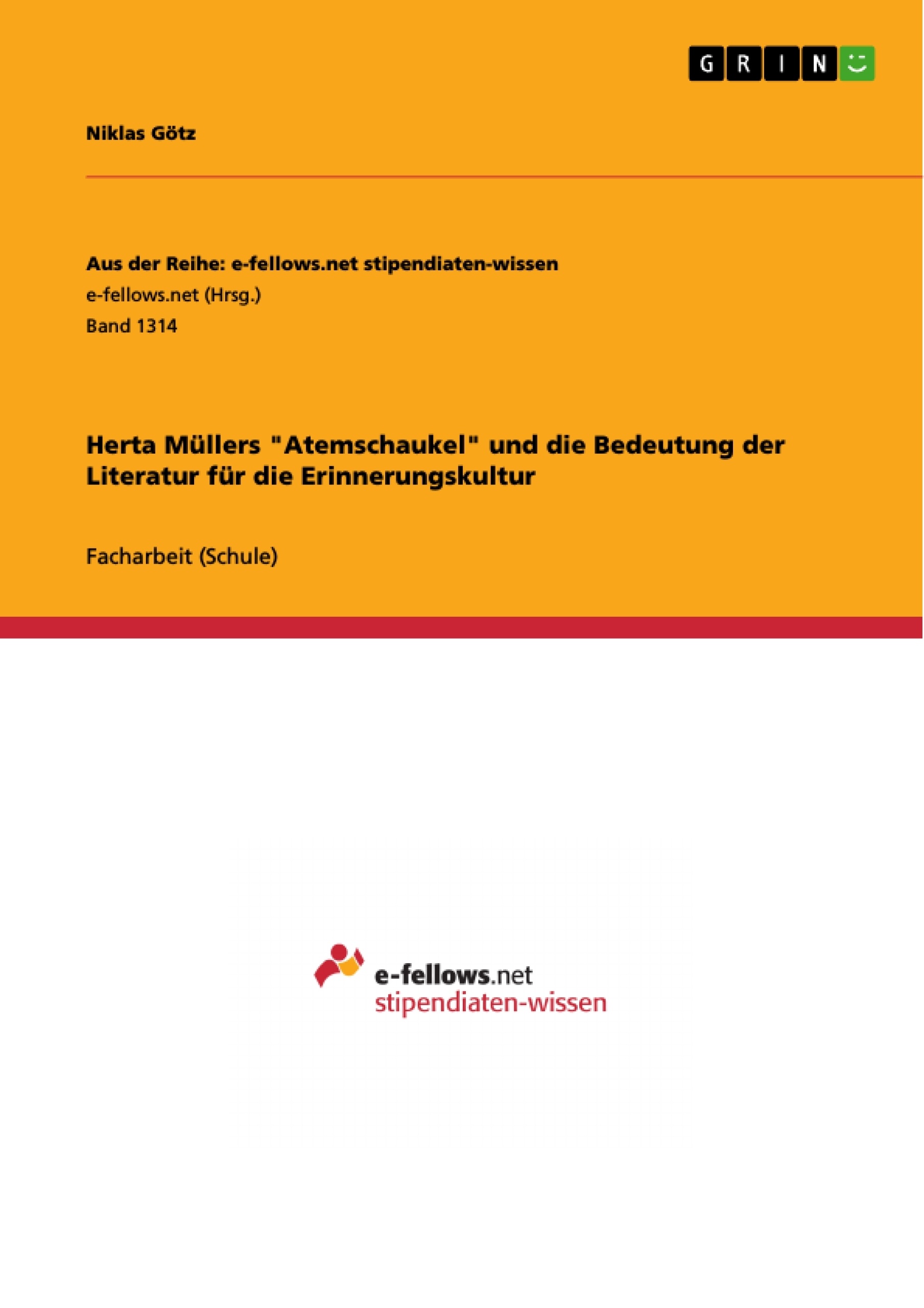Als Herta Müller 2009 mit dem Nobelpreis der Literatur für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet wurde, war die Freude in Deutschland verständlicherweise groß. Dass Günther Grass diese Ehrung erst zehn Jahre zuvor erhielt, tat dem keinen Abbruch.
Die Begründung der Auswahl der Preisträgerin, dass sie „mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit zeichnet “, konnte sie auch dem Buchmarkt in ihrer Heimat unter Beweis stellen: Erst zwei Monate zuvor erschien ihr neuster Roman, „Atemschaukel“, der es einen Monat zuvor in die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hatte.
Dennoch wäre er wohl schwerlich ein Bestseller geworden, hätte ihm der Nobelpreis nicht zu unverhoffter Berühmtheit verholfen. Nicht etwa, dass es ihm an literarischen Wert mangelt – im Gegenteil, er zeugt von höchster Kunstfertigkeit. Es liegt am zentralen Thema: der Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkrieges. Dieses traurige Kapitel der Geschichte wurde stets totgeschwiegen, Werke dazu ignoriert. Dies liegt wohl einerseits am Historikerstreit und der steten Präsenz des Holocaust, anderseits wohl an der traumatischen Aufladung dieses Themas. Dazu trägt auch die nachlässige Behandlung des Themas in Rumänien selbst bei, da „es an die faschistische Vergangenheit Rumäniens erinnerte, war das Thema Deportation tabu“.
Deshalb kann man die Vergabe des Nobelpreises an Herta Müller in diesem Jahr als Befreiungsschlag für dieses Thema sehen, wurde doch das Werk dadurch zu einem Bestseller und Aushängeschild deutscher Literatur. Ohne die Ehrung wäre es wohl nicht im geringsten so bekannt und gefeiert, wie es jetzt ist.
Dennoch lassen sich noch auffällige Defizite bei der Rezeption von „Atemschaukel“ feststellen, und zwar umso stärker, je mehr man sich an den kritischen Bereich, den historischen Begebenheiten, nähert. So konnte ich bei meiner Recherche zahlreiche Arbeiten zu anderen Werken von Herta Müller finden, sowie Texte, in denen „Atemschaukel“ als Werk eines weiblichen Autors betrachtet wurde, jedoch gab es kaum Sekundärliteratur, die sich mit der Beziehung zu den historischen Begebenheiten und damit mit der Bedeutung dieses Werkes zur Erinnerungskultur beschäftigt. Um diese zu betrachten, müssen wir zuerst definieren, was Erinnerungskultur ist.
Inhaltsverzeichnis
- Der Nobelpreis der Literatur 2009 im Zeichen der Erinnerung
- Herta Müllers „Atemschaukel“ und die Bedeutung der Literatur für die Erinnerungskultur
- Analyse des Inhalts, des Vorgehens der Autorin und der Relevanz für die Erinnerungskultur
- Historische Einführung in das Schicksal der Siebenbürger Sachsen am Ende des Zweiten Weltkriegs
- Knappe Zusammenfassung des Inhalts.
- Besondere Merkmale des Werkes
- Relevanz des Romans für die Erinnerungskultur.
- Kritik der Rolle der Literatur in der Erinnerungskultur
- Zusammenfassung der Kritikpunkte und Gegenargumente
- Prüfung anhand von Atemschaukel.
- Besondere Stellung der Literatur unter den Medien des Erinnerns.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Herta Müllers Roman „Atemschaukel“ und analysiert die Bedeutung der Literatur für die Erinnerungskultur. Sie beleuchtet, wie Müllers Werk zur Erinnerung an die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs beiträgt. Die Arbeit untersucht auch die Kritikpunkte an der Rolle der Literatur in der Erinnerungskultur und prüft diese anhand von „Atemschaukel“.
- Die Bedeutung der Literatur für die Erinnerungskultur
- Die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs
- Die Rolle der Literatur in der Erinnerungskultur
- Die historische Realität und die subjektiv-emotionale Wahrnehmung in der Erinnerungskultur
- Die Analyse von Herta Müllers „Atemschaukel“ im Kontext der Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Seminararbeit widmet sich dem Nobelpreis der Literatur 2009, der an Herta Müller verliehen wurde. Es wird die Bedeutung der Auszeichnung für die Rezeption von „Atemschaukel“ und die Bedeutung der Literatur für die Erinnerungskultur beleuchtet.
Der zweite Teil der Arbeit analysiert „Atemschaukel“ selbst. Zuerst wird die historische Realität der Deportation der Siebenbürger Sachsen dargestellt, gefolgt von einer knappen Zusammenfassung des Inhalts. Anschließend werden besondere Merkmale des Romans untersucht, um schließlich die Relevanz des Werks für die Erinnerungskultur zu beleuchten.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Kritik an der Rolle der Literatur in der Erinnerungskultur. Es werden Kritikpunkte und Gegenargumente zusammengefasst und anhand von „Atemschaukel“ geprüft.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Erinnerungskultur, Literatur, Deportation, Siebenbürger Sachsen, Herta Müller, „Atemschaukel“, historische Realität, subjektiv-emotionale Wahrnehmung, Kritik, Gegenargumente.
- Citar trabajo
- Niklas Götz (Autor), 2014, Herta Müllers "Atemschaukel" und die Bedeutung der Literatur für die Erinnerungskultur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300576