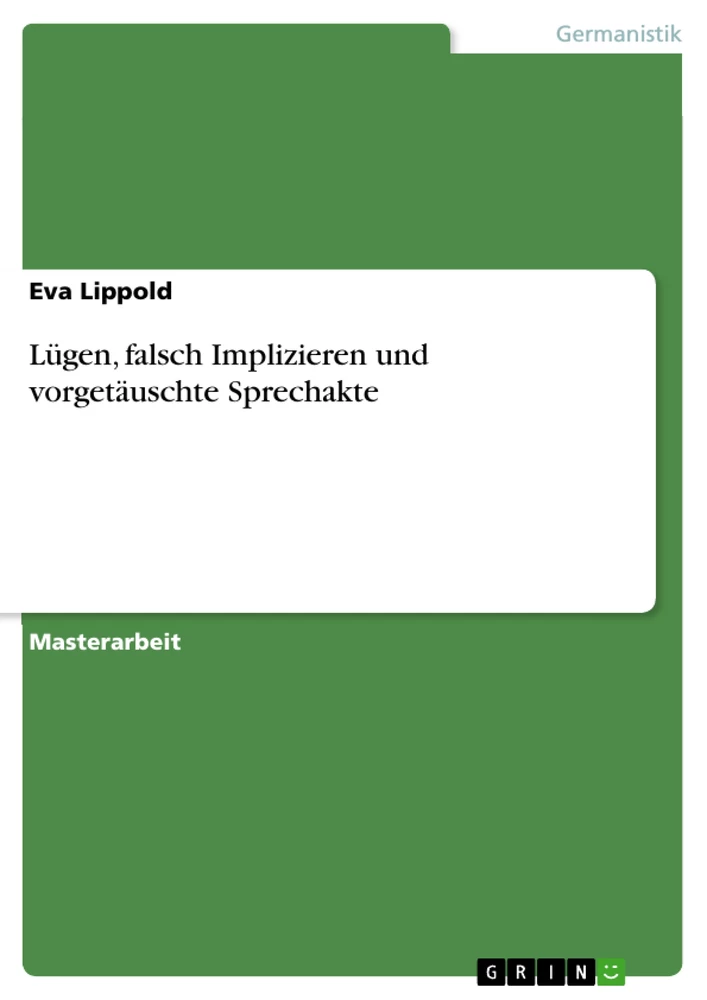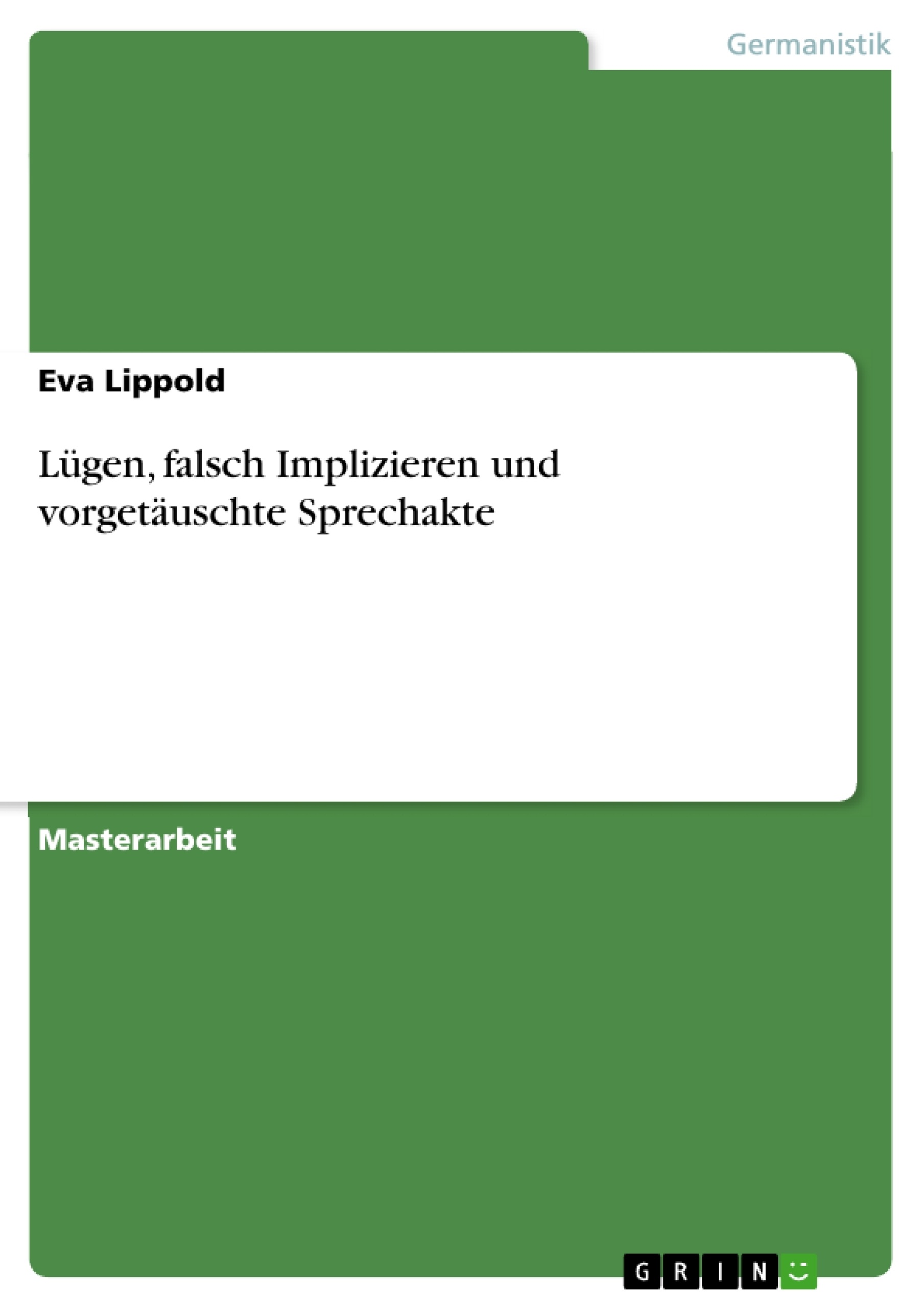In der linguistischen Forschung herrscht Konsens darüber, dass Lügen nur mit Behauptungen möglich sind (Falkenberg 1982, Chisholm/Feehan 1977, Giese 1992, Dietz 2002, Meibauer 2005 ). Notwendige Bedingung einer Lügendefinition ist demnach die Behauptungsbedingung. Diese Bedingung gilt, so Meibauer (2005), auch für falsche Implikaturen, auf die Meibauer seinen Lügenbegriff ausweitet. In dieser Arbeit sollen zunächst verschiedene linguistische Lügenbegriffe, insbesondere Falkenbergs Definition des „zentralen Falls der Lüge“ (Falkenberg 1982) und Meibauers „erweiterte Definition der Lüge“ (Meibauer 2005, 2011) kritisch untersucht werden. Ich stelle in Frage, ob falsche konversationelle Implikaturen mit dem allgemeinen Verständnis dessen, was eine Lüge ist, übereinstimmen, und komme damit zu meiner ersten Hypothese: Meibauers „erweiterte“ Lügendefinition entspricht nicht dem intuitiven Lügenbegriff von Sprechern. Zudem zweifle ich an, dass Lügen und falsche Implikaturen notwendig an Behauptungen gebunden sind. Hypothese 2: Lügen und falsche Implikaturen sind nicht notwendig an assertive Sprechakte gebunden.
Auf der Grundlage der Illokutionslogik (vgl. Searle/Vanderveken 1985) und Vandervekens Generalisierung der Grice’schen Konversationsmaximen (vgl. Vanderveken 1997) werde ich Lügen, Täuschungen und falsche Implikationen mit Behauptungen, anderen Sprechakten und illokutiven (Teil-) Komponenten analysieren. Dabei werde ich „Lügen im engeren Sinne“ illokutionslogisch bestimmen und eine „erweiterte“ illokutionslogische Definition verbaler Täuschung aufstellen, die auch falsches Implizieren und vorgetäuschte Sprechakte umfasst. Die verschiedenen Lügenbegriffe werde ich in einer experimentellen empirischen Untersuchung dahingehend prüfen, inwieweit sie tatsächlich dem intuitiven Lügenbegriff von Sprechern entsprechen.
Zum Aufbau der vorliegenden Arbeit: Im ersten Kapitel stelle ich verschiedene Analysen der Lüge vor und grenze die Begriffe Lüge und Täuschung voneinander ab. Im zweiten Kapitel wird der „Prototyp der Lüge“ betrachtet. In Kapitel 2.1 gehe ich auf notwendige und hinreichende Eigenschaften der Lüge ein, und formuliere darauf aufbauend eine vorläufige Definition der Lüge nach klassischer Kategorienauffassung. In Kapitel 2.2 werde ich einen prototypensemantischen Ansatz, insbesondere eine prototypensemantische Studie zur Lüge von Coleman/Kay (1982), vorstellen, die Lügen als graduelles Phänomen bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Analysen der Lüge
- Lüge vs. Täuschung
- Der „Prototyp“ der Lüge
- Dimensionen der Lüge
- Die Glaubensbedingung
- Die Täuschungsabsicht
- Die Behauptungsbedingung
- Prototypensemantische Analysen der Lüge
- Prototypensemantik: Das englische Verb „to lie“
- Kritik an Coleman und Kays' Ansatz
- Falkenberg: Der „zentrale Fall“ der Lüge
- Falkenbergs Behauptungsbedingung
- Falkenbergs Definition des „zentralen Falls“ der Lüge
- Falkenbergs „Grade der Lügenhaftigkeit“
- Zwischenfazit
- Falsch Implizieren: Lügen, obwohl man die Wahrheit behauptet
- Die konversationelle Implikatur und andere Implikaturentypen
- Falkenbergs Definitionsversuch „indirekter“ Lügen
- Meibauers „erweiterte Definition der Lüge“
- Meibauers modifizierte Definition der Behauptung
- Exkurs über die Wahrheitsfunktionalität von Implikaturen
- Meibauers erweiterte Lügendefinition
- Lügentauglichkeit generalisierter und partikulärer Implikaturen
- Lügen mit Tautologie und Ironie
- Lügen mit Tautologie
- Lügen mit Ironie
- Exkurs über Präsuppositionen
- Zwischenfazit
- Vorgetäuschte Sprechakte
- Grundzüge der Illokutionslogik
- Taxonomie, Gelingen und Erfüllen illokutionärer Akte
- Illokutionslogische Relationen
- Vandervekens Generalisierung der Grice'schen Maximen
- Nicht-wörtliche Bedeutung
- Indirekte Sprechakte
- Konversationelle Implikaturen
- Ironie
- Exkurs: Die Simulation der Aufrichtigkeit vs. die Simulation der Unaufrichtigkeit
- Lügen und Täuschungen mit illokutiven Komponenten
- Illokutionslogische Erklärung des „Lügenbegriffs im engeren Sinne“
- Versuchsweise Definition eines „weitesten Lügenbegriffs“
- Vorgetäuschte Sprechakte hinsichtlich illokutiver Komponenten
- Nicht-assertiv gebundene falsche konversationelle Implikaturen
- Präsuppositionen und ihre illokutionslogischen Entsprechungen
- Zwischenfazit und Ausblick
- Empirische Untersuchung zum intuitiven Lügenbegriff
- Linguistische Hypothesen zur Lüge
- Methodik
- Ergebnisse
- Erläuterungen zur Auswertung
- Auswertung der einzelnen Items
- Auswertung der Gruppen
- Diskussion
- Analyse der Kontrollgruppen
- Analyse der Gruppen partikuläre und generalisierte Implikaturen
- Analyse der Gruppe Vorgetäuschte Sprechakte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Lüge in seinen verschiedenen Facetten. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze zur Definition von Lügen zu analysieren und mit empirischen Befunden zu konfrontieren. Dabei wird der Fokus auf die Abgrenzung von Lügen zu verwandten Phänomenen wie Täuschung und falsch implizierten Sprechakten gelegt.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Lüge“
- Analyse verschiedener theoretischer Ansätze zur Lügendefinition
- Untersuchung des Phänomens des „falsch Implizierens“
- Analyse von vorgetäuschten Sprechakten
- Konfrontation theoretischer Ansätze mit empirischen Befunden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Allgegenwärtigkeit von Lügen und Täuschungen im Alltag. Sie verweist auf die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse, um die Komplexität des Phänomens zu erfassen. Es werden verschiedene Beispiele aus Kunst, Film und Politik genannt, welche die omnipräsente Natur von Lügen und Täuschungen illustrieren.
Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es analysiert bestehende Definitionen und Abgrenzungen von Lügen, beleuchtet den Unterschied zwischen Lüge und Täuschung und schafft somit die Basis für die nachfolgenden Kapitel.
Der „Prototyp“ der Lüge: Das Kapitel befasst sich eingehend mit dem Prototypen der Lüge. Es analysiert verschiedene Dimensionen, wie die Glaubensbedingung, die Täuschungsabsicht und die Behauptungsbedingung. Es werden prototypensemantische Ansätze diskutiert, insbesondere die Arbeiten von Coleman und Kays sowie Falkenbergs Ansatz, inklusive der Kritik an diesen. Falkenbergs Definition des „zentralen Falls“ der Lüge und sein Konzept des „Grades der Lügenhaftigkeit“ werden ausführlich erörtert.
Falsch Implizieren: Lügen, obwohl man die Wahrheit behauptet: Dieses Kapitel erforscht das komplexe Phänomen des „falsch Implizierens“, also des Lügens, obwohl die wörtlich geäußerte Aussage wahr ist. Es analysiert konversationelle Implikaturen und verschiedene Definitionsversuche indirekter Lügen, u.a. von Falkenberg und Meibauer. Meibauers erweiterte Definition der Lüge wird detailliert dargestellt und kritisch diskutiert, unter Berücksichtigung von Wahrheitsfunktionalität von Implikaturen, sowie der Lügentauglichkeit generalisierter und partikulärer Implikaturen. Der Einsatz von Tautologie und Ironie im Kontext des Lügens wird ebenfalls untersucht. Ein Exkurs zu Präsuppositionen rundet das Kapitel ab.
Vorgetäuschte Sprechakte: Dieses Kapitel widmet sich vorgetäuschten Sprechakten. Ausgehend von den Grundzügen der Illokutionslogik, werden verschiedene Aspekte wie Taxonomie, Gelingen und Erfüllen illokutionärer Akte analysiert. Die Rolle konversationeller Implikaturen und Ironie wird im Kontext vorgetäuschter Sprechakte untersucht. Die Arbeit von Vanderveken bezüglich der Grice'schen Maximen und die Unterscheidung zwischen der Simulation von Aufrichtigkeit und Unaufrichtigkeit werden detailliert behandelt. Das Kapitel erörtert, wie Lügen und Täuschungen mit illokutiven Komponenten erklärt werden können und definiert einen „weitesten Lügenbegriff“.
Empirische Untersuchung zum intuitiven Lügenbegriff: Das Kapitel beschreibt eine empirische Untersuchung zum intuitiven Lügenbegriff. Es werden die linguistischen Hypothesen, die Methodik und die Ergebnisse der Studie detailliert dargestellt und diskutiert. Die Auswertung der einzelnen Items und Gruppen wird analysiert, insbesondere im Hinblick auf Kontrollgruppen, partikuläre und generalisierte Implikaturen sowie vorgetäuschte Sprechakte. Die Diskussion der Ergebnisse liefert wichtige Erkenntnisse über den intuitiven Umgang mit dem Lügenbegriff.
Schlüsselwörter
Lüge, Täuschung, falsches Implizieren, vorgetäuschte Sprechakte, Illokutionslogik, konversationelle Implikatur, Prototypensemantik, empirische Untersuchung, Wahrheitsfunktionalität, Behauptung, Grice'sche Maximen, Präsuppositionen, Falkenberg, Meibauer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Eine Analyse des Lügenbegriffs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff der Lüge umfassend und differenziert. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Definition von Lügen und konfrontiert diese mit empirischen Befunden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abgrenzung der Lüge von verwandten Phänomenen wie Täuschung und falsch implizierten Sprechakten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und Abgrenzung des Begriffs „Lüge“, Analyse verschiedener theoretischer Ansätze zur Lügendefinition (u.a. Falkenberg, Meibauer, Coleman und Kays), Untersuchung des „falsch Implizierens“, Analyse vorgetäuschter Sprechakte, Konfrontation theoretischer Ansätze mit empirischen Befunden, sowie die Rolle von konversationellen Implikaturen, Präsuppositionen und Illokutionslogik im Kontext des Lügens.
Welche theoretischen Ansätze werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze, darunter prototypensemantische Analysen des englischen Verbs „to lie“, Falkenbergs Definition des „zentralen Falls“ der Lüge und sein Konzept des „Grades der Lügenhaftigkeit“, sowie Meibauers erweiterte Definition der Lüge, die das „falsch Implizieren“ berücksichtigt. Die Rolle der Grice'schen Maximen und Vandervekens Generalisierung dieser werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird das „falsch Implizieren“ behandelt?
Das „falsch Implizieren“, also das Lügen, obwohl die wörtlich geäußerte Aussage wahr ist, wird als komplexes Phänomen untersucht. Die Arbeit analysiert konversationelle Implikaturen, die Wahrheitsfunktionalität von Implikaturen, und die Lügentauglichkeit generalisierter und partikulärer Implikaturen. Der Einsatz von Tautologie und Ironie im Kontext des Lügens wird ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielt die Illokutionslogik?
Die Illokutionslogik spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse vorgetäuschter Sprechakte. Die Arbeit untersucht Aspekte wie Taxonomie, Gelingen und Erfüllen illokutionärer Akte, konversationelle Implikaturen und Ironie im Kontext vorgetäuschter Sprechakte. Es wird erörtert, wie Lügen und Täuschungen mit illokutiven Komponenten erklärt werden können.
Welche empirische Untersuchung wird durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung zum intuitiven Lügenbegriff. Es werden die linguistischen Hypothesen, die Methodik und die Ergebnisse der Studie detailliert dargestellt und diskutiert. Die Auswertung der einzelnen Items und Gruppen wird analysiert, insbesondere im Hinblick auf Kontrollgruppen, partikuläre und generalisierte Implikaturen sowie vorgetäuschte Sprechakte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lüge, Täuschung, falsches Implizieren, vorgetäuschte Sprechakte, Illokutionslogik, konversationelle Implikatur, Prototypensemantik, empirische Untersuchung, Wahrheitsfunktionalität, Behauptung, Grice'sche Maximen, Präsuppositionen, Falkenberg, Meibauer.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und Grundlagenkapitel, gefolgt von Kapiteln zum „Prototyp“ der Lüge, zum „falsch Implizieren“, zu „vorgetäuschten Sprechakten“ und schließlich einer empirischen Untersuchung. Jedes Kapitel enthält Zwischenfazits und ein Ausblick.
- Quote paper
- Eva Lippold (Author), 2013, Lügen, falsch Implizieren und vorgetäuschte Sprechakte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300262