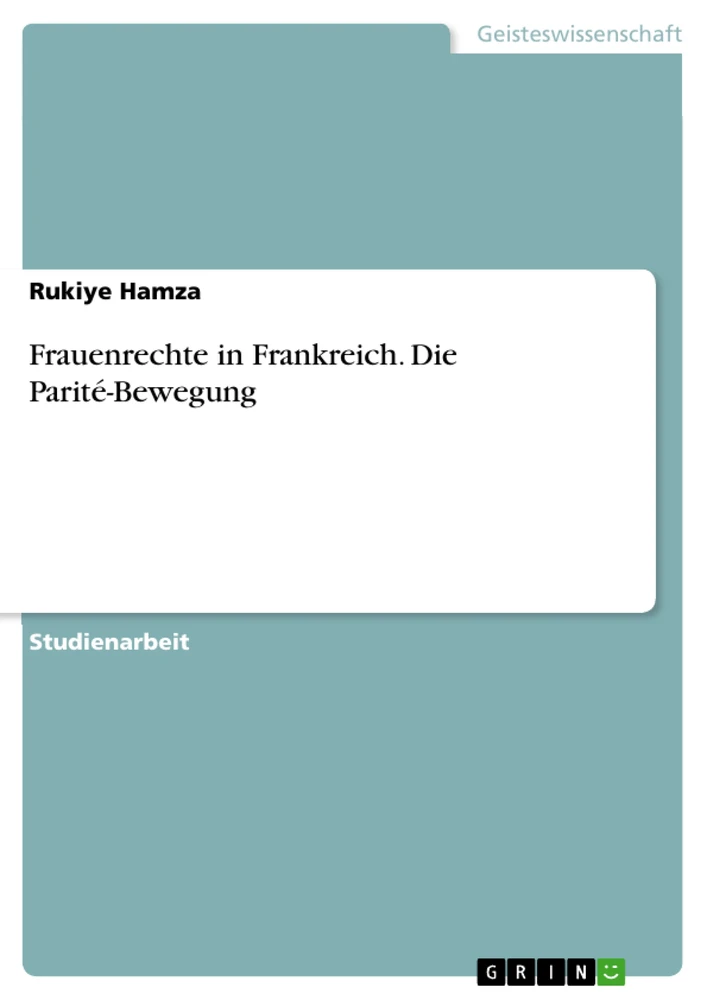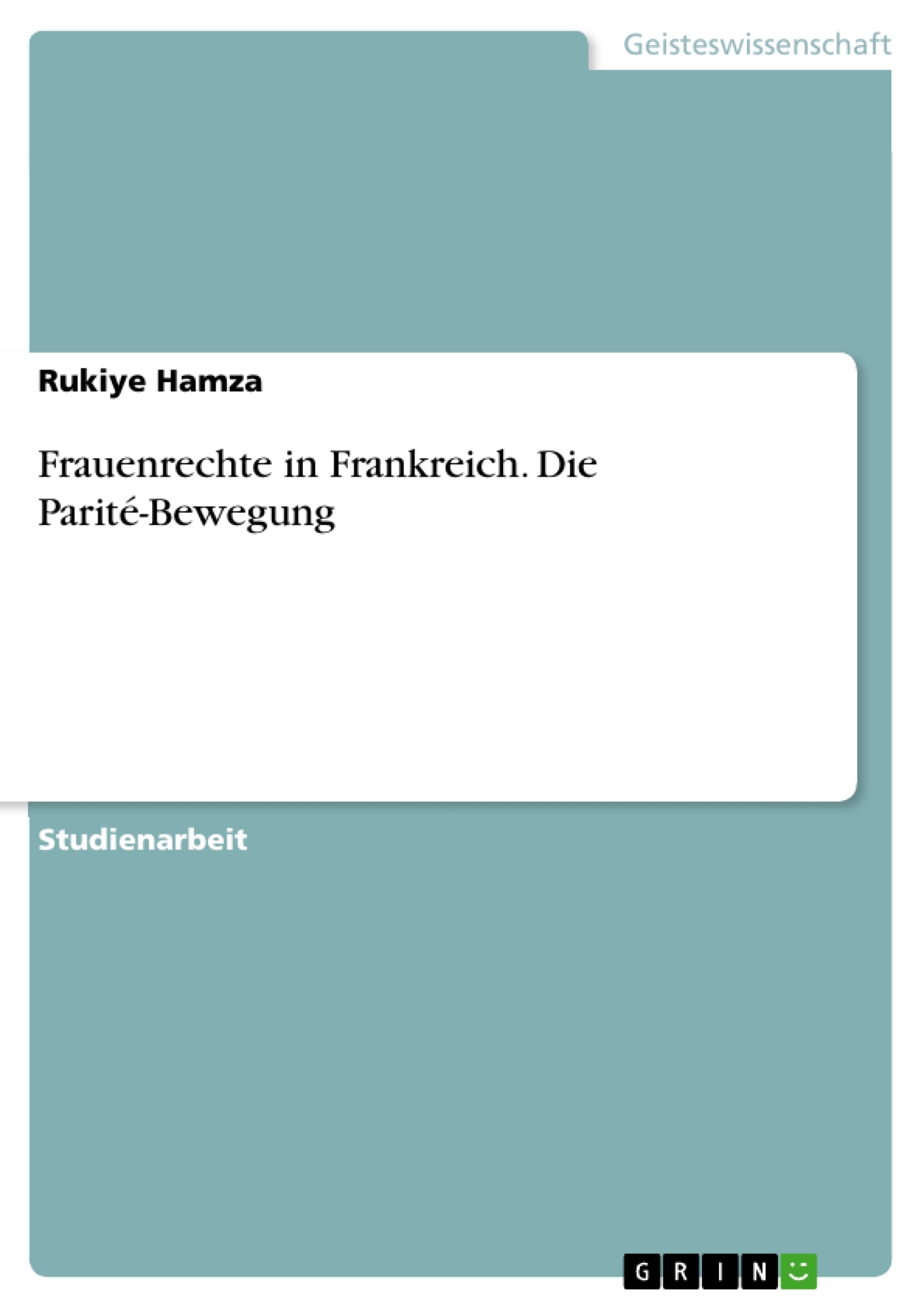Die Parité-Bewegung ist als eine relativ neue Bewegung einzustufen, die sich zu Anfang der 1990er Jahre im Land herauskristallisierte. Während der Französischen Frauenbewegung ein beachtlicher Erfolg zugeschrieben wird, den sie binnen einer Dekade erreicht habe, verschreien Kritiker das Gelingen und explizieren ein Scheitern.
Meine Auseinandersetzung soll sich auf folgende zwei Kernfragen konzentrieren: Warum ist das ursprüngliche Ziel der Gleichstellung gescheitert? Oder: Führt ein Anstieg der weiblichen Vertretung im politischen Wahlkreis zwangsweise zur Gleichstellung?
Dazu gehe ich zunächst auf den Paritätsgedanken ein und formuliere Forderungen und Ziele der Französischen Frauenbewegung. Welchen Schwierigkeiten sie begegnete, illustriere ich an den Kritiken, auf die gestoßen ist. Das Fehlschlagen erläutere ich im Zusammenhang mit der defizitären Zielformulierung und äußere schließlich meinen persönlichen Standpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Parité - Bewegung in Frankreich
- Paritätsgedanke und Forderungen
- Schwierigkeiten und Kritiken
- Das Fehlschlagen der Bewegung
- Die Parité - Bewegung in Frankreich
- Der Paritätsgedanke
- Der Beitrag der Europäischen Kommission, NGOs und Presse
- Kritiker der Parité - Bewegung
- Vertreter der Parité - Bewegung
- Das Scheitern der Französischen Frauenbewegung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Parité-Bewegung in Frankreich und analysiert deren Ziele, Schwierigkeiten und letztendlich das Scheitern. Er untersucht, warum das ursprüngliche Ziel der Gleichstellung nicht erreicht wurde und ob ein Anstieg der weiblichen Vertretung in der Politik automatisch zu Gleichstellung führt.
- Paritätsgedanke und Gleichstellung der Geschlechter
- Die Bedeutung der weiblichen Vertretung in der Politik
- Kritiken und Argumente gegen die Parité-Bewegung
- Defizite der Zielformulierung und das Problem der Nominierungsgleichheit
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Gleichstellung in allen Bereichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil des Textes definiert den Paritätsgedanken und stellt die Ziele der Französischen Frauenbewegung dar. Es wird betont, dass die gleiche Repräsentation beider Geschlechter in der Politik als essentielles Werkzeug für die Emanzipation der Frau angesehen wurde.
- Der zweite Teil beleuchtet die Schwierigkeiten und Kritiken, denen die Parité-Bewegung begegnete. Es wird die Rolle der Europäischen Kommission, NGOs und der Presse bei der Bewusstseinsbildung und der Eskalation des Problems hervorgehoben. Kritiker der Parité-Bewegung argumentieren, dass die Polarität der Geschlechter die Souveränität bedrohe und zu einer zerstörerischen Teilung der Nation führen könne.
- Der dritte Teil beleuchtet die Argumente der Vertreter der Parité-Bewegung, die betonen, dass die Gleichstellung in der Legislative nicht zu einer Zweiteilung der Nation führen kann, da die politischen Stellvertreter das Volk als Einheit vertreten sollten. Es wird jedoch auch die Angst vor einer Teilung bei politischer Gleichberechtigung im Volk angesprochen.
- Der vierte Teil analysiert das Scheitern der Französischen Frauenbewegung und weist auf die einseitige Zielformulierung hin. Es wird kritisiert, dass der Fokus auf die Nominierungsgleichheit lag und die tatsächliche Wahl von Frauen vernachlässigt wurde. Zudem wird betont, dass der Gleichheitsgrundsatz keine quantitative Gleichheit impliziert und die Reform zu ungenügend war, um eine umfassende Förderung in allen Bereichen zu erreichen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: Parité, Gleichstellung, Frauenbewegung, politische Repräsentation, Geschlechtergleichheit, Nominierungsgleichheit, Wahlergebnisse, Macht, Entscheidungsgremien, Teilzeitbeschäftigung, Diskrepanz, Demokratie, soziale Bewegung, Europäische Kommission, NGOs, Presse, Kritiker, Souveränität, Nation, Einheit, Seperation.
- Quote paper
- Rukiye Hamza (Author), 2001, Frauenrechte in Frankreich. Die Parité-Bewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300177