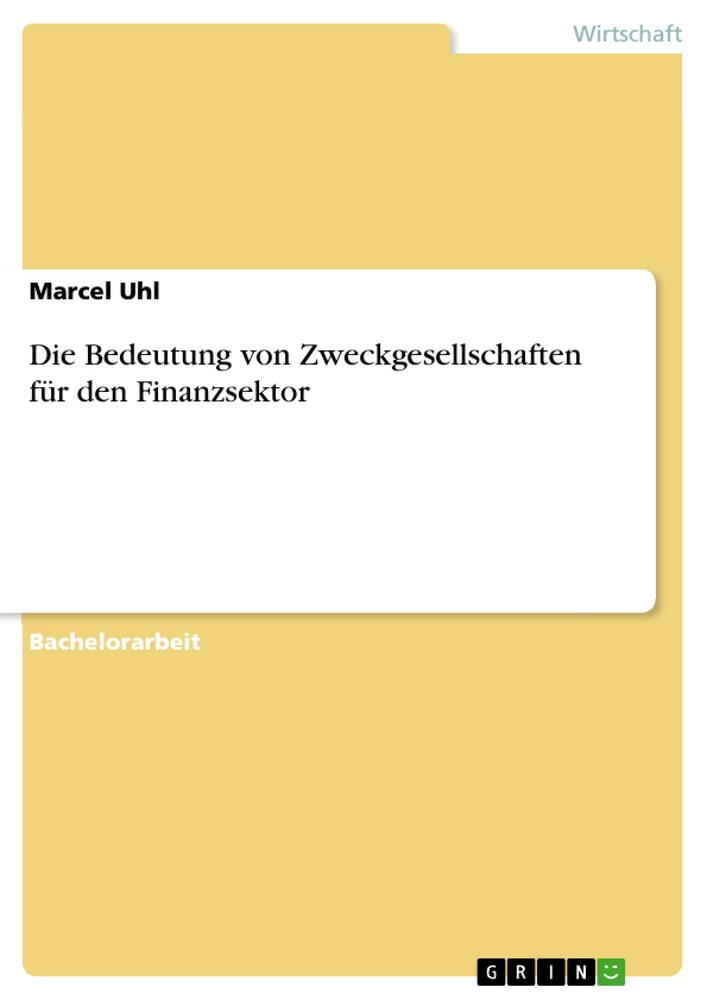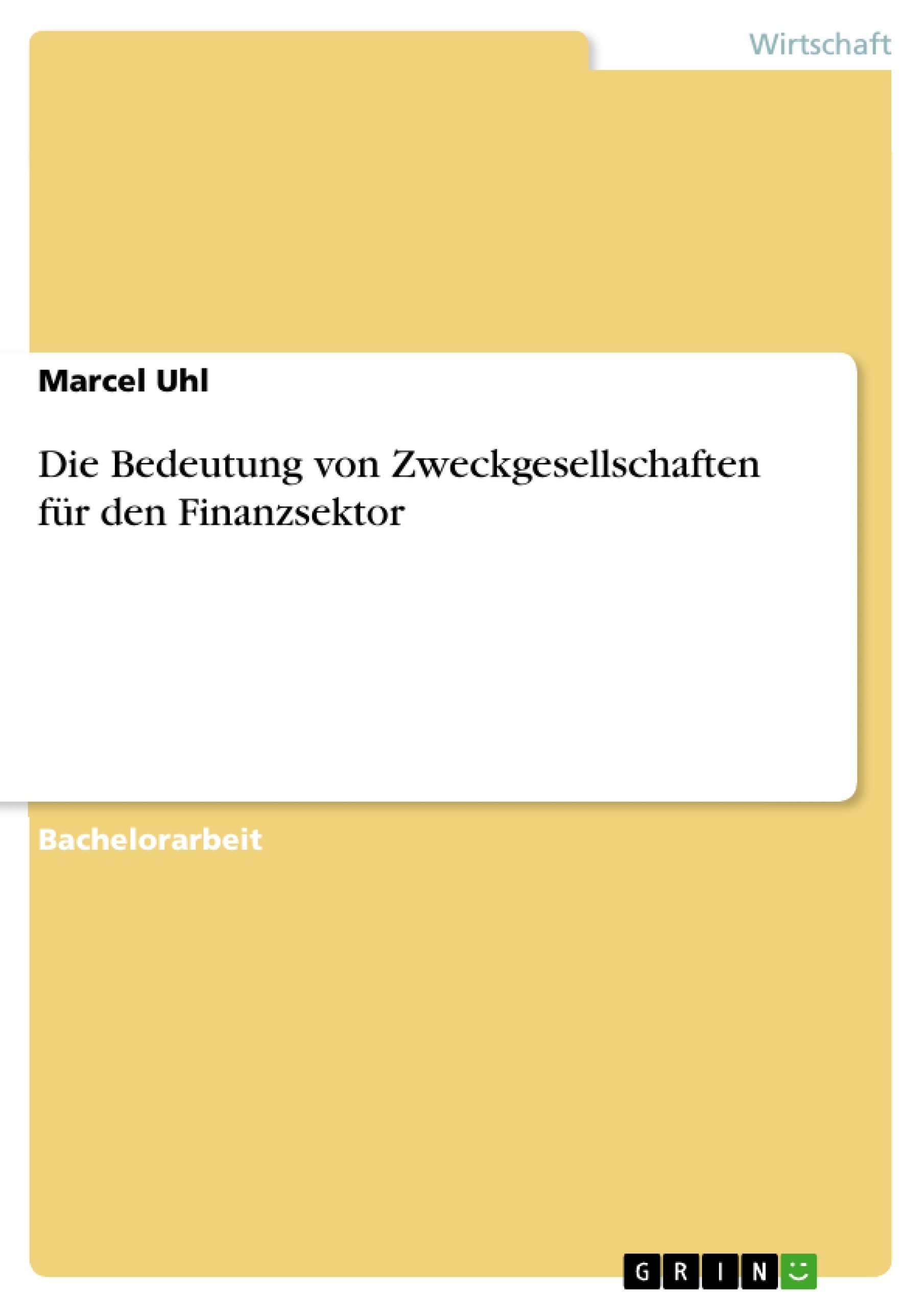Die vorliegende Arbeit soll die Frage beantworten, ob das Verbriefungsgeschäft nach den neuen rechtlichen Restriktionen aus Bankensicht noch seine Zielsetzungen verfolgen kann, insbesondere im Hinblick auf die Wirkungsweise der geplanten Verbriefungsankäufe von EZB und Bundesregierung. Zudem soll durch einen Vergleich der ehemaligen Bilanzierungsrichtlinien analysiert werden, ob die Zweckgesellschaften heute transparenter geworden sind.
Für die Arbeit wurde eine empirische Untersuchung der Jahresabschlüsse deutscher Großbanken durchgeführt. Analysiert wurden hauptsächlich Zielsetzungen und Aktivitäten im Verbriefungsgeschäft. Quantitative Zahlen wurden aufgrund einer uneinheitlichen Berichterstattung und mangelnder Vergleichbarkeit nicht erhoben. Die Ergebnisse befinden sich in Anhang 1.
Um die o.g. Zielsetzung zu erreichen, wird nachfolgend vom Allgemeinen auf das Spezielle geschlossen. Dafür liefert Kapitel 2 grundlegende Informationen zu Zweckgesellschaften, die in Kapital 3 auf den Finanzsektor übertragen werden. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung werden schwerpunktmäßig Verbriefungszweckgesellschaften untersucht. Deren Zielsetzungen, Risiken sowie aufsichtsrechtliche Grenzen werden ausführlich analysiert. Kapitel 4 enthält die nach der Finanzkrise umstrittenen, jedoch seitdem geänderten Bilanzierungsrichtlinien. Berücksichtigt wurden auch die in 2014 neu eingeführten IFRS Standards.
Anschließend werden die theoretischen Grundlagen im Kapitel 5 zusammengeführt. Anhand einer Fallstudie wird
praxisnah untersucht, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen sich die Zielsetzungen der Banken realisieren lassen. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2. Grundlagen
- 2.1. Der Finanzsektor
- 2.2. Zweckgesellschaften
- 2.2.1. Definition
- 2.2.2. Grundstruktur
- 2.2.3. Ausgestaltungsarten
- 3. Zweckgesellschaften im Finanzsektor
- 3.1. Einführung
- 3.2. Grundlagen zu Verbriefungszweckgesellschaften
- 3.2.1. Aufbau
- 3.2.2. Klassifizierung
- 3.2.3. Das Rating
- 3.3. Volumina
- 3.4. Motive und Zielsetzungen
- 3.4.1. Aufsichtsrechtliche Aspekte
- 3.4.2. Arbitrage-Conduits
- 3.4.3. Bilanzpolitische Zielsetzungen
- 3.4.4. Risikomanagement
- 3.4.5. Finanzierungsplattform für Institut und Kunden
- 3.4.6. Sonstige Vorteile
- 3.5. Spezifische Risiken
- 3.5.1. Kategorisierung der Risiken
- 3.5.2. Ursachen und Verlauf der Subprime-Krise
- 3.5.3. Schlussfolgerungen
- 4. Die Konsolidierung von ABS-Zweckgesellschaften
- 4.1. HGB vor BilMoG
- 4.2. HGB i.d.F. nach BilMoG
- 4.2.1. Grundlegendes
- 4.2.2. Mehrheit der Risiken bei ABS-Transaktionen
- 4.3. IFRS bis 31.12.2012
- 4.4. IFRS ab 01.01.2013
- 4.4.1. Grundlegendes
- 4.4.2. Zweck und Ausgestaltung des investee
- 4.4.3. Relevante Aktivitäten
- 4.4.4. Lenkungsmacht (Power)
- 4.4.5. Variable Rückflüsse (Variable returns)
- 4.4.6. Link between power and variable returns und delegated power
- 4.4.7. Erweiterung der Anhangangaben
- 4.5. Beherrschungskriterien im Vergleich
- 4.6. Probleme bei der Konsolidierung
- 5. Fallstudie
- 5.1. Einführung
- 5.2. Aufsichtsrechtliche Vorgaben
- 5.3. Aufbau der Verbriefungsplattform
- 5.4. Durchführung der Verbriefung
- 5.5. Kritische Würdigung
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Zweckgesellschaften, insbesondere im Kontext des Finanzsektors. Das Ziel ist es, die Funktionsweise, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Risiken dieser Strukturen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert dabei auch die Auswirkungen auf die Bilanzierung und das Risikomanagement.
- Funktionsweise von Zweckgesellschaften im Finanzsektor
- Rechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte
- Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit Zweckgesellschaften
- Bilanzierung und Konsolidierung von Zweckgesellschaften
- Fallstudie zur Veranschaulichung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein. Es beschreibt die Problemstellung, die sich aus der zunehmenden Bedeutung von Zweckgesellschaften im Finanzsektor ergibt, und skizziert die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der Strukturen und Auswirkungen von Zweckgesellschaften auf die Stabilität des Finanzsystems.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Zweckgesellschaften im Finanzsektor. Es beschreibt den Finanzsektor selbst, definiert Zweckgesellschaften und erläutert deren grundlegende Struktur und verschiedene Ausgestaltungsarten. Der Abschnitt bildet die Basis für die nachfolgende Analyse der Rolle von Zweckgesellschaften im Finanzwesen. Die Definitionen und Strukturen legen den Grundstein für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge, die in späteren Kapiteln behandelt werden.
3. Zweckgesellschaften im Finanzsektor: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung von Zweckgesellschaften im Finanzsektor, insbesondere im Bereich der Verbriefung. Es analysiert den Aufbau und die Klassifizierung von Verbriefungszweckgesellschaften, untersucht die damit verbundenen Volumina und Motive (aufsichtsrechtliche Aspekte, Arbitrage, Bilanzpolitik, Risikomanagement, Finanzierungsplattformen), und schließlich auch die spezifischen Risiken. Die Subprime-Krise dient als Beispiel für die potenziellen Gefahren. Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse der komplexen Interaktionen zwischen Zweckgesellschaften und dem Finanzsektor.
4. Die Konsolidierung von ABS-Zweckgesellschaften: Dieses Kapitel befasst sich mit der Konsolidierung von ABS-Zweckgesellschaften unter verschiedenen Rechnungslegungsstandards (HGB vor und nach BilMoG, IFRS). Es analysiert die jeweiligen Beherrschungskriterien und die damit verbundenen Probleme. Die Kapitel vergleicht die unterschiedlichen Regelungen und verdeutlicht deren Auswirkungen auf die Transparenz und die Risikobewertung im Finanzwesen. Die detaillierte Betrachtung der unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards unterstreicht die Herausforderungen bei der Konsolidierung dieser komplexen Strukturen.
5. Fallstudie: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, die die Anwendung und die Auswirkungen von Zweckgesellschaften im Finanzsektor anhand eines konkreten Beispiels veranschaulicht. Es analysiert den Aufbau einer Verbriefungsplattform, die Durchführung der Verbriefung und bietet eine kritische Würdigung des Prozesses. Die Fallstudie dient dazu, die theoretischen Erkenntnisse praktisch zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Zweckgesellschaften, Finanzsektor, Verbriefung, Asset-Backed Securities (ABS), Bilanzierung, Konsolidierung, Risikomanagement, Aufsichtsrecht, BilMoG, IFRS, HGB, Subprime-Krise, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Zweckgesellschaften im Finanzsektor
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Zweckgesellschaften, insbesondere im Finanzsektor. Sie beleuchtet Funktionsweise, rechtliche Rahmenbedingungen und Risiken dieser Strukturen sowie deren Auswirkungen auf Bilanzierung und Risikomanagement. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbriefung und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Funktionsweise von Zweckgesellschaften im Finanzsektor, rechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte, Risiken und Herausforderungen, Bilanzierung und Konsolidierung von Zweckgesellschaften (unter HGB und IFRS, vor und nach BilMoG), sowie eine Fallstudie zur Veranschaulichung der Thematik. Die Subprime-Krise wird als Beispiel für potenzielle Gefahren analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise. Kapitel 2 (Grundlagen) liefert theoretische Grundlagen zu Zweckgesellschaften und dem Finanzsektor. Kapitel 3 (Zweckgesellschaften im Finanzsektor) analysiert die Anwendung von Zweckgesellschaften im Finanzsektor, insbesondere bei der Verbriefung, inklusive Volumina, Motive und spezifischer Risiken. Kapitel 4 (Konsolidierung von ABS-Zweckgesellschaften) befasst sich mit der Konsolidierung unter verschiedenen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS) und den damit verbundenen Problemen. Kapitel 5 (Fallstudie) präsentiert ein konkretes Beispiel zur Veranschaulichung der Thematik. Kapitel 6 (Fazit und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Rechnungslegungsstandards werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Konsolidierung von ABS-Zweckgesellschaften unter HGB (vor und nach BilMoG) und IFRS (bis 31.12.2012 und ab 01.01.2013). Die Unterschiede in den Beherrschungskriterien und deren Auswirkungen auf die Transparenz und Risikobewertung werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Subprime-Krise in der Arbeit?
Die Subprime-Krise dient als Beispiel für die potenziellen Gefahren und Risiken, die mit der Anwendung von Zweckgesellschaften im Finanzsektor verbunden sind, und wird im Kapitel 3 genauer untersucht.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Risiken von Zweckgesellschaften im Finanzsektor zu beleuchten und die Auswirkungen auf die Bilanzierung und das Risikomanagement zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Zweckgesellschaften, Finanzsektor, Verbriefung, Asset-Backed Securities (ABS), Bilanzierung, Konsolidierung, Risikomanagement, Aufsichtsrecht, BilMoG, IFRS, HGB, Subprime-Krise, Fallstudie.
- Quote paper
- Marcel Uhl (Author), 2014, Die Bedeutung von Zweckgesellschaften für den Finanzsektor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300052