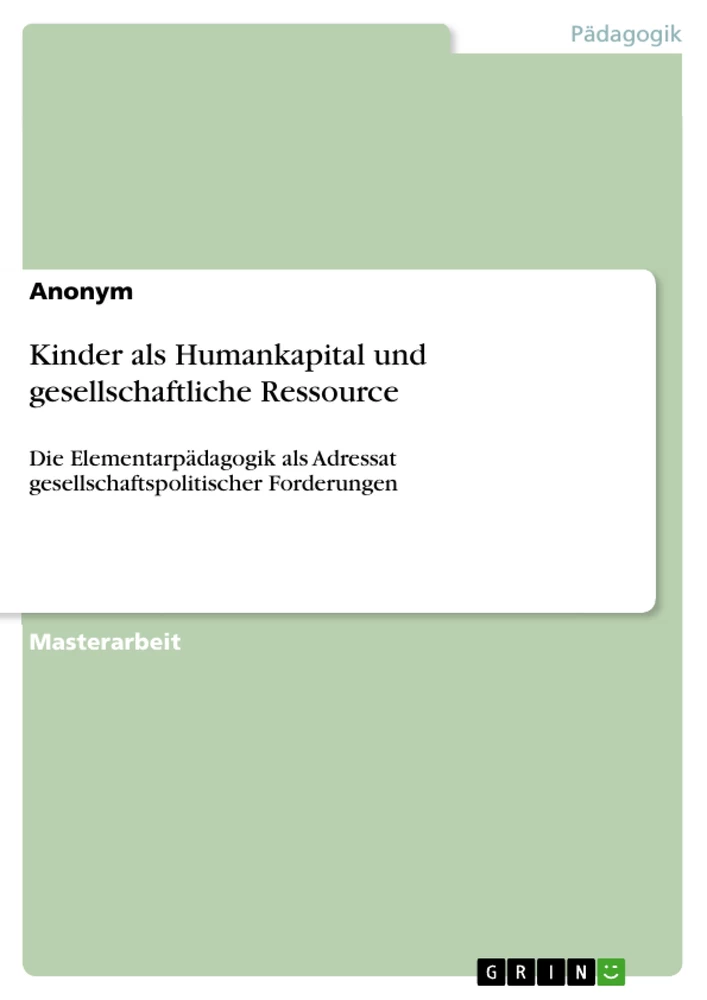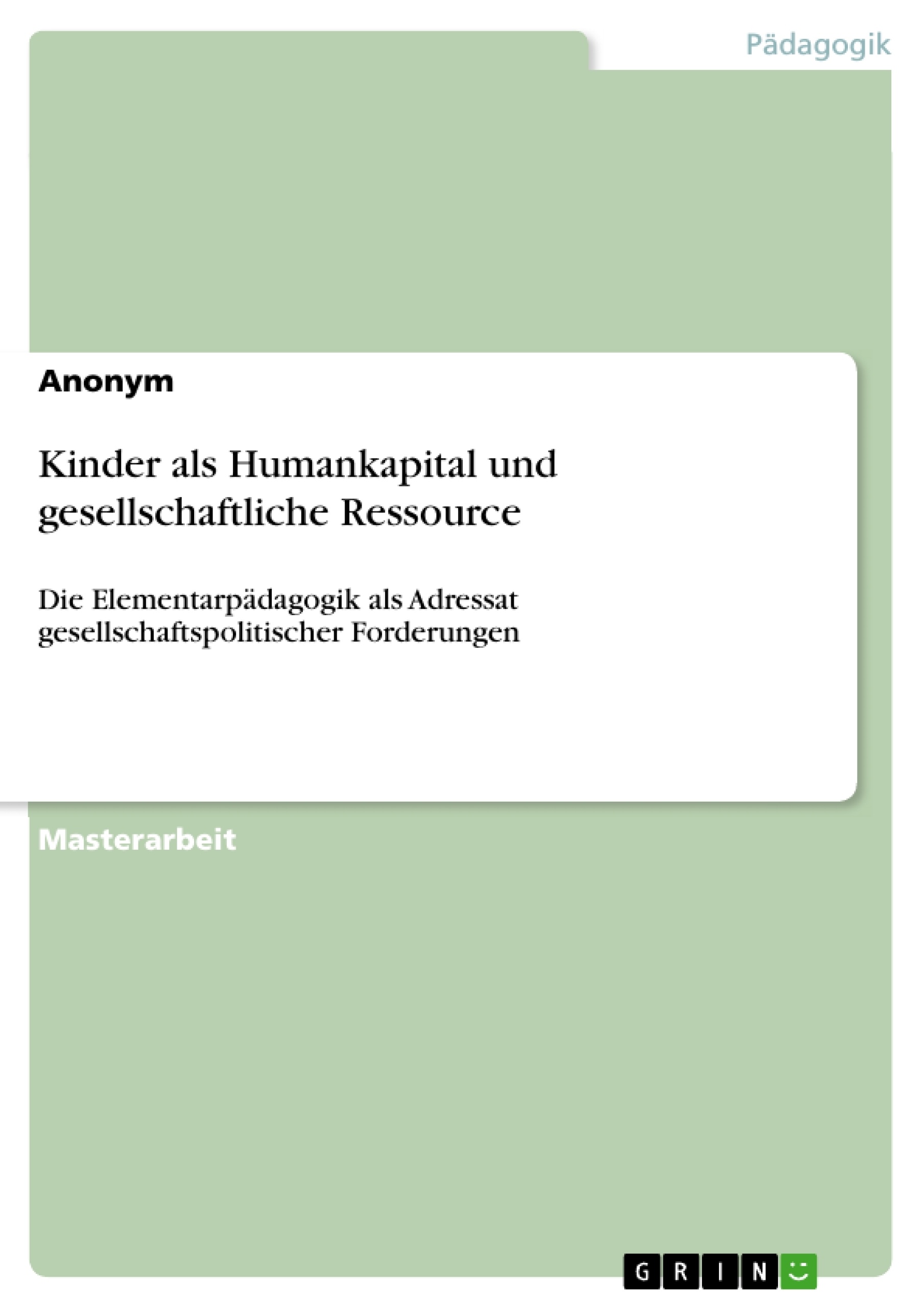Seit einigen Jahren finden in der Bundesrepublik Deutschland und anderen entwickelten Ländern des Westens neue wohlfahrtspolitische Konzepte und Leitbilder Eingang in sozialpolitische Entscheidungen der jeweiligen Regierungen. Sozialpolitische Umstrukturierungen werden seitdem anhand der Begriffe „aktivierender Staat“ und „Sozialinvestitionsstaat“ vorangetrieben, die maßgeblich auf die neoliberale Entwicklung des Sozialstaats zurückzuführen sind. Im Zuge dessen kommt es zur Unterwanderung von Sozialpolitik durch Neoliberalismus (vgl. Olk 2007, S. 43).
Ein aktivierender Sozialstaat investiert auf effiziente Weise in das „Humankapital“ von Menschen, mit dem Ziel, soziale Renditen in Form von ökonomischen Erträgen zu erwirtschaften sowie in der Zukunft liegende gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen. Die Situation von Kindern, alleinerziehenden Eltern und Familien bleibt davon nicht unbeeinflusst. Da frühzeitige Investitionen in das „Humankapital“ am wirksamsten sind, erhält insbesondere die frühe Kindheit einen Bedeutungszuwachs (vgl. ebd., S. 44f.). Aus ökonomischer Sicht gelten Kinder aufgrund ihres „Humankapitals“ als gesellschaftliche Ressource, in das es sich zu investieren lohnt.
Im Zentrum der Masterarbeit steht folgende These:
Der neoliberale sozialpolitische Kurs geht mit einer Ökonomisierung früher Kindheit einher und erhebt Kinder und frühe Bildung zu einer gesellschaftlichen Ressource. Die Aufmerksamkeit bezieht sich allerdings nicht auf den Eigenwert von Bildung, sondern von Interesse sind ökonomisch verwertbare Fähigkeiten, die das Humankapital von Kindern erhöhen. In Folge dessen werden gesellschaftspolitische Forderungen an die Elementarpädagogik adressiert, die den Alltag grundlegend verändern und frühkindliche Bildung für das Ziel der Humankapitalbildung instrumentalisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialpolitik im Zeitalter von Neoliberalismus
- Die neoliberale Ideologie und ihr Menschenbild
- Familien im aktivierenden Sozialstaat: Fördern und Fordern
- Die Produktion sozialer Ungleichheit
- Die gesellschaftliche Bedeutung der (frühen) Kindheit: Kinder als gesellschaftliche Ressource
- Kinder als Humankapital: Der ökonomische Nutzen von Kindern
- Die Umdeutung frühkindlicher Bildung
- Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und förderliche Fähigkeiten als Grundstein für lebenslanges Lernen
- Die Optimierung (früher) Kindheit
- Der Befähigungsansatz
- Die Bildungseinrichtung Kindertagesstätte als Adressat gesellschaftspolitischer Forderungen
- Strukturwandel in der Elementarpädagogik nach PISA
- Kinder unter Beobachtung: Diagnostik und Fördermaßnahmen
- Die Kompensation von (Entwicklungs-)Risiken
- Die Förderung kognitiver Fähigkeiten und nicht-kognitiver Fähigkeiten am Beispiel naturwissenschaftlich-technischer Bildung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Einfluss neoliberaler Paradigmen auf die Gestaltung der Sozialpolitik und die Begründung dieser Entwicklung durch wirtschaftlich orientierte Interessenvertreter_innen. Im Fokus steht die Rolle von Kindern als „Humankapital“ und gesellschaftliche Ressource im Kontext des aktivierenden Sozialstaats.
- Die neoliberale Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Sozialpolitik
- Die Bedeutung der frühen Kindheit im Kontext des Humankapitals
- Die Umdeutung von Bildung unter ökonomischen Gesichtspunkten
- Der Einfluss von PISA auf die Elementarpädagogik
- Die Rolle der Kindertagesstätte als Instrument der sozialpolitischen Steuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, dass die neoliberale Ausrichtung des Sozialstaats einen hohen Einfluss auf die Gestaltung des Sozialen hat. Dabei wird der Begriff des „Humankapitals“ im Kontext von Kindern und der frühkindlichen Bildung als entscheidender Faktor für die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung herausgestellt.
Kapitel 2 widmet sich der neoliberalen Ideologie und ihren Auswirkungen auf die Sozialpolitik. Es werden die zentralen Elemente des neoliberalen Menschenbildes sowie die Konzepte des aktivierenden und Sozialinvestitionsstaats erläutert.
Kapitel 3 beleuchtet die gesellschaftliche Bedeutung der frühen Kindheit und die Rolle von Kindern als gesellschaftliche Ressource. Es wird der ökonomische Nutzen von Kindern im Kontext des Humankapitals dargestellt und die Umdeutung von Bildung unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Bildungseinrichtung Kindertagesstätte als Adressat gesellschaftspolitischer Forderungen. Es werden die Auswirkungen der PISA-Studien auf den Strukturwandel in der Elementarpädagogik und die Implementierung von Bildungsplänen sowie die Rolle von Diagnostik und Förderung in der Kindertagesstätte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Neoliberalismus, Sozialpolitik, Humankapital, gesellschaftliche Ressource, frühe Kindheit, Bildung, Elementarpädagogik, Kindertagesstätte, PISA, Diagnostik, Förderung, soziale Ungleichheit, aktivierender Staat, Sozialinvestitionsstaat.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Kinder als Humankapital und gesellschaftliche Ressource, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299965