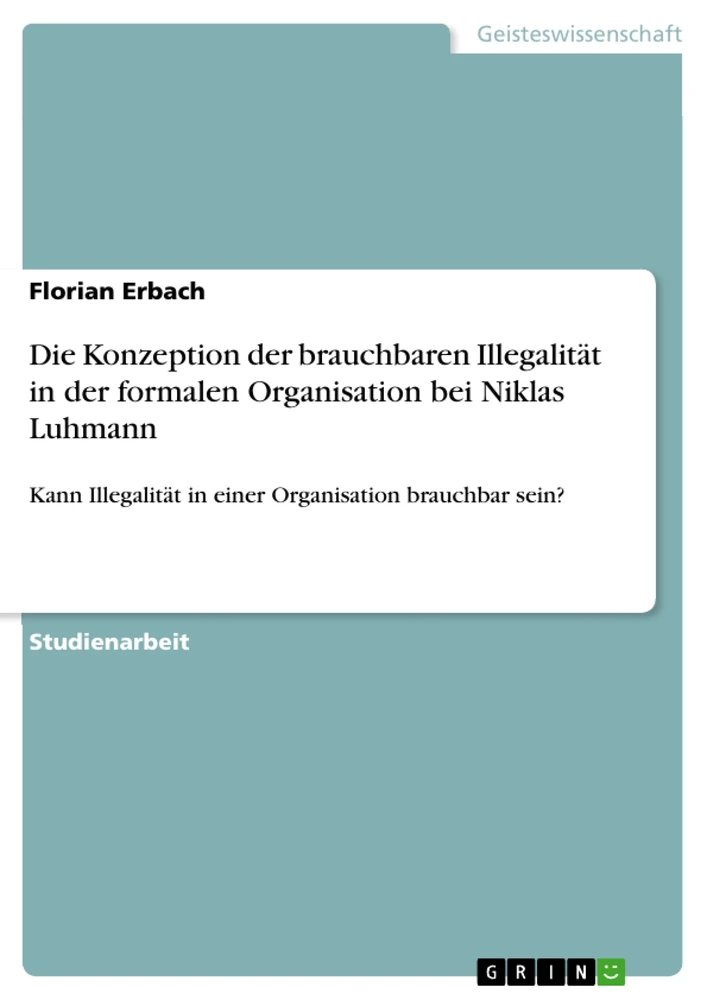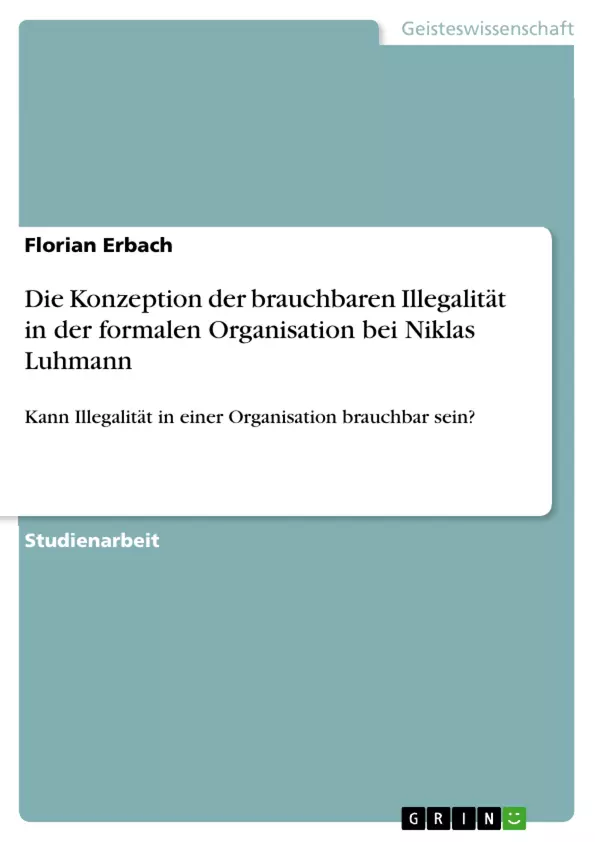In der Rückschau betrachtet, hat wohl jeder Mensch sich schon einmal entgegen einer aufgestellten Norm verhalten. Sei es als Kind einen Lutscher aus einer Mutprobe heraus zu klauen, kein Ticket in der Straßenbahn zu lösen oder bei Rot über die Ampel zu gehen. Gewiss sind dies Bagatelle und doch wird hieran deutlich, dass abweichendes, entgegen der Norm gerichtetes Verhalten, zu unserem Leben dazugehört.
Wenn wir unseren Blick nun auf Firmen, Institute, Vereine, Behörden und eine Vielzahl weiterer Formen von Organisationen richten, wird deutlich, dass diese sich durch viele Vorschriften, Anweisungen und durch einen hohen Grad an Formalisierung auszeichnen. Die Regeln, Vorschriften und Normen sind festgeschrieben (formalisiert) und es wird von der Organisation erwartet, dass sich jedes Mitglied daran hält. Gleichwohl gibt es auch hier Abweichungen. Aber ist es überhaupt möglich, Abweichungen zu verhindern? Und viel wichtiger: Ist es überhaupt wünschenswert, alles Informelle zu unterbinden?
Bei genauer Betrachtung von Abläufen innerhalb von Organisationen zeichnet sich nämlich ein sehr ambivalentes Bild. Trotz der oftmals sehr strikten Vorgaben und Anweisungen, werden bestimmte Regeln gar nicht befolgt oder so ausgelegt, dass sie gar nicht zu Anwendung kommen. Auch entwickeln sich zum Teil informelle Strukturen, die mit den von der jeweiligen Organisation aufgestellten Anweisungen nichts zu tun haben und der Organisation scheinbar zum Teil sogar direkt entgegenwirken. Im deutschen Sprachgebrauch - beziehungsweise im Behördenjargon - hat sich hier vor allem der Begriff des „kurzen Dienstweges“ entwickelt. Damit wird unter anderem die Auslassung oder Umgehung von Dienstanweisungen beschrieben. Vor allem in der DDR war auch der geflügelte Satz „unter der Ladentheke kaufen“ nicht wegzudenken, indem bestimmte Waren oftmals für einen Gefallen oder gegen andere Waren – entgegen der Norm – zurückgehalten wurden und unter der Ladentheke gehandelt wurden. Mit diesen Alltagsgeschichten wird deutlich, dass das abweichende Verhalten nicht wegzudenken ist und sogar in den Sprachgebrauch übergegangen ist.
Die interessante Frage ist nun, was das für ein Unternehmen, eine Verwaltung und schließlich für die formale Organisation bedeutet? Und kann das abweichende, das illegale, das nicht der Norm entsprechende Handeln, vielleicht sogar auch positive Komponente haben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die formale Organisation – Formalität, Informalität und brauchbare Illegalität?
- Die formale Organisation und Formalität
- Informalität und brauchbare Illegalität
- Brauchbare Illegalität am Beispiel der Organisationsberatung in einem Unternehmen
- Ausgangspunkt: Das Unternehmen und die Methode der Empirie
- Brauchbare Illegalität bei TFM
- Was bewirkte die Organisationsberatung bei TFM?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob Illegalität in einer formalen Organisation nützlich sein kann, und untersucht die Konzeption der „brauchbaren Illegalität“ von Niklas Luhmann. Ziel ist es, die Vorteile und Prozesse der Illegalität in Organisationen aufzuzeigen und zu analysieren, wann diese „brauchbar“ wird und welche Auswirkungen sie auf die Organisation hat.
- Die Bedeutung von Formalität und Informalität in formalen Organisationen
- Die Konzeption der „brauchbaren Illegalität“ von Niklas Luhmann
- Vorteile und Prozesse der Illegalität in Organisationen
- Die Frage, wann Illegalität „brauchbar“ wird
- Die Auswirkungen von Illegalität auf die Organisation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt die Frage nach der Bedeutung von abweichendem Verhalten in formalen Organisationen, insbesondere in Bezug auf die von Luhmann entwickelte Konzeption der „brauchbaren Illegalität“. Der Autor möchte untersuchen, ob Illegalität in Organisationen positive Auswirkungen haben kann und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Die formale Organisation – Formalität, Informalität und brauchbare Illegalität?
Dieses Kapitel stellt die systemtheoretische Sichtweise von Luhmann auf Organisationen vor, wobei die Konzepte von Formalität, Informalität und „brauchbarer Illegalität“ im Vordergrund stehen. Der Autor erläutert, dass auch in formalen Organisationen Abweichungen von Regeln und Normen auftreten und diese nicht immer negativ bewertet werden müssen.
Brauchbare Illegalität am Beispiel der Organisationsberatung in einem Unternehmen
In diesem Kapitel wird die Konzeption der „brauchbaren Illegalität“ anhand eines Praxisbeispiels - einer Organisationsberatung in einem Unternehmen - konkretisiert. Der Autor beleuchtet den Prozess der Organisationsberatung und zeigt auf, welche Formen von Illegalität in diesem Zusammenhang vorkommen und welche Auswirkungen sie haben können.
Schlüsselwörter
Formalität, Informalität, brauchbare Illegalität, Niklas Luhmann, Systemtheorie, Organisation, Organisationsberatung, Abweichendes Verhalten, Regeln, Normen, Unternehmen, Praxisbeispiel, Vorteile, Prozesse, Auswirkungen.
- Quote paper
- Florian Erbach (Author), 2013, Die Konzeption der brauchbaren Illegalität in der formalen Organisation bei Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299893