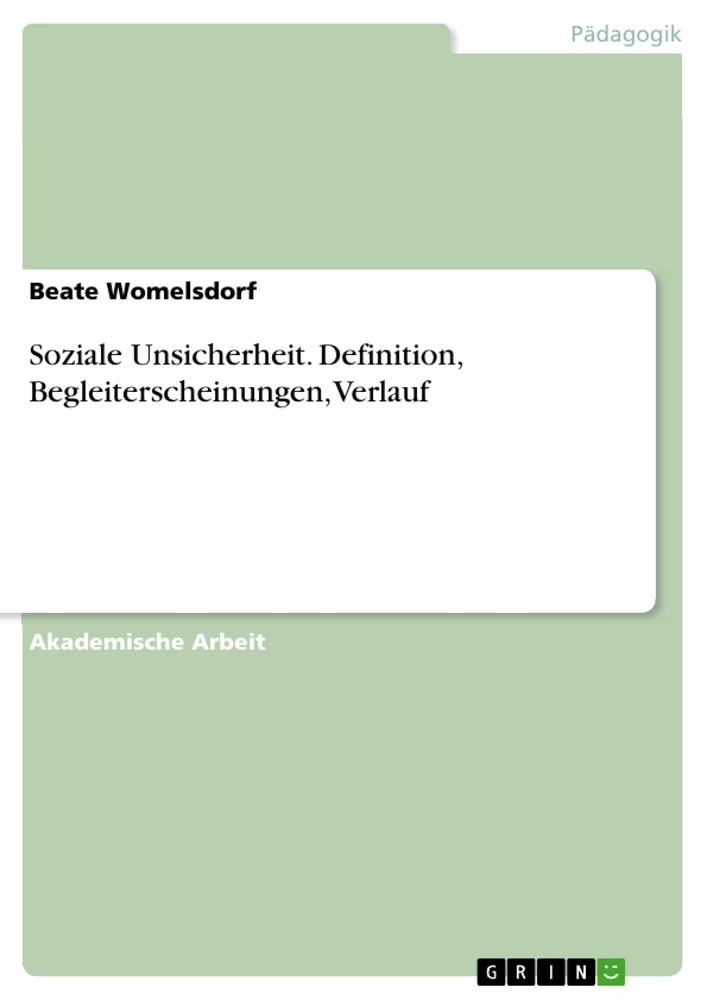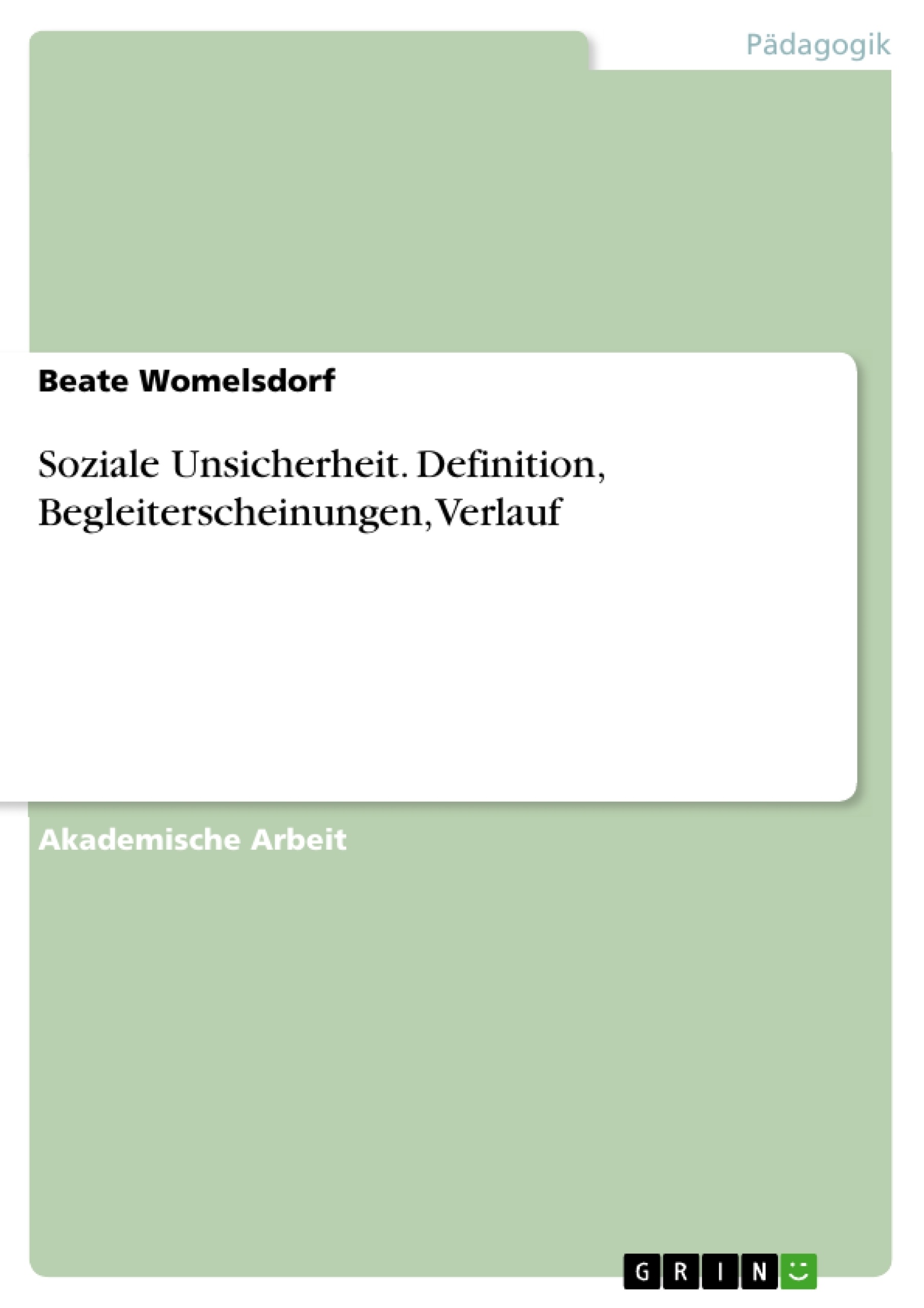„Soziale Unsicherheit ist gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit anderer (bzw. Bewertungsangst in sozialen Situationen) und Vermeidung sozialer Situationen.“
Soziale Unsicherheit ist demzufolge ein Sammelbegriff für beeinträchtigtes und unangemessenes Sozialverhalten aufgrund verschiedener Ängste, das besonders an der gestörten, zwischenmenschlichen Interaktion erkennbar wird , was im Folgenden näher erläutert werden soll:
Sozial unsichere Kinder fallen im Alltag zwar nicht auf, da sie dem ersten Eindruck nach pflegeleicht zu sein scheinen, in der Interaktion mit anderen zeigen sie jedoch eine übermäßige Schüchternheit, Ängstlichkeit, Unsicherheit sowie Vermeidungsverhalten. Dennoch können sie Kindergarten und Schule durchlaufen, ohne dass irgendjemand merkt, dass sie Ängste oder Probleme haben. Sie können, vor allem im schriftlichen Bereich, den Leistungsanforderungen genügen und gelten schlichtweg als still und zurückhaltend.
Aus dem Inhalt:
- Definition;
- Erscheinungsbild;
- Begleiterscheinungen und Folgen;
- Theorie der erlernten Hilflosigkeit als Erklärungsgrundlage;
- Verlauf und Stabilität;
- Ziele eines Trainings bei sozialer Unsicherheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hintergrundinformationen zu „Sozialer Unsicherheit“
- 2.1 Definition und Erscheinungsbild
- 2.2 Begleiterscheinungen und Folgen
- 2.3 Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit als Erklärungsgrundlage
- 2.4 Verlauf und Stabilität
- 2.5 Aufrechterhaltung durch soziale Angst
- 3 Ziele eines Trainings bei sozialer Unsicherheit und Evaluationskriterien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Thema soziale Unsicherheit bei Kindern. Ziel ist es, den oft großen Leidensdruck betroffener Kinder aufzuzeigen und die Leser für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Arbeit soll dazu beitragen, dass das Übergehen solcher Probleme als unangemessen erkannt wird.
- Definition und Erscheinungsbild sozialer Unsicherheit
- Begleiterscheinungen und Folgen sozialer Unsicherheit
- Mögliche Erklärungsgrundlagen für soziale Unsicherheit
- Verlauf und Stabilität sozialer Unsicherheit
- Der Einfluss sozialer Angst auf die Aufrechterhaltung sozialer Unsicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung hebt die oft unbemerkte soziale Unsicherheit von Kindern in der Schule hervor. Sie betont die Notwendigkeit, dieses Problem nicht zu übersehen und die damit verbundenen Leiden der Kinder zu berücksichtigen. Die Autorin beschreibt ihre persönliche Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen mit sozialer Unsicherheit.
2 Hintergrundinformationen zu „Sozialer Unsicherheit“: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Konzepts „soziale Unsicherheit“. Es definiert den Begriff, beschreibt das Erscheinungsbild sozial unsicherer Kinder (z.B. Schüchternheit, Vermeidungsverhalten, Blickkontaktunfähigkeit) und diskutiert die damit verbundenen Folgen. Es werden sowohl verbale als auch nonverbale Verhaltensweisen detailliert erläutert und die Vielfältigkeit der Ausprägungen hervorgehoben. Das Kapitel veranschaulicht, dass soziale Unsicherheit nicht immer offensichtlich ist und von Eltern oft unbemerkt bleiben kann.
2.2 Begleiterscheinungen und Folgen: Dieser Abschnitt behandelt die psychischen und physischen Begleiterscheinungen sozialer Unsicherheit. Depressive Symptome, vegetative Reaktionen (Erröten, Zittern, Magen-Darm-Probleme) und ein niedrigerer Selbstwert werden als häufige Folgen beschrieben. Die Autorin betont, wie soziale Unsicherheit den Aufbau altersgerechter Kompetenzen verhindert, zu sozialer Isolation führt und die Lebensqualität der betroffenen Kinder erheblich beeinträchtigt. Der internalisierende Charakter dieser Probleme wird ebenfalls beleuchtet, wodurch das Leid oft nur vom Kind selbst und eventuell den Eltern wahrgenommen wird.
Schlüsselwörter
Soziale Unsicherheit, Angst, Vermeidungsverhalten, Schüchternheit, depressive Symptome, vegetative Reaktionen, Selbstwert, Sozialkompetenz, Kindheit, Schule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Unsicherheit bei Kindern
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema soziale Unsicherheit bei Kindern. Sie beleuchtet den Leidensdruck betroffener Kinder und sensibilisiert die Leser für dieses oft übersehene Problem.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und das Erscheinungsbild sozialer Unsicherheit, die damit verbundenen Begleiterscheinungen und Folgen (z.B. depressive Symptome, vegetative Reaktionen, niedriger Selbstwert), mögliche Erklärungsgrundlagen (wie die Theorie der erlernten Hilflosigkeit), den Verlauf und die Stabilität der sozialen Unsicherheit sowie den Einfluss sozialer Angst auf deren Aufrechterhaltung. Besonders wird auf die oft unbemerkte soziale Unsicherheit von Kindern in der Schule eingegangen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, einen Abschnitt mit Hintergrundinformationen zu sozialer Unsicherheit (inkl. Definition, Erscheinungsbild, Folgen, Erklärungsgrundlagen und Einfluss sozialer Angst), einen Abschnitt zu den Zielen eines Trainings bei sozialer Unsicherheit und Evaluationskriterien, sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen.
Welche Folgen hat soziale Unsicherheit bei Kindern?
Soziale Unsicherheit kann zu verschiedenen psychischen und physischen Folgen führen, darunter depressive Symptome, vegetative Reaktionen (Erröten, Zittern, Magen-Darm-Probleme), ein niedriger Selbstwert, soziale Isolation und die Verhinderung des Aufbaus altersgerechter Kompetenzen. Die Lebensqualität der betroffenen Kinder wird erheblich beeinträchtigt.
Wie wird soziale Unsicherheit erklärt?
Die Arbeit erwähnt die Theorie der erlernten Hilflosigkeit als eine mögliche Erklärungsgrundlage für soziale Unsicherheit. Es wird auch der Einfluss sozialer Angst auf die Aufrechterhaltung der Unsicherheit diskutiert.
Werden in der Arbeit konkrete Beispiele genannt?
Die Arbeit beschreibt das Erscheinungsbild sozial unsicherer Kinder (z.B. Schüchternheit, Vermeidungsverhalten, Blickkontaktunfähigkeit) und erläutert sowohl verbale als auch nonverbale Verhaltensweisen detailliert. Die Vielfältigkeit der Ausprägungen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Soziale Unsicherheit, Angst, Vermeidungsverhalten, Schüchternheit, depressive Symptome, vegetative Reaktionen, Selbstwert, Sozialkompetenz, Kindheit, Schule.
Welche Ziele verfolgt die Autorin?
Die Autorin möchte den oft großen Leidensdruck betroffener Kinder aufzeigen und die Leser für dieses Thema sensibilisieren. Sie möchte dazu beitragen, dass das Übergehen solcher Probleme als unangemessen erkannt wird. Die persönliche Motivation der Autorin basiert auch auf eigenen Erfahrungen mit sozialer Unsicherheit.
- Quote paper
- Beate Womelsdorf (Author), 2006, Soziale Unsicherheit. Definition, Begleiterscheinungen, Verlauf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299748