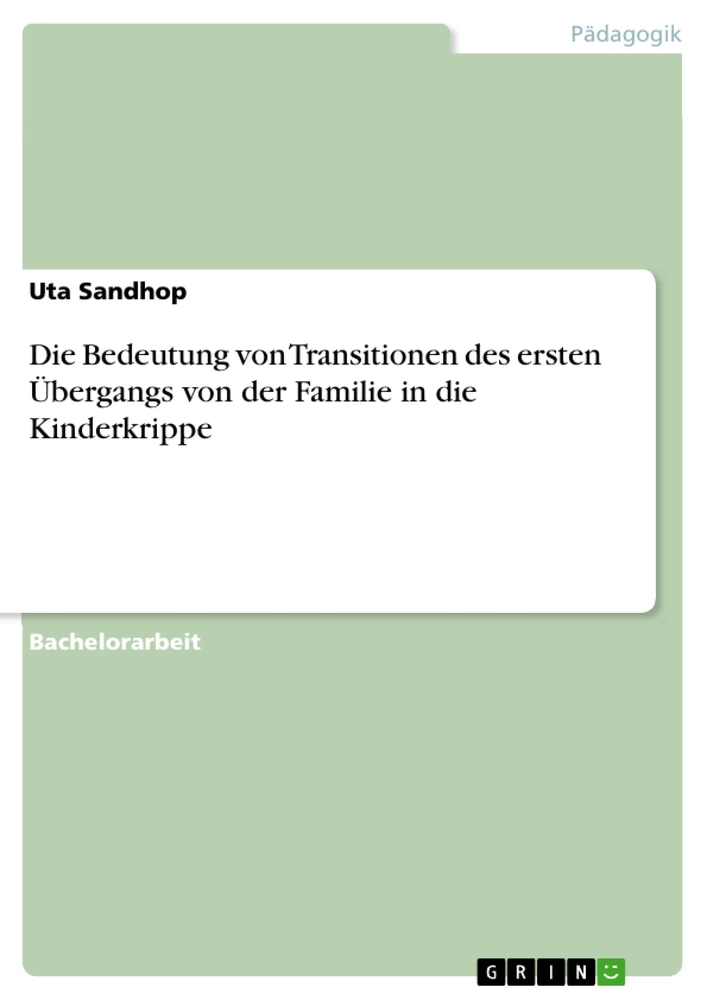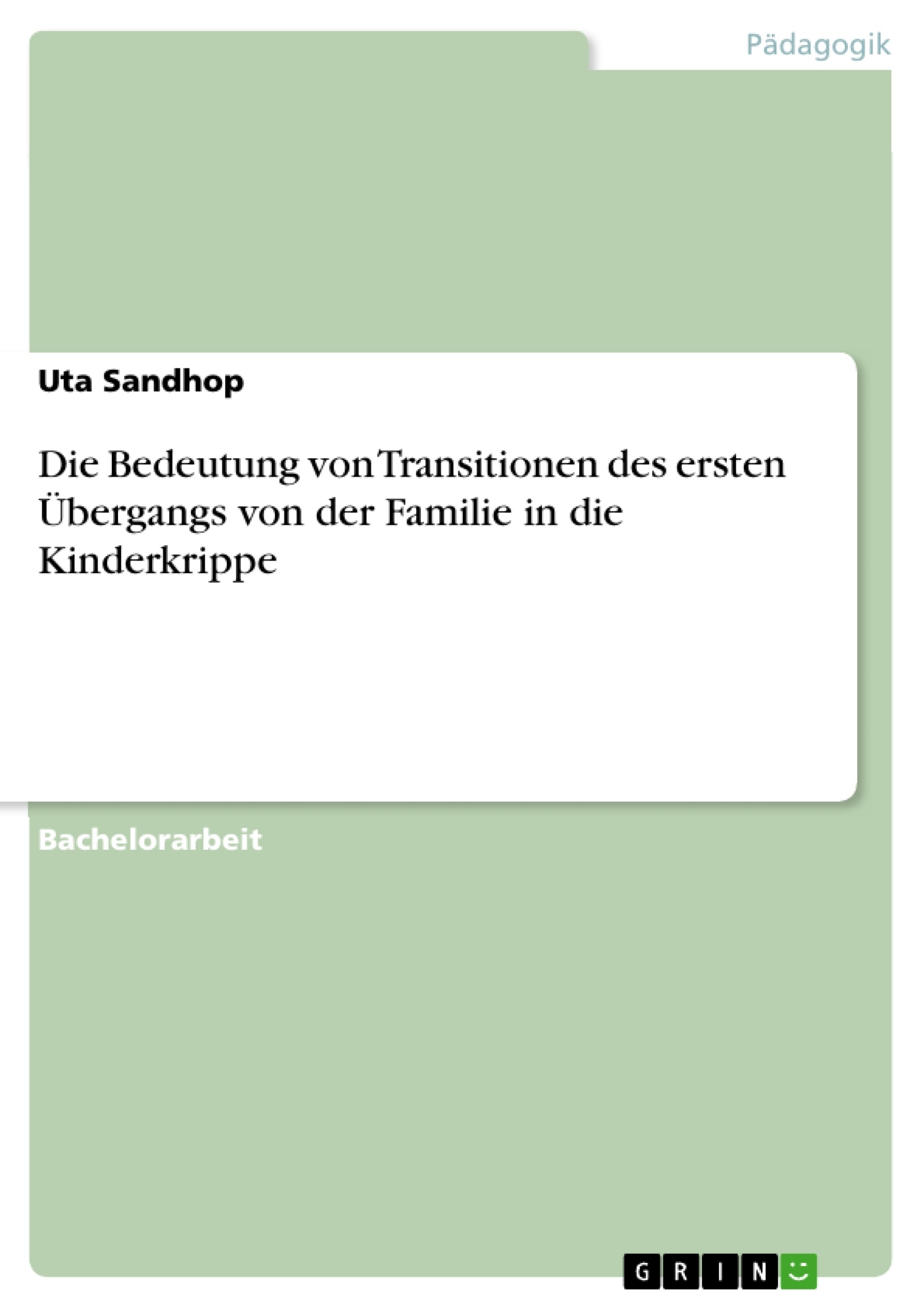„Neue“ Begriffe prägen den pädagogischen Alltag. Teilweise politisch so gewollt und notwendig, und von Fachberatern mühsam umgesetzt, sollen Akzente konzeptionell umgesetzt werden. Erzieher staunen über die Bedeutung von Resilienz und Partizipation. Eltern werden als potentielle Kunden erkannt und es muss mehr Sensibilität her.
Die seit Jahren vorliegenden Erkenntnisse zu den Begriffen Übergang beziehungsweise Transition sind langsam in das Bewusstsein der Kindertageseinrichtungen gelangt. Gut so! In der vorliegenden Bachelor-Thesis soll auf die Bedeutung von Transitionen am Beispiel des ersten Übergangs von der Familie in die Kinderkrippe eingegangen werden.
Der Autorin der Bachelor-Arbeit erging es ähnlich fragend, als ihre eigenen vier Kinder von der Familie in die erste institutionelle Betreuung wechselten. Viele Fragen und Sorgen kamen auf. Glücklicherweise hatte man in der betreffenden Einrichtung das Wissen über die Bedeutung des ersten Übergangs bereits praktisch umgesetzt und so konnte ein Eingewöhnungsmodell genutzt werden, dass die Eltern stark mit einbezog und dem Kind die Zeit gab, die es brauchte, um sich wohl zu fühlen.
Wenn über Transitionen vertieft nachgedacht wird, muss auch auf die Bindungstheorie eingegangen werden, die Situation von Familien heute, die zeitliche Veränderung der Familienmodelle, die Möglichkeiten, verschiedene Eingewöhnungsmodelle zu nutzen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und durch Studien belegt wurden. Außerdem wird auf politische Rahmenbedingungen eingegangen und die stufenweise Umsetzung von der Erkenntnis, zur Notwendigkeit bis zur Festschreibung in Kriterienkatalog, Gesetz und Curriculum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beschreibung der aktuellen Familiensituation
- 2.1 Historische Betrachtung der Familiensituation
- 2.2 Die aktuelle Familiensituation
- 3. Transitionen verstehen:
- 3.1 Definitionen von Transitionen
- 3.2 Arten von Übergängen
- 3.3 Institutionelle Übergänge
- 3.4 Aspekte der Transitionsforschung
- 3.4.1 Ifp - Studie
- 3.4.2 Weitere Studien: Wiener Krippenstudie, NUBBEK-Studie
- 3.5 Politische Rahmenbedingungen
- 3.6 Der Nationale Kriterienkatalog (NKK)
- 3.7 Die praktische Umsetzung der Eingewöhnung
- 3.7.1 Das Berliner Eingewöhnungsmodell von INFANS
- 3.7.2 Das Münchener Eingewöhnungsmodell
- 3.7.3 Das individualisierte Eingewöhnungsprogramm
- 4. Fazit - Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Transitionen am Beispiel des ersten Übergangs vom familiären Umfeld in die Kinderkrippe. Ziel ist es, die Herausforderungen und wichtigen Aspekte dieses Übergangs zu beleuchten und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Umsetzungsmodelle zu präsentieren.
- Historische und aktuelle Familiensituationen im Vergleich
- Definitionen und Arten von Transitionen
- Verschiedene Eingewöhnungsmodelle in Kinderkrippen
- Relevanz der Bindungstheorie im Kontext des Übergangs
- Politische Rahmenbedingungen und der Nationale Kriterienkatalog
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Transitionen im Kontext des Übergangs von der Familie in die Kinderkrippe ein. Sie verortet die Arbeit im aktuellen Diskurs der frühpädagogischen Praxis und thematisiert die persönlichen Erfahrungen der Autorin, die den Anstoß für die Arbeit bildeten. Die Bedeutung der Bindungstheorie und der Einfluss politischer Rahmenbedingungen werden als zentrale Aspekte bereits in der Einleitung erwähnt, um den thematischen Fokus der Arbeit zu verdeutlichen.
2. Beschreibung der aktuellen Familiensituation: Dieses Kapitel setzt sich mit der historischen und aktuellen Familiensituation auseinander. Es vergleicht die traditionelle Großfamilie mit der heutigen Kleinfamilie, hebt die Veränderungen im Rollenverständnis von Mann und Frau hervor und betont den Einfluss der Arbeitsmarktsituation auf die Familienstrukturen. Die Kapitel unterstreicht die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den damit verbundenen Bedarf an institutioneller Kinderbetreuung. Der Wandel wird anhand von Beispielen aus der Literatur und der gesellschaftlichen Entwicklung erläutert. Der historische Teil skizziert das Familienleben früher und beleuchtet die Veränderungen durch die Industrialisierung und die zunehmende Bedeutung von Bildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Transitionen in die Kinderkrippe
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Transitionen am Beispiel des ersten Übergangs vom familiären Umfeld in die Kinderkrippe. Sie beleuchtet die Herausforderungen und wichtigen Aspekte dieses Übergangs und präsentiert wissenschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Umsetzungsmodelle.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Historische und aktuelle Familiensituationen im Vergleich, Definitionen und Arten von Transitionen, verschiedene Eingewöhnungsmodelle in Kinderkrippen, die Relevanz der Bindungstheorie im Kontext des Übergangs, politische Rahmenbedingungen und den Nationalen Kriterienkatalog (NKK).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Beschreibung der aktuellen Familiensituation (inkl. historischer Betrachtung), Transitionen verstehen (inkl. Definitionen, Arten von Übergängen, institutionelle Übergänge, Transitionsforschung, politische Rahmenbedingungen, NKK und praktische Umsetzung der Eingewöhnung mit verschiedenen Modellen), und Fazit/Ausblick.
Wie wird die aktuelle Familiensituation beschrieben?
Das Kapitel zur aktuellen Familiensituation vergleicht die traditionelle Großfamilie mit der heutigen Kleinfamilie, hebt Veränderungen im Rollenverständnis von Mann und Frau hervor und betont den Einfluss der Arbeitsmarktsituation auf die Familienstrukturen. Es unterstreicht die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den damit verbundenen Bedarf an institutioneller Kinderbetreuung.
Welche Eingewöhnungsmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Eingewöhnungsmodelle vor, darunter das Berliner Eingewöhnungsmodell von INFANS, das Münchener Eingewöhnungsmodell und ein individualisiertes Eingewöhnungsprogramm.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie?
Die Bedeutung der Bindungstheorie wird im Kontext des Übergangs in die Kinderkrippe als zentraler Aspekt hervorgehoben. Sie wird bereits in der Einleitung erwähnt und spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der Herausforderungen des Übergangs.
Welche Studien werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Studien, darunter die Ifp-Studie, die Wiener Krippenstudie und die NUBBEK-Studie.
Welche politischen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt die politischen Rahmenbedingungen und den Einfluss des Nationalen Kriterienkatalogs (NKK) auf die Kinderbetreuung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick geben einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse der Arbeit und mögliche zukünftige Forschungsfragen.
Wie ist die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung führt in das Thema der Transitionen im Kontext des Übergangs von der Familie in die Kinderkrippe ein. Sie verortet die Arbeit im aktuellen Diskurs der frühpädagogischen Praxis und thematisiert die persönlichen Erfahrungen der Autorin, die den Anstoß für die Arbeit bildeten. Die Bedeutung der Bindungstheorie und der Einfluss politischer Rahmenbedingungen werden als zentrale Aspekte bereits in der Einleitung erwähnt.
- Citar trabajo
- Uta Sandhop (Autor), 2015, Die Bedeutung von Transitionen des ersten Übergangs von der Familie in die Kinderkrippe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299466