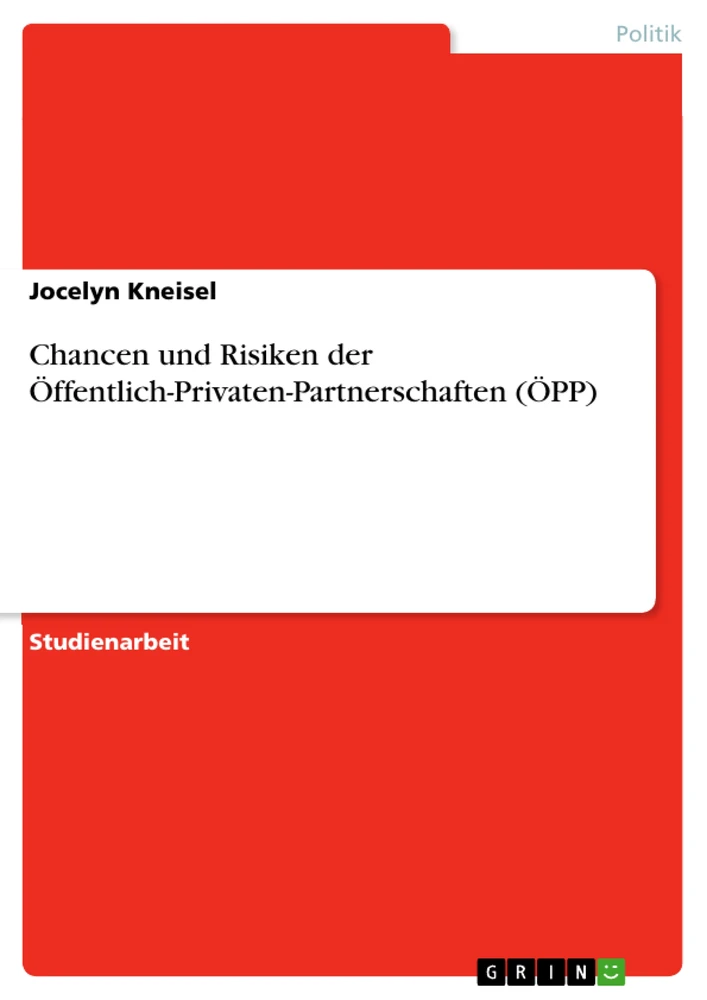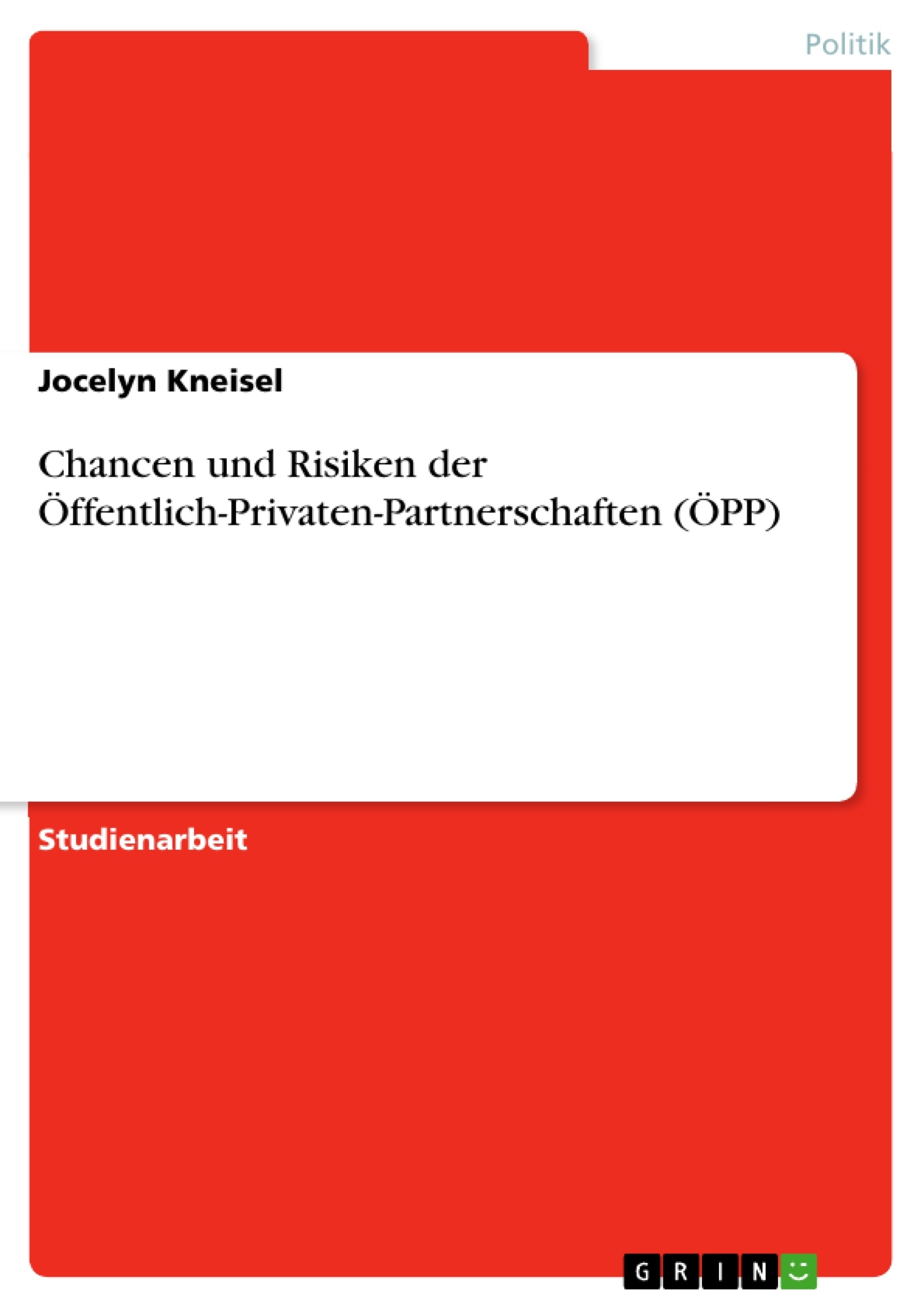Die zunehmende Verschuldung der deutschen Kommunen, Länder und des Bundes stellt ein Thema dar, dass schon fast so alt ist, wie die Bundesrepublik selbst.
Begegnet wird dem Problem zusehends mit Reformen, die bürokratieabbauend wirken sollen, um so dem „Ideal“ eines „schlanken Staates“ näher zu kommen. Eine neuere Methode, welche die staatliche Konsolidierung vorantreiben soll, ist die öffentlich-private Kooperation bzw. Partnerschaft (ÖPP), die aus den Vereinigten Staaten als Public Private Partnership (PPP) bekannt ist, wo sie schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts Anwendung findet.
Nach dem sich die ÖPPs in Großbritannien, dem EU-Vorreiter, seit den 1970er Jahren, im Zuge der Thatcher-Regierung, immer größerer Popularität erfreuen – ca. 15 bis 30% beträgt der ÖPP-Anteil an den Sachinvestitionen der „Kommunen“ der angelsächsischen Staaten – zog die Bundesrepublik ab Mitte der 1980er Jahren nach. Seit den 1990er Jahren finden die ÖPPs – die ca. fünf Prozent der kommunalen Sachinvestitionen der Bundesrepublik ausmachen – mit steigender Tendenz, größere Anwendung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitsdefinition
- 3. Rechtfertigung und Auswahl eines privaten Partners
- 3.1 Weshalb es einer Rechtfertigung bedarf
- 3.2 Durchführung von Rechtfertigung und Auswahl
- 4. ÖPP-Typen
- 4.1 Vertrags-ÖPP
- 5. Vorteile, Nachteile und Risiken seitens der öffentlichen Hand
- 5.1 Vertrags-ÖPP
- 5.2 Institutionelle ÖPP
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs) in Deutschland, insbesondere deren Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Die zunehmende Verschuldung des öffentlichen Sektors und der damit verbundene Druck auf Reformen bilden den Hintergrund. Die Arbeit analysiert die verschiedenen ÖPP-Typen, die Prozesse der Partnerauswahl und -rechtfertigung, sowie die Vorteile und Nachteile dieser Kooperationsform.
- Wirtschaftlichkeit von ÖPPs
- Vergleich verschiedener ÖPP-Modelle
- Risiken und Chancen von ÖPPs
- Rechtfertigung und Auswahl privater Partner
- Langfristige Folgen von ÖPPs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs) ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach deren langfristiger Wirtschaftlichkeit und Nutzen. Sie beleuchtet den Kontext steigender öffentlicher Verschuldung und den damit verbundenen Reformdruck. Die zunehmende Popularität von ÖPPs in anderen Ländern wie Großbritannien wird erwähnt, ebenso wie die kontroverse Debatte um deren Vor- und Nachteile. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die einzelnen Kapitel an.
2. Arbeitsdefinition: Dieses Kapitel liefert eine präzise Arbeitsdefinition des Begriffs „Öffentlich-Private Partnerschaft“. Es betont, dass ÖPPs keine festgelegte Gesellschaftsform darstellen und verschiedene Definitionen existieren. Die Arbeit legt eine spezifische Arbeitsdefinition fest, die einen langfristigen Zusammenschluss des öffentlichen und privaten Sektors zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben beschreibt. Dabei wird die Übertragung von Teilaufgaben oder der gesamten Aufgabe an den privaten Partner mit den damit verbundenen Risiken hervorgehoben, während der öffentliche Sektor die Richtlinienkompetenz und Gesamtverantwortung behält. Die Unterscheidung zwischen Vertrags-ÖPP und institutionellen ÖPPs wird angedeutet.
3. Rechtfertigung und Auswahl eines privaten Partners: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit einer Rechtfertigung für die Auswahl eines privaten Partners bei ÖPPs. Es betont die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß der Bundeshaushaltsordnung, die Kosten, Einnahmen und Risiken verschiedener Modelle vergleichen muss. Die kritische Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit einer solchen Untersuchung wird hervorgehoben und die Gefahr einer unwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wird angesprochen. Die Bedeutung unabhängiger Prüfungen wird betont, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP), Public Private Partnership (PPP), Wirtschaftlichkeit, Risiken, Vorteile, Vertrags-ÖPP, Institutionelle ÖPP, öffentliche Verschuldung, Reformen, Bundeshaushaltsordnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs) in Deutschland, konzentriert sich auf deren Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Kontext steigender öffentlicher Verschuldung und Reformdruck. Sie untersucht verschiedene ÖPP-Typen, die Prozesse der Partnerauswahl und -rechtfertigung sowie die Vor- und Nachteile dieser Kooperationsform. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Arbeitsdefinition von ÖPPs, eine Auseinandersetzung mit der Rechtfertigung und Auswahl privater Partner, eine Betrachtung verschiedener ÖPP-Typen und deren Vor- und Nachteile aus öffentlicher Sicht, sowie ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Wirtschaftlichkeit von ÖPPs, vergleicht verschiedene ÖPP-Modelle, untersucht Risiken und Chancen, analysiert die Rechtfertigung und Auswahl privater Partner und betrachtet die langfristigen Folgen von ÖPPs. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß der Bundeshaushaltsordnung.
Welche Arten von ÖPPs werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zumindest zwischen Vertrags-ÖPPs und institutionellen ÖPPs. Die genauen Unterschiede werden im Detail im Text erläutert.
Warum ist die Rechtfertigung der Partnerwahl wichtig?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer Rechtfertigung für die Auswahl eines privaten Partners bei ÖPPs. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß der Bundeshaushaltsordnung ist unerlässlich, um Kosten, Einnahmen und Risiken verschiedener Modelle zu vergleichen und unwirtschaftliche Aufgabenerfüllungen zu vermeiden. Unabhängige Prüfungen sollen Fehlentscheidungen vorbeugen.
Welche Vorteile und Nachteile von ÖPPs werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile von ÖPPs aus der Perspektive der öffentlichen Hand, getrennt für Vertrags-ÖPPs und institutionelle ÖPPs. Die konkreten Vor- und Nachteile werden im Detail im Text aufgeführt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Arbeitsdefinition, Rechtfertigung und Auswahl eines privaten Partners, ÖPP-Typen, Vorteile, Nachteile und Risiken seitens der öffentlichen Hand und Fazit. Jedes Kapitel wird im Text separat zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP), Public Private Partnership (PPP), Wirtschaftlichkeit, Risiken, Vorteile, Vertrags-ÖPP, Institutionelle ÖPP, öffentliche Verschuldung, Reformen, Bundeshaushaltsordnung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die langfristige Wirtschaftlichkeit und der Nutzen von öffentlich-privaten Partnerschaften.
Wie wird der Begriff „Öffentlich-Private Partnerschaft“ definiert?
Die Arbeit legt eine spezifische Arbeitsdefinition fest, die einen langfristigen Zusammenschluss des öffentlichen und privaten Sektors zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben beschreibt. Dabei wird die Übertragung von Teilaufgaben oder der gesamten Aufgabe an den privaten Partner mit den damit verbundenen Risiken hervorgehoben, während der öffentliche Sektor die Richtlinienkompetenz und Gesamtverantwortung behält.
- Quote paper
- Jocelyn Kneisel (Author), 2015, Chancen und Risiken der Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299253