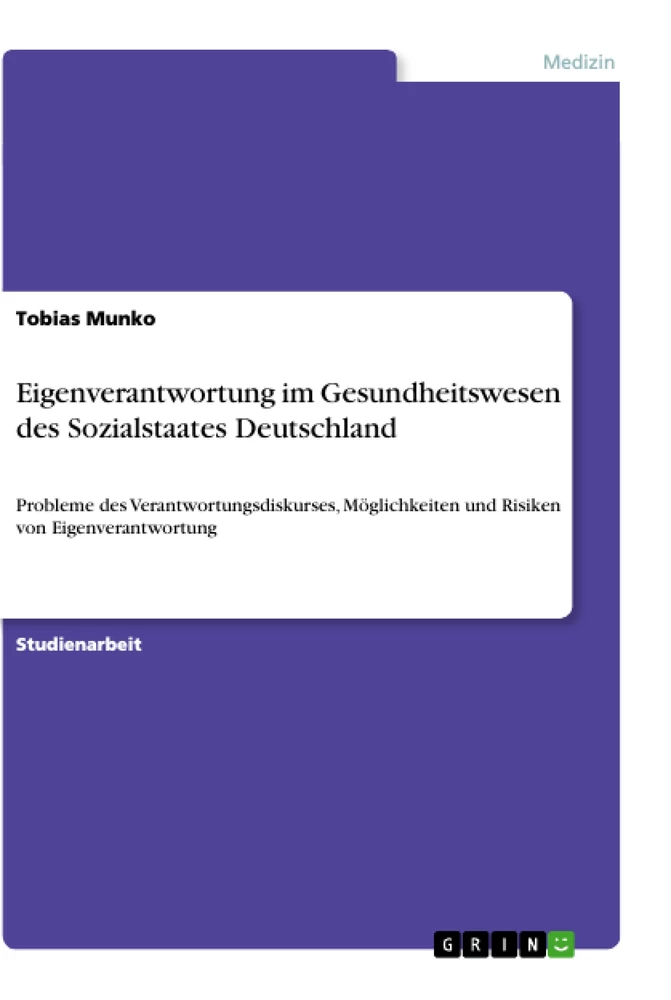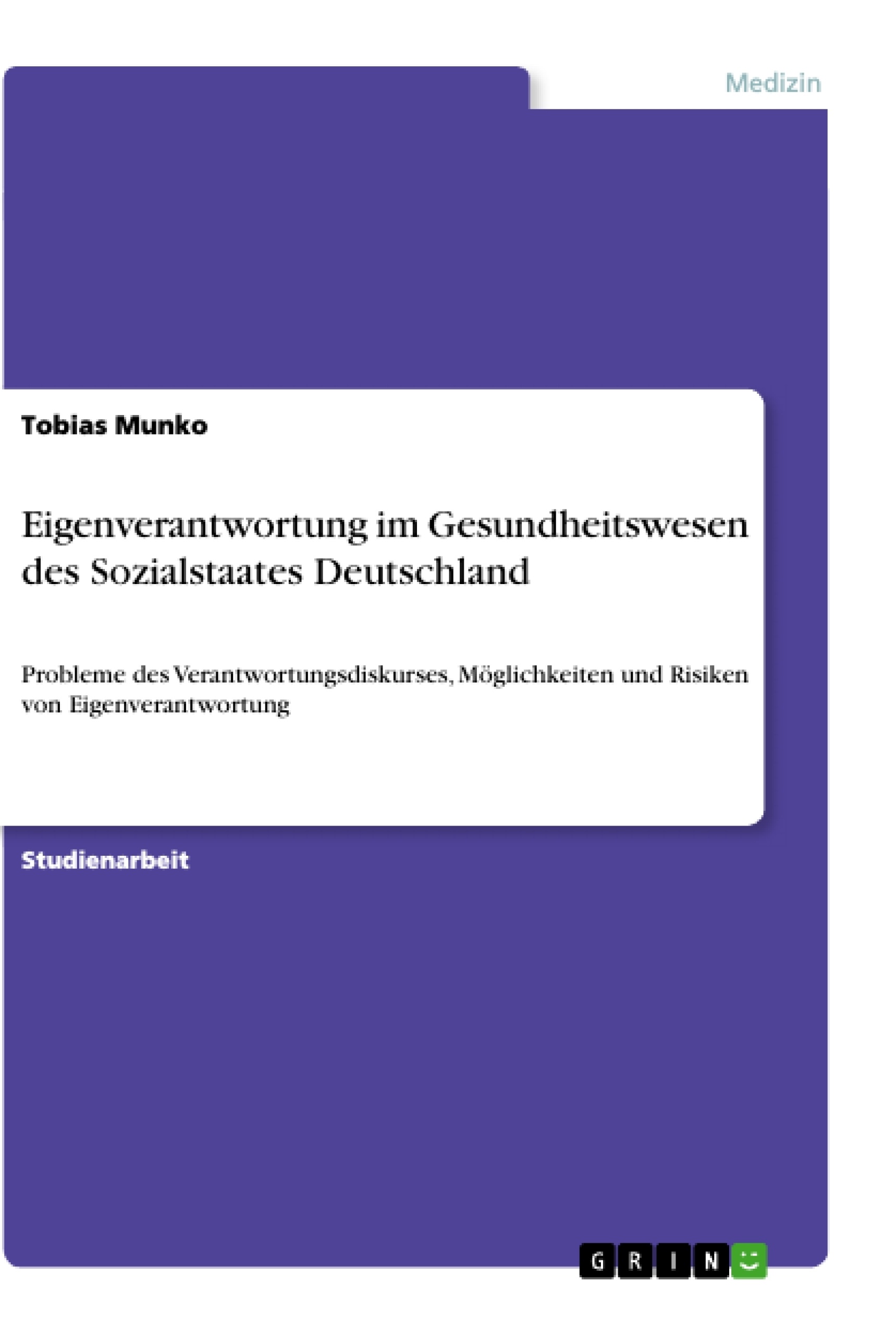Das Thema Eigenverantwortung wird heutzutage hitzig diskutiert. Dabei wird zunehmend außer Acht gelassen, welche Grundvoraussetzungen einer sogenannten „Eigenverantwortung“ zu Grunde liegen müssen und ob diese, im aktuell vorhandenen Sozialstaat Deutschland, überhaupt gegeben sind.
Diese Studienarbeit soll einen einführenden Überblick über das Thema „Eigenverantwortung im Gesundheitswesen und in der Sozialpolitik“ geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist es, die Einführung in die Problematik des Themas und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. In den folgenden Kapiteln werden deshalb die Grundproblematik um den Verantwortungsdiskurs aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
Inhalt
1. Einleitung. 1
2. Definition „Eigenverantwortung“. 1
2.1. Das Problem der Definition. 1
2.2. Probleme einer fehlenden Definition. 2
3. Voraussetzung von Eigenverantwortung. 3
4. Eigenverantwortung oder soziale Verantwortung. 4
5. Möglichkeiten und Risiken einer allgemein definierten Eigenverantwortung, eingebettet in ein solidarisches System... 5
5.1. Einheitliche Definition. 5
5.2. Möglichkeiten und Risiken. 6
6. Fazit 7
7. Literaturverzeichnis. 8
1. Einleitung
Das Thema Eigenverantwortung wird heutzutage hitzig diskutiert, wie folgende Beispiele andeuten: „In der Sozialstaatsdebatte und im Gesundheitswesen hat sich der Begriff der Eigenverantwortung durchgesetzt, ohne dass eine präzisierende Definition vorliegt“ (Schmidt, 2008, S. 49), oder, wie Heidbrink (2006) Eigenverantwortung umschreibt, „die Gesellschaftsmitglieder zu aktivem und engagiertem Verhalten zu bewegen und sie notfalls – falls dies nicht geschieht – für ihr sozialschädliches Handeln mit entsprechenden Sanktionen zur Rechenschaft zu ziehen“ (S. 26).
Dabei wird zunehmend außer Acht gelassen, welche Grundvoraussetzungen einer „Eigenverantwortung“ zu Grunde liegen müssen und ob diese, im aktuell vorhandenen Sozialstaat Deutschland, überhaupt gegeben sind.
Diese Hausarbeit soll einen einführenden Überblick über das Thema „Eigenverantwortung im Gesundheitswesen und in der Sozialpolitik“ geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist also die Einführung in die Problematik des Themas und mögliche Lösungsansätze. In den folgenden Kapiteln werden deshalb die Grundproblematik um den Verantwortungsdiskurs aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
2. Definition „Eigenverantwortung“
2.1. Das Problem der Definition
Eine qualifizierte und evidenzbasierte Aussage bezüglich des Zusammenhangs von Eigenverantwortung und Gesundheit bzw. Krankheit ist derzeit nicht möglich (Schmidt, 2008). Nach Schmidt gilt es folgende Punkte zu beachten:
Unschärfe der Definition
Der Begriff Eigenverantwortung unterliegt keinen allgemein gültigen Kriterien und kann somit frei gefüllt werden mit den individuell gebrauchten Eigenschaften wie z.B. „vernünftig = freiheitlich = markt- und wettbewerbsorientiert = eigenverantwortlich = sachlich = transparent = weltoffen“ (Ederer, 2002, S. 465), oder, wie Grühn (2001) es ausdrückt, gleicht „die Eigenverantwortung […] einem Containerbegriff, in den man beliebig Inhalte pressen kann und der sich daher nicht als tragfähiger Rechtsbegriff eignet“ (S. 15).
Demzufolge haben wir es mit einer „Eng- und Weitführung des Begriffs“ (Schmidt, 2008, S. 10) zu tun und damit mit einer fehlenden Definition, die es dem Nutzer des Begriffs ermöglicht, ihn im jeweiligen eigenen Kontext mit Inhalt zu füllen. In diesem Zuge werden sowohl sehr weit gefasste Begriffe wie„Autonomie oder Freiheit [verwandt]. Zum Teil finden sich auch sehr eng gefasste Konzeptionen, etwa Eigenverantwortung als Einsichtsfähigkeit, Eigenbeteiligung, Eigenleistung“ (ebd., S. 11).
Erwähnt sei weiterhin die „Visionierte Wahlfreiheit“ (ebd., S. 12), gemeint ist damit, dass der Mensch zwar frei wählen kann zwischen z.B. Fernsehen und Sport, sich aber frei entscheiden soll für den Sport (ebd.). Es existiert nur eine scheinbare Wahlmöglichkeit. Dies sind nur die wichtigsten Auszüge einer Aufzählung von Schmidt. Sie sollen lediglich verdeutlichen, dass gegenwärtig keine allgemein gültige Definition von „Eigenverantwortung“ existiert, was eine Diskussion um dieses Thema mit enormen Problemen behaftet.[...]
[Dies ist eine Leseprobe. Grafiken und Tabellen sind nicht enthalten.]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt das Thema Eigenverantwortung, insbesondere im Kontext des Gesundheitswesens und der Sozialpolitik in Deutschland. Er untersucht die Definitionsprobleme, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Risiken einer allgemein definierten Eigenverantwortung, eingebettet in ein solidarisches System.
Warum ist die Definition von Eigenverantwortung problematisch?
Die Definition von Eigenverantwortung ist unklar und es existieren keine allgemein gültigen Kriterien. Der Begriff wird oft mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt und kann sowohl eng (z.B. Eigenbeteiligung) als auch weit (z.B. Autonomie) gefasst werden. Diese Unschärfe erschwert eine evidenzbasierte Diskussion.
Welche Voraussetzungen sind für Eigenverantwortung notwendig?
Der Text erwähnt, dass zunehmend außer Acht gelassen wird, welche Grundvoraussetzungen einer "Eigenverantwortung" zu Grunde liegen müssen und ob diese im aktuellen Sozialstaat Deutschland überhaupt gegeben sind. Die Hausarbeit soll einen einführenden Überblick über das Thema geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist also die Einführung in die Problematik des Themas und mögliche Lösungsansätze.
Welche Kritik wird an der aktuellen Verwendung des Begriffs Eigenverantwortung geäußert?
Kritisiert wird, dass der Begriff der Eigenverantwortung in Debatten um den Sozialstaat und das Gesundheitswesen verwendet wird, ohne dass eine präzisierende Definition vorliegt. Außerdem wird bemängelt, dass die Voraussetzungen für Eigenverantwortung oft nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Was sind die möglichen Möglichkeiten und Risiken einer allgemeingültigen Definition?
Der Text deutet an, dass die Möglichkeiten und Risiken einer allgemeingültigen Definition der Eigenverantwortung im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden, aber die Details hierzu sind in der vorliegenden Leseprobe nicht enthalten.
Welche Rolle spielt die "visionierte Wahlfreiheit" im Zusammenhang mit Eigenverantwortung?
Die "visionierte Wahlfreiheit" beschreibt die Situation, in der Menschen zwar scheinbar frei wählen können (z.B. zwischen Fernsehen und Sport), aber faktisch erwartet wird, dass sie sich für die "richtige" Option (z.B. Sport) entscheiden. Es existiert also nur eine scheinbare Wahlmöglichkeit.
Welche Autoren werden im Text zitiert?
Im Text werden Schmidt (2008), Heidbrink (2006), Ederer (2002) und Grühn (2001) zitiert.
- Quote paper
- Tobias Munko (Author), 2011, Eigenverantwortung im Gesundheitswesen des Sozialstaates Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299216