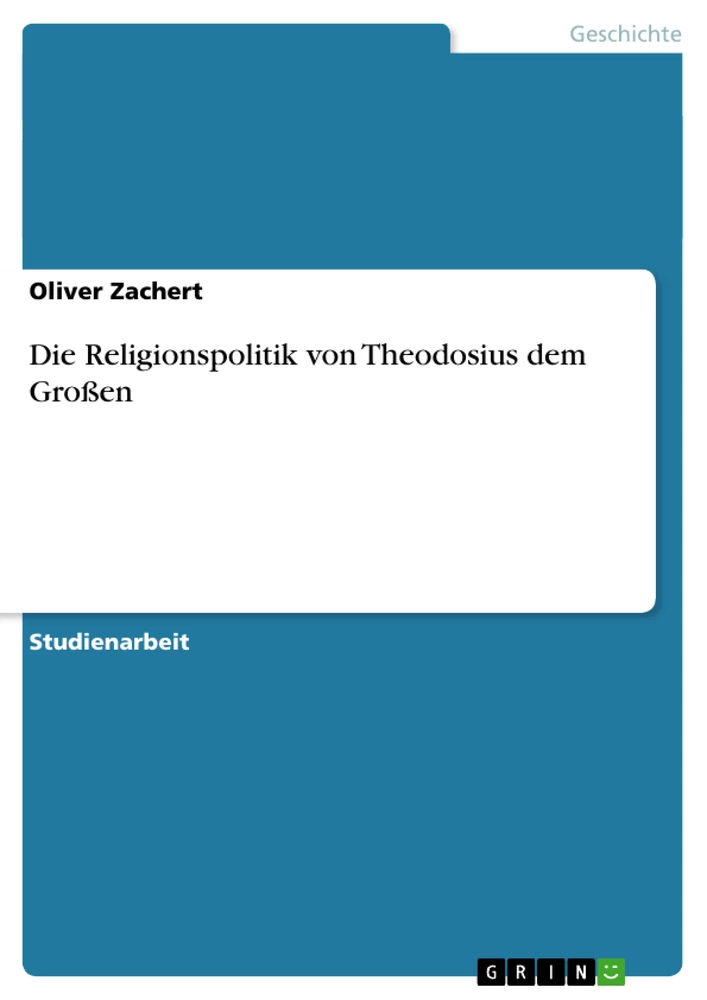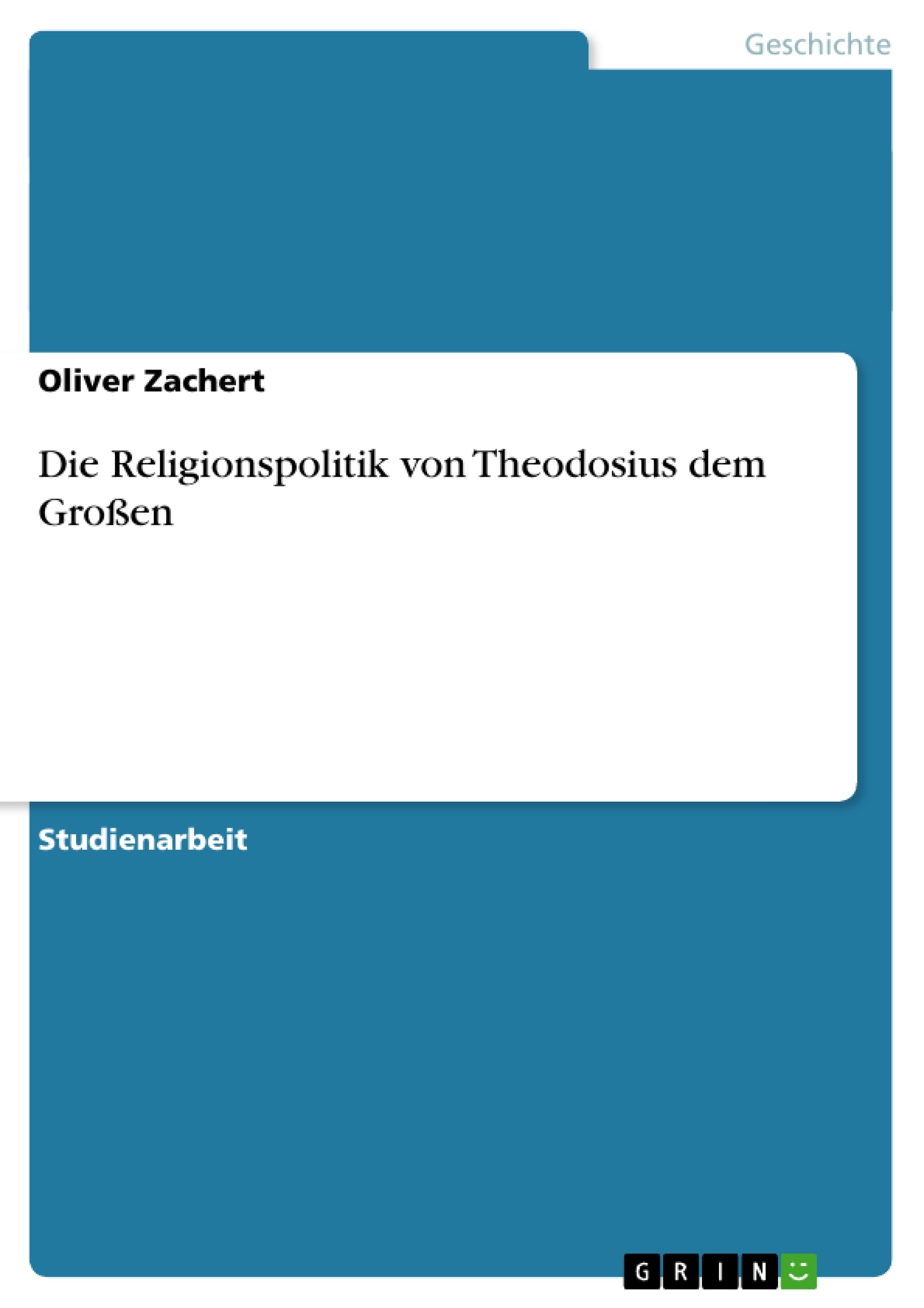Ab 303 nach Christus gab es keine Christenverfolgungen mehr und somit konnte sich eine neue Religion immer mehr in der römischen Gesellschaft durchsetzen. Unter Kaiser Galerius wurde 311 n. Chr. erstmals ein Toleranzedikt für die Christen ausgesprochen. Kaiser Konstantin war der erste christliche Kaiser, der sich dieser Religion mit dem Konzil von Nikaea anschloss.
Auch die Söhne des Konstantin, Konstans und Konstantius II, führten dessen Religionspolitik weiter. Konstantin II übte den größten Einfluss aus und war ab 353 n. Chr. Alleinherrscher. Einen kurzen Einbruch erlitten die Christen unter Julian Apostata, einem Anhänger der heidnischen Opferkulte, der andere Religionen verbot. Er herrschte jedoch nur von 361-362 n. Chr.. Um das Heidentum wieder aufleben zu lassen, schränkte er die Christen in ihren Rechten ein.
In den Jahren der Regentschaften der Kaiser Valentian I, Valens II sowie Valentian II wurde die Religionsfrage sehr selten gestellt. Arianismus- und Donatismusstreit konnten sich weit ausbreiten. Da gesetzlich nichts festgeschrieben war, bildeten sich Abspaltungen dieser Parteien. Ein erstes Zeichen gegen die Verachtung der Religionsfrage setzte Kaiser Gratian mit seinem Toleranzedikt von 378 n. Chr.. Auf Grund eines synodalen Beschlusses wurde er um ein Eingreifen gebeten. Diese Maßnahme jedoch verschlechterte die religiöse Lage. Theodosius, der 379 n. Chr. zum Kaiser für das arianische Ostreich ernannt wurde, machte es sich zur Aufgabe, die Uneinigkeit in der Kirche zu beenden. Der einzig wahre Glaube sollte sich in dem gesamten Reich durchzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einblick in die religionspolitische Lage vor Theodosius
- Das Edikt des Theodosius
- Das Edikt: „cunctos populos“ aus dem Jahr 381
- Die Häretiker
- Überblick und Auswertung der Häretikergesetze aus dem Codex Theodosianus
- Die Heiden
- Die Entwicklung der Heidengesetze von 379 n. Chr. bis 391 n. Chr.
- Die Heidengesetze ab 391 n. Chr.
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Religionspolitik von Theodosius dem Großen zu analysieren und ihre Auswirkungen auf die heidnische Tradition und die christliche Neuerung im römischen Reich des 4. Jahrhunderts n. Chr. zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Religionspolitik Theodosius', die Bekämpfung von Häresien, die Verfolgung des Heidentums und die Folgen dieser Maßnahmen für die Gesellschaft.
- Das Edikt „cunctos populos“ als Grundlage der Religionspolitik Theodosius'
- Die Bekämpfung von Häresien durch Gesetze und Verordnungen
- Die Verfolgung des Heidentums und der Wandel der römischen Gesellschaft
- Die Rolle der Kirche und ihre Einflussnahme auf die Politik
- Die Reaktion des Heidentums auf die Religionspolitik des Theodosius
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung bietet einen Überblick über die religionspolitische Lage im römischen Reich vor der Regierungszeit Theodosius'. Sie skizziert die Entwicklungen von den Toleranzedikten unter Galerius und Konstantin bis hin zur Religionspolitik von Julian Apostata und der Kaiser Valentian I, Valens II und Valentian II.
Einblick in die religionspolitische Lage vor Theodosius: Dieses Kapitel setzt sich mit der religionspolitischen Situation im römischen Reich im 4. Jahrhundert n. Chr. auseinander. Es beleuchtet die Entwicklungen von der Christenverfolgung bis zur Etablierung des Christentums als Staatsreligion und die Herausforderungen, die sich durch die verschiedenen christlichen Strömungen und das Heidentum ergaben.
Das Edikt des Theodosius: Dieses Kapitel untersucht das Edikt „cunctos populos“, das Theodosius im Jahr 381 n. Chr. erließ. Es analysiert den Inhalt des Edikts, seine Bedeutung für die Religionspolitik Theodosius' und die Auswirkungen auf die verschiedenen Glaubensrichtungen im Reich. Das Edikt stellte ein Bekenntnis zum katholischen Christentum als Staatsreligion dar und legte den Grundstein für die weitere religiöse Politik des Theodosius.
Die Häretiker: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verfolgung von Häretikern unter Theodosius. Es analysiert die Häretikergesetze, die im Codex Theodosianus festgehalten wurden, und untersucht die Auswirkungen dieser Gesetze auf die verschiedenen Häresiestromungen, wie den Arianismus, den Photinianismus und den Eunomianismus. Die Arbeit beleuchtet die Methoden der Verfolgung, die Sanktionen gegen Häretiker und den Einfluss dieser Maßnahmen auf die Verbreitung und Ausbreitung der verschiedenen Glaubensrichtungen.
Die Heiden: Dieses Kapitel widmet sich der Verfolgung des Heidentums unter Theodosius. Es verfolgt die Entwicklung der Heidengesetze von 379 n. Chr. bis 391 n. Chr. und analysiert die Maßnahmen, die gegen heidnische Rituale, Tempel und die Ausübung des Heidentums ergriffen wurden. Das Kapitel beleuchtet die Argumentationslinien, die zur Begründung der Verfolgung des Heidentums verwendet wurden, und die Auswirkungen dieser Politik auf die heidnische Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Religionsgeschichte des römischen Reiches im 4. Jahrhundert n. Chr. und konzentriert sich auf die Religionspolitik von Theodosius dem Großen. Zu den wichtigsten Begriffen und Themen zählen das Edikt „cunctos populos“, das Christentum als Staatsreligion, die Bekämpfung von Häresien, die Verfolgung des Heidentums, der Codex Theodosianus, die Rolle der Kirche in der Politik, die Reaktion des Heidentums auf die staatliche Religionspolitik, die gesellschaftlichen Folgen der Religionspolitik, die Entwicklung des Christentums und die Etablierung des katholischen Christentums als dominierende Glaubensrichtung im römischen Reich.
- Quote paper
- Oliver Zachert (Author), 2002, Die Religionspolitik von Theodosius dem Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29916