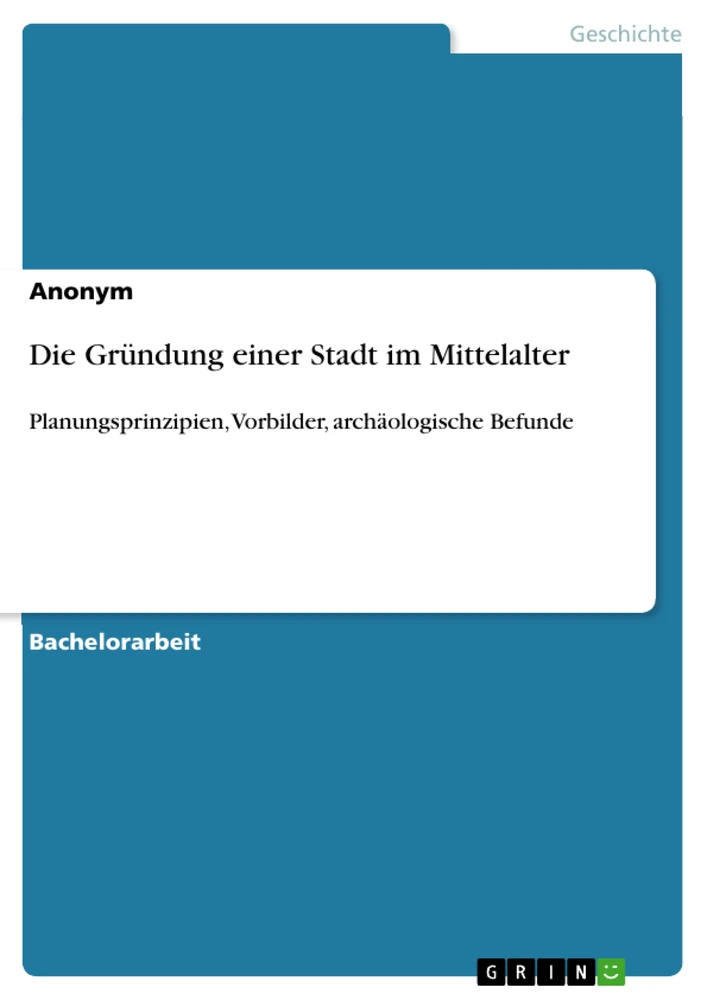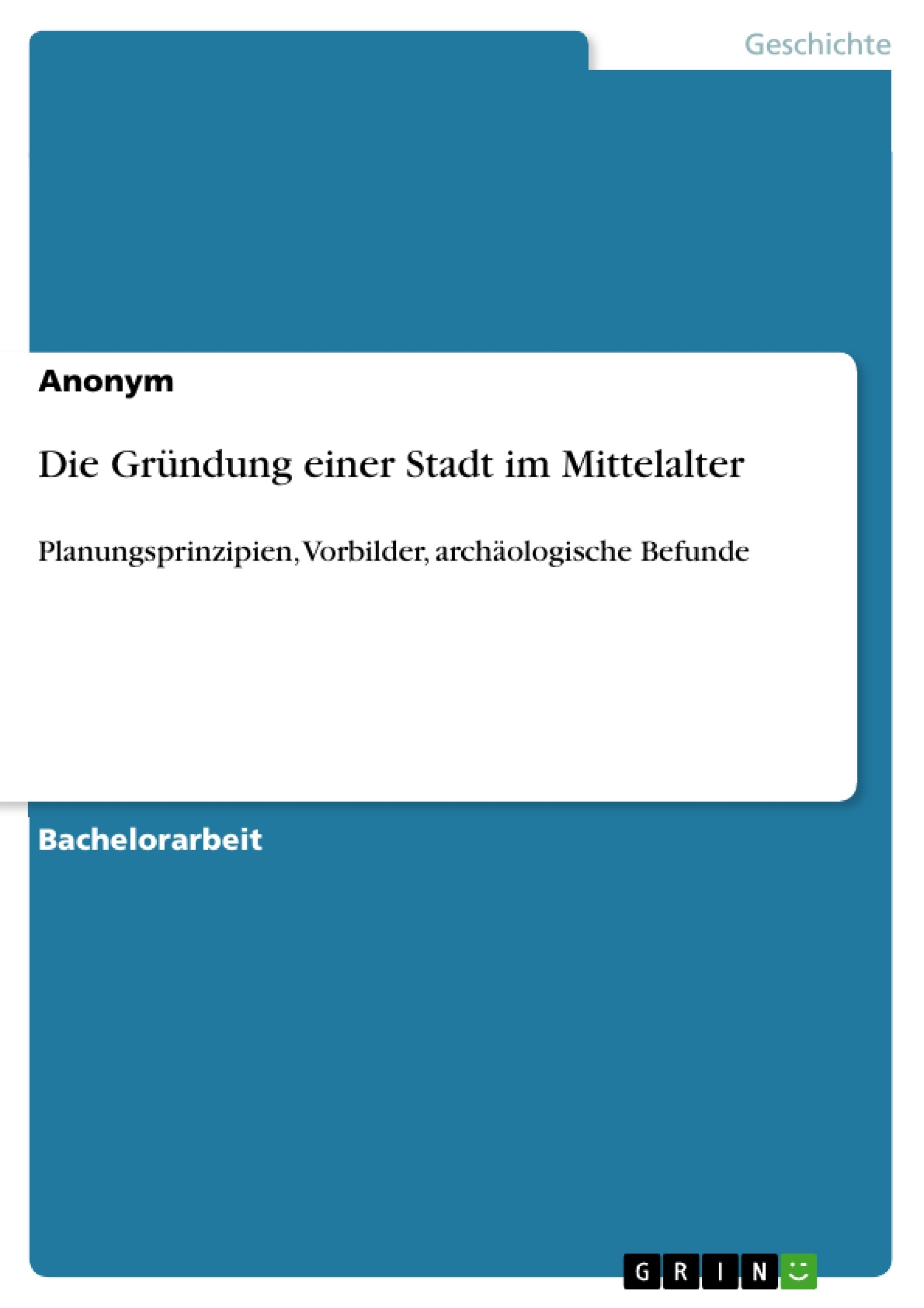Die mittelalterliche Stadt – bis heute hat sie nichts von ihrer Faszination verloren und lockt
Scharen von Touristen aus aller Welt nach Europa. Ursächlich hierfür ist vor allem ihr, durch
eine gotische Silhouette geprägtes Erscheinungsbild: Mit der engen, spitzgiebeligen Bebauung
und den verwinkelten Gassen strahlt dieser Ort Ruhe und Gemütlichkeit aus. Stadtmauern,
Wehrtürme und Stadttore hingegen bezeugen Wehrfähigkeit und Selbstbehauptungswillen der
Einwohner. Trotz dieser sich wiederholenden charakteristischen Merkmale weisen Städte des
mittelalterlichen Deutschen Reiches vielfältige Erscheinungsformen und Einwohnerzahlen auf,
womit die Frage einhergeht, was eine Stadt genau definiert und sie von den nichtstädtischen
Siedlungsformen wie Dörfern oder Marktflecken unterscheidet. Bei Eberhard Isenmann findet
man verschiedene Deutungsversuche von baulichen Erscheinungsformen über die Rechtsordnung
bis hin zu bevölkerungsstatistischen Auswertungen und Wirtschaftlichkeit.
Beginnt man bei der baulichen Komponente, so fällt einem zuerst der Mauerring mit seiner militärischen
und rechtlichen Funktion ins Auge. Im Mittelalter, als die Kriegsführung vor allem
ihre Vorteile in der Defensive hatte, war dieser durchaus wirkungsvoll, verlor aber mit der Weiterentwicklung
der Waffen allmählich seinen Nutzen. Durch die daraus resultierende Siedlungserweiterung
konnte er kein Kennzeichen für eine Stadt mehr darstellen, zumal manche Städte
erst sehr spät oder auch gar nicht befestigt wurden und sich auch befestigte Marktflecken und
Dörfer finden lassen. Unter dem bekannten Slogan „Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag“
wird ein gängiger Rechtsgrundsatz der damaligen Zeit beschrieben und machte die stadtbürgerliche
Freiheit und Gleichheit als einen eigenen Rechtsraum attraktiv u.a. für die leibeigene
Landbevölkerung. Nach und nach wurde diese städtische Grundregel von den staatsbürgerlichen
Rechtsprinzipen ersetzt, was einen Bezug auf die Begriffsdefinition hinfällig machte.
Gleichwohl bleibt die bauliche Erscheinungsform und die rechtliche Ordnung ein wesentliches
Kriterium. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Siedlungstypen
- Literatur- und Forschungsstand
- Gründung einer Stadt im Mittelalter
- Vorbilder und Organisation
- Topographische Gegebenheiten
- Naturräumliche Topographie
- Wirtschaftstopographie
- Sozialtopographie
- Planungsprinzipien
- Archäologische Funde und Befunde
- Freiburg
- Lübeck
- München
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung mittelalterlicher Städte und untersucht dabei insbesondere die Planungsprinzipien, Vorbilder und archäologischen Befunde. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Definitionsansätze des Stadtbegriffs im Mittelalter, die sich von baulichen Erscheinungsformen über die Rechtsordnung bis hin zu bevölkerungsstatistischen Auswertungen und Wirtschaftlichkeit erstrecken. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die historischen Entwicklungen, die zur Entstehung von Städten im Mittelalter geführt haben, und setzt diese in den Kontext der römischen und vorrömischen Siedlungsstrukturen.
- Entwicklung und Definition des Stadtbegriffs im Mittelalter
- Planungsprinzipien und Vorbilder bei der Gründung mittelalterlicher Städte
- Archäologische Befunde als Quelle für die Rekonstruktion der Stadtentwicklung
- Bedeutung der Topographie und der wirtschaftlichen Ressourcen für die Stadtgründung
- Vergleichende Analyse von drei Beispielstädten (Freiburg, Lübeck, München)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine Einführung in die Thematik und diskutiert unterschiedliche Definitionsansätze für den Stadtbegriff im Mittelalter. Sie beleuchtet die historischen Ursprünge des städtischen Lebens und zeichnet die Entwicklung von den römischen Städten bis hin zu den mittelalterlichen Siedlungsformen nach. Das zweite Kapitel behandelt die Gründung einer Stadt im Mittelalter und analysiert die relevanten Faktoren wie Vorbilder, Organisation, topographische Gegebenheiten und Planungsprinzipien. Das dritte Kapitel widmet sich der Untersuchung archäologischer Funde und Befunde in den Beispielstädten Freiburg, Lübeck und München. Diese Untersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über die konkrete Stadtentwicklung und die Umsetzung der Planungsprinzipien.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Stadt, Stadtgründung, Planungsprinzipien, Vorbilder, archäologische Befunde, Topographie, Siedlungsgeschichte, Freiburg, Lübeck, München, Stadtbegriff, Recht, Wirtschaft, Bevölkerung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Die Gründung einer Stadt im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298417