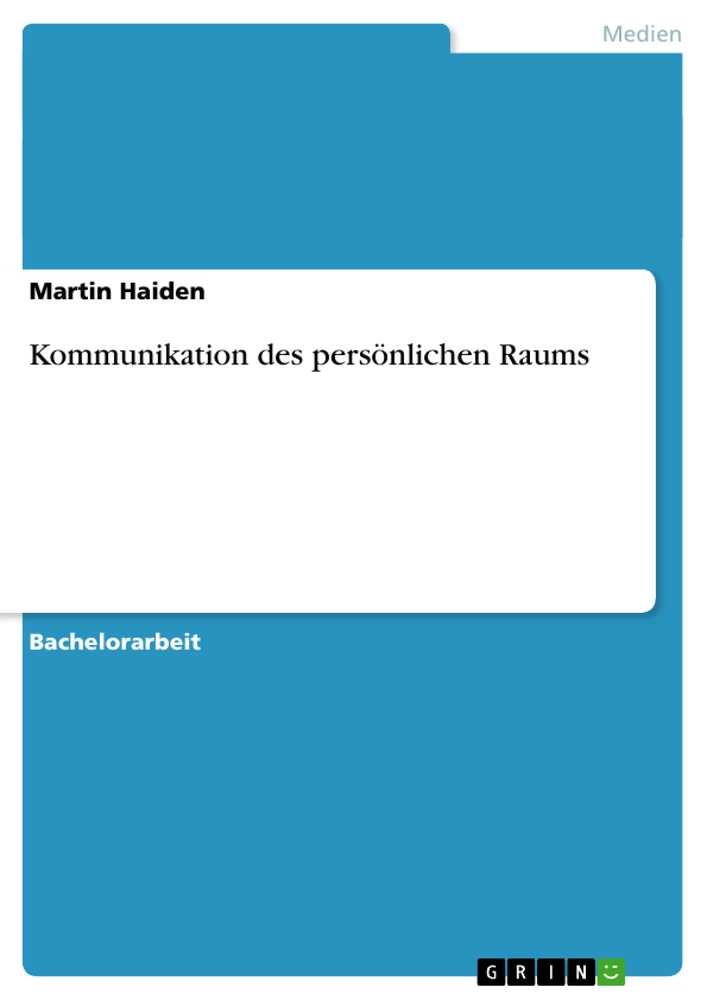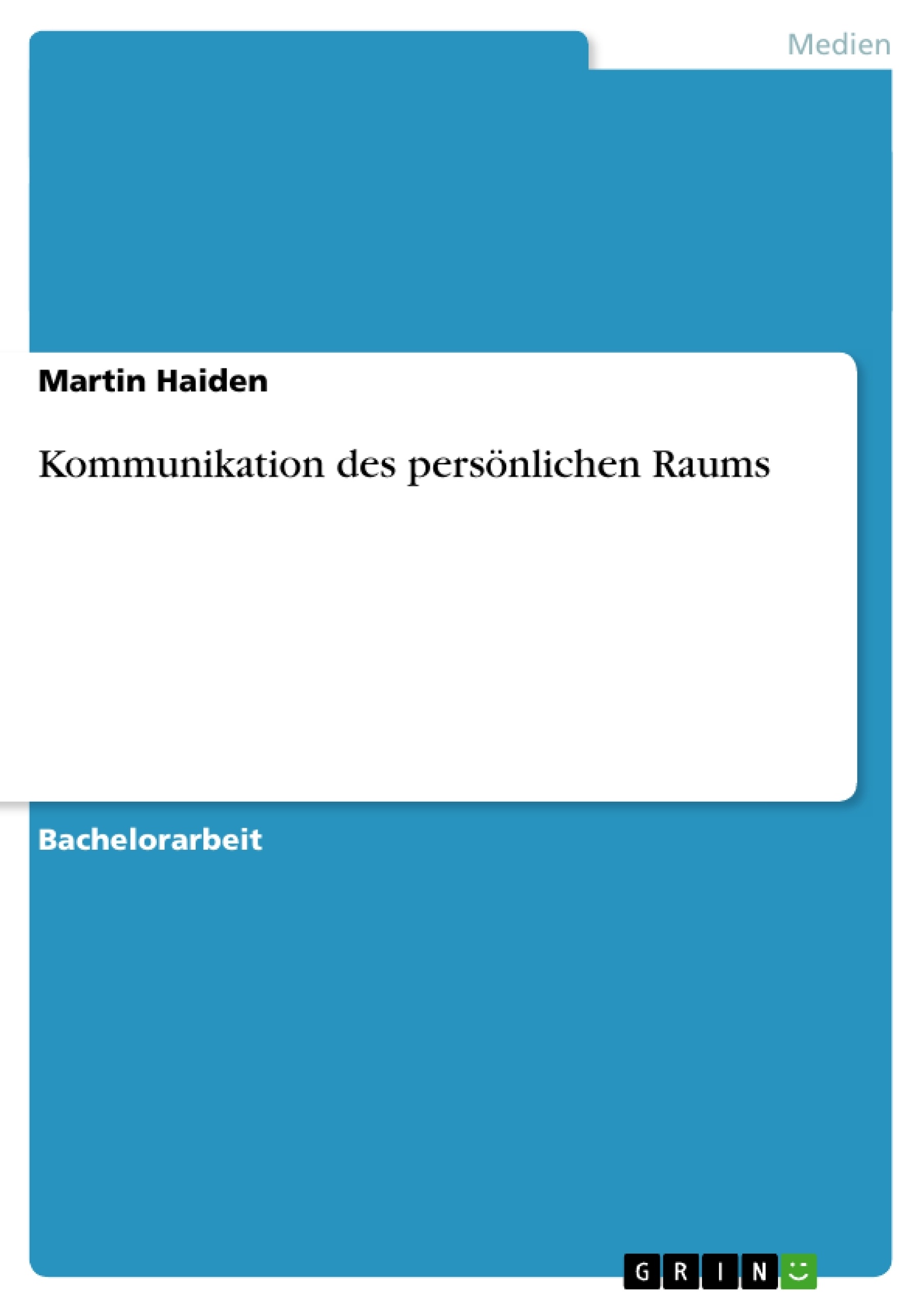Die Menschheit agiert im Raum. Das Individuum füllt mit seinem Körper einen gewissen Raum in unserer Welt aus und beansprucht diesen. Um jedoch handlungsfähig und sicher zu bleiben, hört dieser beanspruchte Raum nicht mit der Körpergrenze, also der Haut, auf, sondern das Individuum benötigt mehr Platz - um agieren zu können und um sich mögliche Feinde vom Leib zu halten. Dieser Raum, der persönliche Raum oder Personal Space 1 , endet erst mit dem Erreichen der sensomotorischen Grenzen. Wer wie weit in dieses kleine Stück Privatsphäre eindringen darf, entscheidet das Individuum von Situation zu Situation aufs Neue und kommuniziert dieses. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt bei der Art und Weise, wie Raum, im Speziellen der persönliche Raum, kommuniziert wird. Wobei nach Maletzke Kommunikation im engen Sinne zu verstehen ist, also als ein „Vorgang der Verständigung und der Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen“ (MALETZKE 1963: 18).
Um die kommunikativen Verhaltensweisen in Bezug auf den Personal Space untersuchen zu können, werde ich zuerst versuchen, die Bedeutung des Raums für das Individuum (Kapitel 2.1) näher zu erläutern und das Bedürfnis nach einem eigenen, einem persönlichen Raum zu erörtern (Kapitel 2.2). Kapitel 2.3 ist den Funktionen des persönlichen Raums und den theoretischen Konzepten zum räumlichen Verhalten gewidmet. In Kapitel 2.4 werde ich die Differenzierung des Personal Space in eine Intime, eine Persönliche, eine Soziale und eine Öffentliche Zone erläutern, die von dem Anthropologen Edward T. Hall in seinem Werk „The Hidden Dimension“ (1966) vorgenommen wurde, und versuchen, den einzelnen Distanzzonen sensomotorische und somit kommunikative Möglichkeiten zuzuschreiben. Das Forschungsinteresse dieser Bakkalaureatsarbeit besteht darin zu untersuchen, wie diese unterschiedlichen Distanzzonen und deren Grenzen kommuniziert werden. Der Hauptaspekt liegt also bei der Kommunikation von Raum, im Speziellen der Kommunikation des persönlichen Raums (Kapitel 3). Hierbei werde ich, nach der sensorischen Erfassung gegliedert, erörtern, welche Möglichkeiten der Kommunikation von Distanzverhältnissen bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Raum, Raumbedürfnis und Personal Space
- 2.1 Raum
- 2.1.1 Der orientierte Raum
- 2.1.2 Der gestimmte Raum
- 2.2 Raumbedürfnis
- 2.3 Personal Space
- 2.3.1 Funktionen des Personal Space
- 2.3.2 Theoretische Konzepte
- a) Gleichgewichtstheorie (Equilibrium Theory)
- b) Attributionstheorie (Attribution Theory)
- c) Erwartungstheorie
- 2.4 Personal Space nach HALL
- 2.4.1 Intime Distanz
- 2.4.2 Persönliche Distanz
- 2.4.3 Soziale Distanz
- 2.4.4 Öffentliche Distanz
- 3. Kommunikation des persönlichen Raums
- 3.1 Kommunikation, Verhalten und Interaktion
- 3.1.1 Kommunikation
- 3.1.2 Verhalten
- 3.1.3 Interaktion
- 3.2 Kommunikation der Grenzen des persönlichen Raums
- 3.2.1 Auditive Kommunikation
- a) Sprache
- b) Nonverbale Vokalisierungen
- 3.2.2 Visuelle Kommunikation
- a) Blick
- b) Mimik
- c) Gestik Körperbewegungen
- d) Körperhaltung
- e) Kleidung und andere Aspekte der äußeren Erscheinung
- f) Proxemik (Räumliches Verhalten)
- 3.2.3 Taktile Kommunikation
- 3.2.4 Olfaktorische Kommunikation
- 3.2.5 Gustatorische Kommunikation
- 3.3 Beeinflussende Parameter
- 3.3.1 Personenbezogene Unterschiede
- 3.3.2 Situative Unterschiede
- 3.3.3 Prothesen und Verlängerungen
- 4. Resümee
- 4.1 Intime Distanz
- 4.2 Persönliche Distanz
- 4.3 Soziale Distanz
- 4.4 Öffentliche Distanz
- 5. Das andere archimedische Prinzip - ein Beispiel
- 5.1 Hintergrund
- 5.2 Die gestörten Kreise
- 5.2.1 Archimedes
- 5.2.2 Der römische Legionär
- 5.2.3 Das Zusammentreffen
- 6. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kommunikation des persönlichen Raums. Ziel ist es, die verschiedenen kommunikativen Verhaltensweisen im Bezug auf den Personal Space zu analysieren und zu systematisieren. Dabei wird insbesondere auf die von Edward T. Hall beschriebenen Distanzzonen eingegangen und deren kommunikative Aspekte detailliert beleuchtet.
- Der persönliche Raum und sein Bedürfnis
- Theoretische Konzepte zum räumlichen Verhalten
- Kommunikation des persönlichen Raums durch verschiedene Sinne (auditiv, visuell, taktil, olfaktorisch, gustatorisch)
- Beeinflussende Parameter (personenbezogen, situativ)
- Anwendung der Theorie anhand eines Beispiels (Archimedes)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema der Kommunikation des persönlichen Raums ein. Sie beschreibt das grundlegende Bedürfnis des Individuums nach einem persönlichen Raum, der über die physische Körpergrenze hinausgeht, und erklärt das Erkenntnisinteresse der Arbeit: die Untersuchung der kommunikativen Verhaltensweisen in Bezug auf diesen Raum. Die Arbeit von Edward T. Hall wird als wichtiger Ausgangspunkt erwähnt, dessen Systematisierung jedoch verfeinert werden soll.
2. Raum, Raumbedürfnis und Personal Space: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis des persönlichen Raums. Es erläutert zunächst den Begriff des Raumes an sich, inklusive der Konzepte des orientierten und gestimmten Raumes, und führt dann das Raumbedürfnis und den Personal Space als individuellen, vom Menschen beanspruchten und kommunizierten Raum ein. Es werden verschiedene theoretische Konzepte wie die Gleichgewichts-, Attributions- und Erwartungstheorie vorgestellt, bevor Halls vier Distanzzonen (intim, persönlich, sozial, öffentlich) detailliert beschrieben werden. Der Fokus liegt auf der Definition und den grundlegenden Funktionen des Personal Space.
3. Kommunikation des persönlichen Raums: Dieser zentrale Teil der Arbeit beschreibt detailliert, wie die Grenzen des persönlichen Raums kommuniziert werden. Es werden verschiedene Kommunikationskanäle untersucht: auditive Kommunikation (Sprache und nonverbale Vokalisierungen), visuelle Kommunikation (Blick, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kleidung, Proxemik), taktile Kommunikation, olfaktorische und gustatorische Kommunikation. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Möglichkeiten, Distanzverhältnisse auszudrücken und zu interpretieren, und stellt somit den Kern der Untersuchung dar. Es geht über die reine Beschreibung Halls hinaus und systematisiert die verschiedenen kommunikativen Handlungen.
4. Resümee: Das Resümee fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und präsentiert diese vermutlich in tabellarischer Form (im Originaltext angedeutet), wobei die verschiedenen Distanzzonen und die dazugehörigen kommunikativen Handlungen übersichtlich dargestellt werden. Es bietet einen kurzen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zur Kommunikation des persönlichen Raums.
5. Das andere archimedische Prinzip - ein Beispiel: Dieses Kapitel dient als Exkurs und veranschaulicht die theoretischen Überlegungen anhand eines Beispiels mit Bezug zu Archimedes. Es soll das in den vorherigen Kapiteln beschriebene Distanzverhalten anhand einer konkreten Geschichte veranschaulichen und die Theorie greifbarer machen. Die Geschichte dient als illustratives Beispiel für die praktischen Implikationen des persönlichen Raums und dessen Kommunikation.
Schlüsselwörter
Personal Space, Raumkommunikation, Distanzzonen, Edward T. Hall, Kommunikation, Verhalten, Interaktion, auditive Kommunikation, visuelle Kommunikation, taktile Kommunikation, olfaktorische Kommunikation, gustatorische Kommunikation, Proxemik, Gleichgewichtstheorie, Attributionstheorie, Erwartungstheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kommunikation des persönlichen Raums"
Was ist der Inhalt des Textes "Kommunikation des persönlichen Raums"?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Kommunikation des persönlichen Raums. Er behandelt die Definition und die verschiedenen theoretischen Konzepte des Personal Space, analysiert die Kommunikation des persönlichen Raums über verschiedene Sinneskanäle (auditiv, visuell, taktil, olfaktorisch, gustatorisch) und untersucht beeinflussende Parameter (personenbezogen und situativ). Ein Beispiel mit Bezug zu Archimedes veranschaulicht die Anwendung der Theorie in der Praxis.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einführung, 2. Raum, Raumbedürfnis und Personal Space, 3. Kommunikation des persönlichen Raums, 4. Resümee, 5. Das andere archimedische Prinzip - ein Beispiel, und 6. Schlusswort. Jedes Kapitel baut aufeinander auf und vertieft das Verständnis der Kommunikation des persönlichen Raums.
Welche Hauptthemen werden im Text behandelt?
Die Hauptthemen sind der persönliche Raum und sein Bedürfnis, theoretische Konzepte zum räumlichen Verhalten (wie Gleichgewichts-, Attributions- und Erwartungstheorie), die Kommunikation des persönlichen Raums über verschiedene Sinne, beeinflussende Parameter (personenbezogene und situative Unterschiede), und die Anwendung der Theorie anhand eines Beispiels (Archimedes).
Welche Rolle spielt Edward T. Hall im Text?
Edward T. Hall's Arbeit zur Proxemik und seinen vier Distanzzonen (intim, persönlich, sozial, öffentlich) bildet einen wichtigen Ausgangspunkt. Der Text baut auf Halls Theorie auf, verfeinert diese jedoch und erweitert sie durch die detaillierte Analyse verschiedener Kommunikationskanäle.
Welche Kommunikationskanäle werden im Bezug auf den Personal Space untersucht?
Der Text untersucht die Kommunikation des persönlichen Raums über auditive (Sprache, nonverbale Vokalisierungen), visuelle (Blick, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kleidung, Proxemik), taktile, olfaktorische und gustatorische Kanäle. Es wird analysiert, wie diese Kanäle zur Kommunikation von Distanz und zur Interpretation von Distanzverhältnissen beitragen.
Welche beeinflussenden Parameter werden berücksichtigt?
Der Text berücksichtigt sowohl personen- als auch situationsbezogene Unterschiede als beeinflussende Parameter. Personenbezogene Unterschiede beziehen sich auf individuelle Präferenzen bezüglich des Personal Space, während situationsbezogene Unterschiede den Kontext der Interaktion (z.B. formell vs. informell) betreffen. Auch Prothesen und Verlängerungen werden als Einflussfaktoren erwähnt.
Wie wird die Theorie anhand eines Beispiels veranschaulicht?
Die Theorie wird anhand eines Beispiels mit Bezug zu Archimedes veranschaulicht. Eine fiktive Geschichte zeigt, wie die beschriebenen Distanzverhältnisse in einer konkreten Situation zum Tragen kommen und wie Missverständnisse aufgrund von unterschiedlichen Personal Space-Präferenzen entstehen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Personal Space, Raumkommunikation, Distanzzonen, Edward T. Hall, Kommunikation, Verhalten, Interaktion, auditive Kommunikation, visuelle Kommunikation, taktile Kommunikation, olfaktorische Kommunikation, gustatorische Kommunikation, Proxemik, Gleichgewichtstheorie, Attributionstheorie, Erwartungstheorie.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Der Text enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen jedes Kapitels übersichtlich darstellt und den Lesefluss erleichtert.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text eignet sich für alle, die sich akademisch mit der Kommunikation des persönlichen Raums auseinandersetzen wollen. Er bietet eine fundierte und systematische Analyse des Themas und ist daher insbesondere für Studierende und Wissenschaftler relevant.
- Quote paper
- Martin Haiden (Author), 2004, Kommunikation des persönlichen Raums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29839