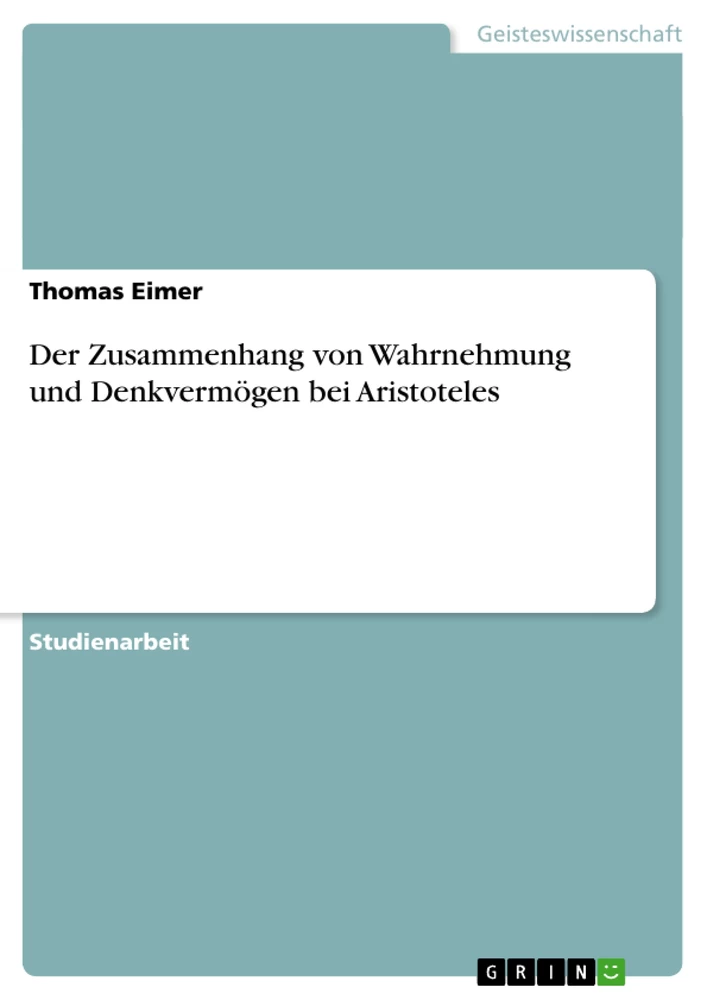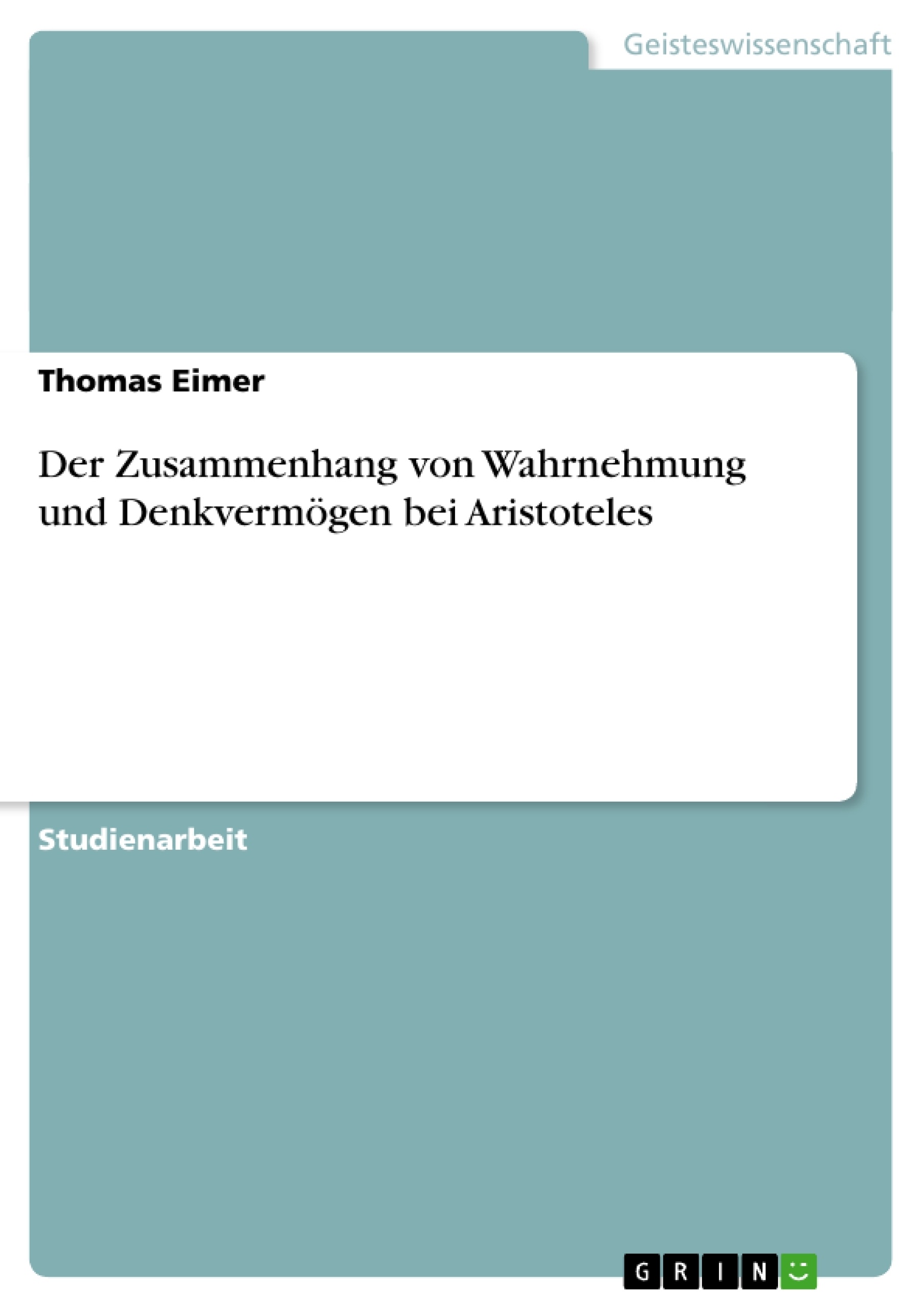Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, den inneren Zusammenhang von menschlichem Wahrnehmen und Denken nachzuzeichnen, der die Schriften des Aristoteles durchzieht. Dabei werden physiologische, erkenntnistheoretische, ontologische und ansatzweise auch metaphysische Ansichten des Philosophen auf diese Fragestellung hin durchleuchtet. Die Interpretation erfolgt vor dem Hintergrund der Schriften eines neuzeitlichen Denkers, René Descartes. Dabei soll keinesfalls ein umfassender Vergleich der aristotelischen Schriften mit dem Rationalismus der Neuzeit angestrengt werden; vielmehr geht es darum, die Charakteristik der aristotelischen Erkenntnistheorie vor der Folie eines diametral entgegen gesetzten Denkens stärker zu konturieren und ihre Distanz zu Erklärungsansätzen der Neuzeit deutlich zu machen. Im ersten Abschnitt der Arbeit werden die Wahrnehmungsvermögen nach Aristoteles vorgestellt, wobei sich zwei wesentliche Besonderheiten zeigen lassen: Zum einen nimmt Aristoteles’ Bestimmung von sinnlicher Erkenntnis ihren Anstoß bei der Gegenstandswelt, zum anderen ist bereits die Wahrnehmung in die Interpretation der Sinnesdaten involviert. Der zweite Abschnitt behandelt den leidenden Verstand. Der Schlüsselbegriff für diese psychische Instanz liegt für Aristoteles im Vorstellungsvermögen und der spezifischen Ausprägung seiner Ansicht der Wahrnehmungswelt. Im dritten Abschnitt der Arbeit folgt die Erörterung der tätigen Vernunft, jenes Seelenteils also, der nach Aristoteles nur dem Menschen zukommt. Es zeigt sich auch hier, dass Aristoteles das Denkvermögen keinesfalls unabhängig von Wahrnehmungsvermögen und -inhalten sieht, sondern vielmehr eine Kongruenz von Wahrnehmungswelt und Denkseele als möglich herausstellt. Die Ergebnisse der Arbeit werden abschließend zusammengefasst und vor dem Hintergrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnis bewertet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Bedeutung der Wahrnehmung für das Denken
- Die Vermögen des leidenden Verstandes
- Die Vermögen der tätigen Vernunft
- Zusammenfassung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den inneren Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Denken bei Aristoteles. Sie beleuchtet physiologische, erkenntnistheoretische und ontologische Aspekte, unter Berücksichtigung metaphysischer Ansätze. Der Vergleich mit Descartes dient dazu, die Eigenheiten der aristotelischen Erkenntnistheorie herauszustellen und deren Distanz zu neuzeitlichen Erklärungsansätzen zu verdeutlichen.
- Die enge Verknüpfung von Wahrnehmung und Denken bei Aristoteles
- Die Rolle der Sinneswahrnehmung in der aristotelischen Erkenntnistheorie
- Der leidende Verstand und seine Funktion im Erkenntnisprozess
- Die tätige Vernunft und ihre Beziehung zur Wahrnehmung
- Der Vergleich der aristotelischen Philosophie mit dem neuzeitlichen Rationalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Denken bei Aristoteles, indem sie physiologische, erkenntnistheoretische, ontologische und teilweise metaphysische Aspekte untersucht. Der Vergleich mit Descartes dient der Konturierung der aristotelischen Erkenntnistheorie und der Hervorhebung ihrer Unterschiede zum neuzeitlichen Denken. Die Arbeit gliedert sich in Abschnitte über die Wahrnehmungsvermögen, den leidenden Verstand und die tätige Vernunft.
Zur Bedeutung der Wahrnehmung für das Denken: Aristoteles verbindet Denken eng mit Wahrnehmung. Die Metaphysik betont das Wissensstreben des Menschen, verbunden mit der „Liebe zu den Sinneswahrnehmungen”. Im Gegensatz zu Descartes, der an der Zuverlässigkeit sinnlicher Erfahrung zweifelt, sieht Aristoteles die Sinneswahrnehmung als wesentlichen Bestandteil des Vernunftvermögens. Die Arbeit erläutert, wie die Wahrnehmungsfähigkeit an einen Teil der Seele gebunden ist, der Mensch und Tier gemein ist, im Gegensatz zu Pflanzen.
Die Vermögen des leidenden Verstandes: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem leidenden Verstand bei Aristoteles, dessen Schlüsselbegriff das Vorstellungsvermögen ist. Es wird die spezifische Ausprägung seiner Wahrnehmungswelt analysiert. Die Arbeit diskutiert die Verbindung zwischen Wahrnehmung, Vorstellungsvermögen und dem leidenden Verstand im Kontext der aristotelischen Philosophie. Es wird hervorgehoben, wie diese Instanz die Grundlage für das höhere Denken bildet. Die Bedeutung der sinnlichen Eindrücke für die Bildung von Vorstellungen steht im Mittelpunkt.
Die Vermögen der tätigen Vernunft: Dieser Abschnitt behandelt die tätige Vernunft, den dem Menschen vorbehaltenen Seelenteil. Es wird gezeigt, dass Aristoteles das Denkvermögen nicht unabhängig von der Wahrnehmung sieht, sondern eine Kongruenz von Wahrnehmungswelt und Denkseele postuliert. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen tätiger Vernunft und den Ergebnissen des leidenden Verstandes, um das Verständnis des Denkprozesses bei Aristoteles zu vertiefen. Der Fokus liegt auf der Synthese von sinnlichen Erfahrungen und rationalen Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Aristoteles, Wahrnehmung, Denken, Erkenntnistheorie, leidender Verstand, tätige Vernunft, Sinneswahrnehmung, Rationalismus, Descartes, Metaphysik, Ontologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aristoteles' Wahrnehmung und Denken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den engen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Denken bei Aristoteles. Sie beleuchtet dabei physiologische, erkenntnistheoretische und ontologische Aspekte und bezieht auch metaphysische Ansätze mit ein. Ein Vergleich mit Descartes dient dazu, die Eigenheiten der aristotelischen Erkenntnistheorie hervorzuheben und deren Unterschiede zum neuzeitlichen Denken zu verdeutlichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die enge Verknüpfung von Wahrnehmung und Denken bei Aristoteles, die Rolle der Sinneswahrnehmung in seiner Erkenntnistheorie, die Funktion des leidenden Verstandes im Erkenntnisprozess, die Beziehung zwischen tätiger Vernunft und Wahrnehmung, sowie einen Vergleich der aristotelischen Philosophie mit dem neuzeitlichen Rationalismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bedeutung der Wahrnehmung für das Denken, ein Kapitel zu den Vermögen des leidenden Verstandes, ein Kapitel zu den Vermögen der tätigen Vernunft und eine Zusammenfassung mit Kritik.
Wie beschreibt die Arbeit die Rolle der Wahrnehmung im Denken bei Aristoteles?
Aristoteles verbindet Denken eng mit der Wahrnehmung. Im Gegensatz zu Descartes, der an der Zuverlässigkeit sinnlicher Erfahrung zweifelt, sieht Aristoteles die Sinneswahrnehmung als wesentlichen Bestandteil des Vernunftvermögens. Die Wahrnehmungsfähigkeit ist dabei an einen Teil der Seele gebunden, der Mensch und Tier gemein ist.
Was ist die Funktion des "leidenden Verstandes" laut der Arbeit?
Der Abschnitt über den leidenden Verstand analysiert dessen Schlüsselbegriff, das Vorstellungsvermögen, und untersucht dessen spezifische Ausprägung der Wahrnehmungswelt. Es wird die Verbindung zwischen Wahrnehmung, Vorstellungsvermögen und dem leidenden Verstand im Kontext der aristotelischen Philosophie diskutiert. Dieser wird als Grundlage für das höhere Denken betrachtet, wobei die Bedeutung der sinnlichen Eindrücke für die Bildung von Vorstellungen im Mittelpunkt steht.
Welche Rolle spielt die "tätige Vernunft" in der aristotelischen Erkenntnistheorie?
Die tätige Vernunft, der dem Menschen vorbehaltene Seelenteil, wird als nicht unabhängig von der Wahrnehmung betrachtet. Aristoteles postuliert eine Kongruenz von Wahrnehmungswelt und Denkseele. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen tätiger Vernunft und den Ergebnissen des leidenden Verstandes, um den Denkprozess bei Aristoteles zu vertiefen. Der Fokus liegt auf der Synthese von sinnlichen Erfahrungen und rationalen Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind Aristoteles, Wahrnehmung, Denken, Erkenntnistheorie, leidender Verstand, tätige Vernunft, Sinneswahrnehmung, Rationalismus, Descartes, Metaphysik und Ontologie.
Wie wird Descartes in die Analyse einbezogen?
Der Vergleich mit Descartes dient dazu, die Eigenheiten der aristotelischen Erkenntnistheorie herauszustellen und deren Distanz zu neuzeitlichen Erklärungsansätzen zu verdeutlichen. Der Unterschied in der Bewertung der Zuverlässigkeit sinnlicher Erfahrung wird besonders hervorgehoben.
- Quote paper
- Thomas Eimer (Author), 2004, Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Denkvermögen bei Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29835