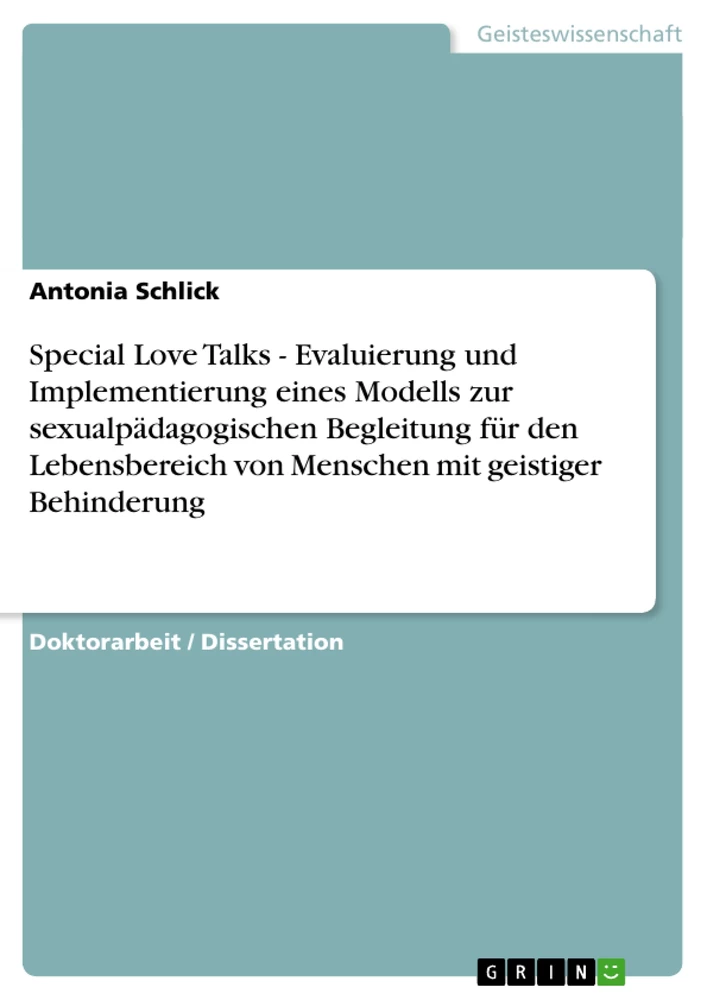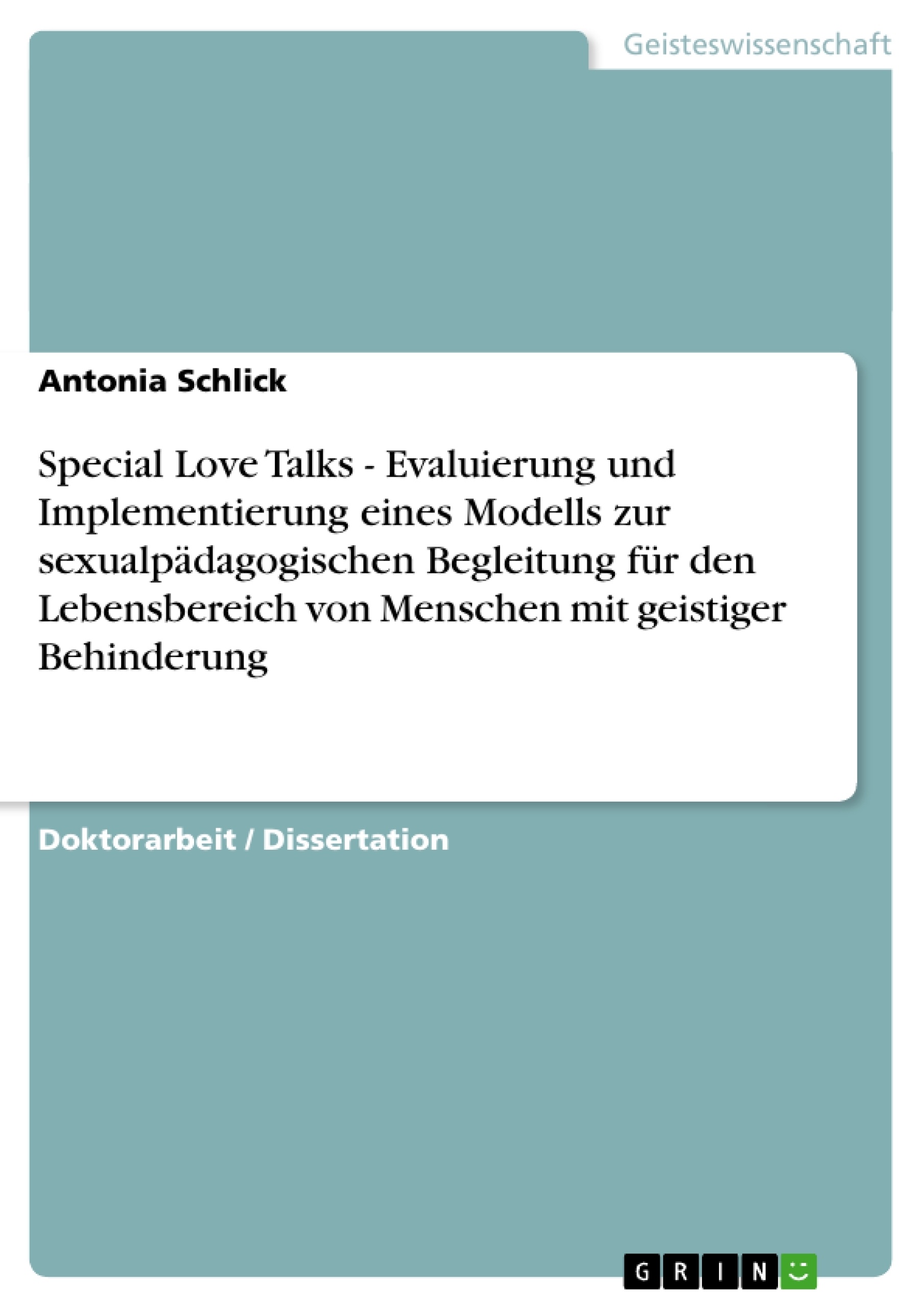Sexualität bei Menschen mit Behinderungen ist seit ungefähr 20 Jahren ein aktuelles Thema (Fegert & Müller, 2001). Zunächst bezogen sich die Publikationen allgemein auf Menschen mit Behinderungen. Geistig behinderten Menschen wurde zu dieser Zeit das Bedürfnis nach Sexualität häufig noch abgesprochen. In vielen Behinderteneinrichtungen wurde sogar darauf geachtet, Sexualität zu verhindern.
Mittlerweile rückt die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und geistiger Behinderung immer stärker ins Blickfeld, auch wenn sich die Themen häufig nur auf Verhütung von Schwangerschaft und Sterilisation beziehen. Es gibt jedoch immer mehr Autoren, die Sexualität als ein Recht und ein Bedürfnis in der normalen Persönlichkeitsentwicklung, auch von Menschen mit geistiger Behinderung, betrachten.
Dass Menschen mit geistiger Behinderung ein Recht auf Sexualität und Sexualerziehung haben, bestreitet heutzutage kaum mehr jemand. Sexualität gilt zwar als Grundbedürfnis des Menschen, stellt aber trotzdem noch ein großes Tabu dar, vor allem, wenn es um die Kommunikation darüber geht. Obwohl Sexualität einerseits sehr öffentlich geworden ist (zum Beispiel in den Medien) ist es uns andererseits noch nicht gelungen, eine angemessene Sprache der Sexualität zu entwickeln, die es möglich macht, die Kommunikationslosigkeit zu brechen. Kaum ein Kind hat in seiner Jugend mit seinen Eltern über Sexualität gesprochen. Zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen bleibt ein Stück Sprachlosigkeit. Im Zusammenhang mit dem Themenbereich ‘Sexualität’ ergeben sich bei Menschen mit geistiger Behinderung eine Reihe von Problemen. Auf der einen Seite ist man mit ähnlichen Bedürfnissen konfrontiert wie sonst auch, auf der anderen Seite sind durch die meist kognitiven und körperlichen Einschränkungen der Menschen mit Behinderungen die Kommunikation, das Verständnis und der Zugang zu sich selbst, zusätzlich erschwert.
Viele Personen, die mit Menschen mit geistiger Behinderung in engem Kontakt sind, sind zu wenig informiert, teilweise hilflos und mit dem Thema und den daraus folgenden Situationen überfordert.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil A) Theoretischer Teil
1 Einleitung
1.1 Aufbau der Arbeit
2 Evaluation
2.1 Definitionsversuch von Evaluation
2.2 Funktionen und Ziele von Evaluation
2.3 Modelle und Formen der Evaluation
2.4 Gestaltungskomponenten von Evaluationsstudien
2.5 Methoden der Evaluation
2.6 Effektivität und Wirksamkeit
2.7 Notwendigkeit der Evaluation
3 Geistige Behinderung
3.1 Allgemeine Begriffsbestimmung
3.2 Definition nach der AAMR
3.3 Alternative Perspektiven
3.3.1 Einteilung von geistiger Behinderung im deutschsprachigen Raum .
3.3.2 Der Mehrebenenansatz zur Erläuterung der geistigen Behinderung
3.4 Gesamtbetrachtung von Geistiger Behinderung
4 Sexualität und Geistige Behinderung
4.1 Begriffsbestimmung: Sexualität
4.2 Die sexuelle Entwicklung
4.2.1 Die körperlich sexuelle Entwicklung
4.2.2 Die psychosexuelle Entwicklung
4.2.3 Ausdrucksformen kindlicher Sexualität
4.2.4 Die Diskrepanz zwischen Sexualalter und Intelligenzalter
4.3 Sexualität im engerem Sinn
4.3.1 Masturbation
4.3.2 Geschlechtsverkehr
4.3.3 Homosexualität
4.3.4 Partnerschaft und Ehe
4.3.5 Kinderwunsch und Elternschaft
4.3.6 Verhütung
4.3.7 Sterilisation
4.3.8 Schwangerschaftsabbruch
5 Einstellungen zur Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung
5.1 Aspekte der Entstehung der Einstellung zu Behinderten
5.2 Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung
5.3 Einstellungen und Vorurteile zur Sexualität von Menschen mit geistiger Be- hinderung
5.4 Sexualität und ihre Einschränkungen
5.5 Die Abhängigkeit der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderungen von ihrem Umfeld
6 Sexualpädagogische Begleitung
6.1 Begriffsbestimmung
6.2 Aufgabenbereiche der Sexualerziehung
6.3 Die Rolle der Betreuer 73 Zusammenfassung und Resümee des Theorieteils
Teil B) Entwicklungsteil
7 ‘Love Talks’
7.1 Entstehung und Erarbeitung des Modells
7.2 Pilotprojekt und Implementierung
7.3 Weiterführende Projekte und Ziele
8 Evaluation von ‘Love Talks’
8.1 Evaluation des Pilotprojektes
8.1.1 Erster Ausbildungslehrgang
8.2 Externe Evaluation durch Pädagogische Akademien
8.3 Evaluation in Bezug auf Kommunikations- und Gesundheitsförderung des Modells
8.4 Evaluierungsstudie 2001 durch die Human- und sozialwissenschaftliche Fa- kultät der Universität Wien
8.5 Gesamtbetrachtung der Ergebnisse
9 ‘Special Love Talks’
9.1 Entwicklung des Modells
9.2 Darstellung der Grundlagenforschung
9.2.1 Wissen und Einstellung von Mitarbeitern (Assistenten) in Behinder- tenorganisationen
9.2.2 Wissen und Einstellung von Gynäkologen
9.2.3 Wissen und Einstellung von Eltern und Angehörigen
9.2.4 Wissen und Einstellung von Menschen mit geistiger Behinderung
9.2.5 Gesamtbetrachtung der Grundlagenforschung
9.3 Konzeption und Darstellung
9.3.1 Ziele
Teil C) Empirischer Teil
10 Empirische Untersuchung
10.1 Fragestellungen
10.1.1 Fragestellungen zu Entscheidungskriterium 1
10.1.2 Fragestellungen zu Entscheidungskriterium 2
10.1.3 Fragestellungen zu Entscheidungskriterium 3
11 Methodik und Versuchsplanung
11.1 Fragebögen
11.1.1 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung
11.1.2 Evaluationsfragebogen: Beurteilung der einzelnen Arbeitskreise
11.1.3 Evaluationsfragebogen: ‘Follow up’
11.1.4 Expertenbefragung
11.2 Design und Untersuchungsablauf
11.3 Stichprobe
11.3.1 Entscheidung
11.3.2 Erhebung der Einstellung: 2 Messzeitpunkte
11.3.3 Evaluierung der einzelnen Arbeitskreise des Pilotprojektes
11.3.4 Nachuntersuchung: Evaluierung ‘Special Love Talks’
12 Ergebnisse
12.1 Auswertungsmethodik
12.2 Auswertung bezogen auf die Fragestellungen
12.3 Ergebnisse zum Entscheidungskriterium 1
12.3.1 Ergebnisse zu Fragestellung 1
12.3.2 Ergebnisse zu Fragestellung 2
12.3.3 Ergebnisse zu Fragestellung 3
12.3.4 Ergebnisse zu Fragestellung 4
12.4 Ergebnisse zum Entscheidungskriterium 2
12.4.1 Ergebnisse zu Fragestellung 5
12.4.2 Ergebnisse zu Fragestellung 6
12.5 Ergebnisse zum Entscheidungskriterium 3
12.5.1 Ergebnisse zu Fragestellung 7
12.5.2 Ergebnisse zu Fragestellung 8
12.5.3 Ergebnisse zu Fragestellung 9
12.6 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
12.6.1 Entscheidungskriterium 1
12.6.2 Entscheidungskriterium 2
12.6.3 Entscheidungskriterium 3
13 Weiterführung des Modells
13.1 Beschreibung der Veränderungen und Darstellung des endgültigen Designs
13.2 Zufriedenheit der Teilnehmer
13.2.1 Methodik: Beschreibung des Rückmeldebogens .
13.2.2 Erste Zufriedenheitsdaten
14 Diskussion und Ausblick
14.1 Methodik und Studiendesign
14.2 Ergebnisse
14.3 Ausblick
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Linkverzeichnis
Anhänge
Anhang A: Praxisbeispiele
Anhang A.1: Bildmaterial zur Themenfindung
Anhang A.2: Methoden zur Themenbearbeitung
Anhang A.3: Weitere Informationen
Anhang B: Fragebögen
Anhang B.1: Fragebogen zur Erfassung der Einstellung
Anhang B.2: Evaluationsfragebogen: Beurteilung der einzelnen Arbeits- kreistreffen
Anhang B.3: Evaluationsfragebogen ‘Follow up’
Anhang B.4: Expertenbefragung
Anhang B.5: Rückmeldebogen
Abbildungsverzeichnis
1 Bedeutungsschema des Mehrebenenansatzes nach Kobi, 1993
2 Biologisch-hormonelle Entwicklung vs. psychosexuelle beziehungsweise kognitive Entwicklung bei geistiger Behinderung
3 Voraussetzungen für sexualpädagogisches Wirken (Hoyler-Hermann, 2002, S. 202)
4 Ablauf: Die drei aufeinanderfolgenden Schritte des Modells ‘Love Talks’ (Steck, 1999, S. 21)
5 Die vier Hauptkomponenten des Fragebogens der Grundlagenforschung. Die Pfeile symbolisieren die Zusammenhänge der Komponenten
6 Die drei aufeinanderfolgenden Schritte des Ablaufs des Modells ‘Special Love Talks’
7 Darstellung des Untersuchungsdesigns und Untersuchungsablaufes
8 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise (Messzeitpunkte), MmB = Menschen mit Behinderungen
9 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
10 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise (Messzeitpunkte, MmB = Menschen mit Behinderungen)
11 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
12 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise(Messzeitpunkte), MmB = Menschen mit Behinderungen
13 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
14 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise (Messzeitpunkte), MmB = Menschen mit Behinderungen
15 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
16 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise (Messzeitpunkte, MmB = Menschen mit Behinderungen
17 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
18 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Teilnehmergruppen über 5 Arbeits- kreise (Messzeitpunkte), MmB = Menschen mit Behinderungen
19 Mittelwerte der Bewertung der einzelnen Behinderteneinrichtungen (BE) über 5 Arbeitskreise (Messzeitpunkte)
20 Bewertung des Projektes (Frage 1), Einschätzung der Zufriedenheit der Men- schen mit Behinderungen mit dem Projekt (Frage 2), Bewertung der Arbeits- kreise (Frage 3) und die Bewertung der Möglichkeit, persönliche Fragen ein- zubringen (Frage 4)
21 Bewertung der Arbeitskreise und des Projektes anhand von Schulnoten
22 Fachliche Bewertung der Moderatoren (Frage 1), organisatorische Zufrie- denheit (Frage 2), methodische Zufriedenheit (Frage 3) und Zufriedenheit mit der Kommunikationsfähigkeit der Moderatoren (Frage 4)
23 Bewertung des Einsatzes von Lehrmaterial und Medien von den Moderatoren
24 Sexualerziehung vorwiegend im Elternhaus (Frage 1), Sexualerziehung vor- wiegend in der Behinderteneinrichtung (Frage 2), Sexualerziehung vorwie- gend von Experten (Frage 3), Zusammenarbeit aller Beteiligten Gruppen (Frage 4) und Moderation von Außen (Frage 5)
25 Verbesserung der Beziehung zu den Mitarbeitern (Frage 1), Verbesserung der Beziehung zu den Eltern (Frage 2), Verbesserung der Beziehung zu den Menschen mit Behinderungen (Frage 3), Verbesserung der Beziehung der Bewohner zueinander (Frage 4). Mein Kind/Klient kommt mit persönlichen Fragen zu mir (Frage 5)
26 Teilnahme gelohnt (Frage 1), Fühle mich weniger verunsichert (Frage 2), weniger Berührungsängste (Frage 3), fühle mich gewachsener im Umgang mit sexualpädagogischen Fragen (Frage 4), Anregungen für weitere sexual- pädagogische Aktivitäten (Frage 5), fachliche Auswirkungen (Frage 6)
27 Beteilige mich gerne (Frage 1), Würde wieder teilnehmen (Frage 2)
28 Tatsächlicher Zeitaufwand der Teilnehmer bei den Arbeitskreisen und dem darauffolgenden Projekt
29 Für das Gelingen ausschlaggebend? MmB = Menschen mit Behinderungen
30 Mitarbeiter und Eltern ausreichend auf Thema vorbereitet (Frage 1), zukünf- tig mehr Augenmerk auf Thema (Frage 2), Arbeitskreise auch für andere Themen vorstellbar (Frage 3)
31 Vergleich der Einstellung zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe, vor und nach ‘Special Love Talks’, Gesamtliberalitätswert
32 Vergleich der Einstellung zwischen Eltern und Mitarbeiter der Untersu- chungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Gesamtliberalitätswert
33 Vergleich der Einstellung zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Allgemeine Einstellung’
34 Vergleich der Einstellung zwischen den Befragten der Untersuchungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Allgemeine Einstellung’
35 Vergleich der Einstellung zwischen den Befragten der Untersuchungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Aufklärung’
36 Vergleich der Einstellung zwischen den Befragten der Untersuchungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Vorurteile’
37 Vergleich der Einstellung zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Rechte von Menschen mit Be- hinderungen’
38 Vergleich der Einstellung zwischen den Befragten der Untersuchungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Rechte von Menschen mit Behinderungen’
39 Vergleich der Einstellung zwischen den Befragten der Untersuchungsgruppe vor und nach ‘Special Love Talks’, Subgruppe ‘Rechte Minderjähriger’
40 Die drei aufeinanderfolgenden Schritte des Ablaufs des Modells ‘Special Love Talks’ ohne Interview (ISMB), vgl. Abbildung 6
41 Bildmaterial zur Themenfindung für Menschen mit geistiger Behinderung: Thema Schwangerschaft
42 Bildmaterial zur Themenfindung für Menschen mit geistiger Behinderung: Thema Beziehung
43 Methode zum Thema Beziehung „Liebeshaus“
44 Methode zum Thema Körper „Bildbeispiele: Hand, Penis“
45 Methode zum Thema Körper „Umrissfiguren“
46 Methode zur Projektplanung „Collage“
47 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung (Seite 1)
48 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung (Seite 2)
49 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung (Seite 3)
50 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung (Seite 4)
51 Fragebogen zur Erfassung der Einstellung (Seite 5)
52 Fragebogen für Eltern, Angehörige, MitarbeiterInnen und Menschen mit Be- hinderungen „Sexualität und geistige Behinderung“
53 Fragebogen für Eltern, Angehörige und MitarbeiterInnen „Sexualität und geistige Behinderung“ (Seite 1)
54 Fragebogen für Eltern, Angehörige und MitarbeiterInnen „Sexualität und geistige Behinderung“ (Seite 2)
55 Fragebogen für Eltern, Angehörige und MitarbeiterInnen „Sexualität und geistige Behinderung“ (Seite 3)
56 Fragebogen für Eltern, Angehörige und MitarbeiterInnen „Sexualität und geistige Behinderung“ (Seite 4)
57 Fragebogen für Eltern, Angehörige und MitarbeiterInnen „Sexualität und geistige Behinderung“ (Seite 5)
58 Fragebogen für Experten zur Evaluierung des Modells „Special Love Talks “ (Seite 1)
59 Fragebogen für Experten zur Evaluierung des Modells „Special Love Talks “ (Seite 2)
60 Rückmeldebogen zu den Arbeitskreistreffen zur Sexualerziehung (Seite 1)
61 Rückmeldebogen zu den Arbeitskreistreffen zur Sexualerziehung (Seite 2)
Tabellenverzeichnis
1 Gegenüberstellung der Dimensionsmodelle von 1992 und 2002
2 Rangreihung der wichtigsten Themen der Arbeitskreise und der Projekte, aufgeschlüsselt nach Eltern, Lehrern und Schülern (Brenn et al., 1998, S. 18/19)
3 Themen, die in den Augen der Schüler nicht ausreichend behandelt wurden (Brenn et al., 1998, S. 19)
4 Sexualpädagogisches Gesamtkonzept
5 Gesamtliberalitätswerte aller Vergleichsgruppen
6 Verteilung der Stichprobe der freiwilligen Personen, welche an ‘Special Love Talks’ teilnehmen
7 Stichprobe der Einstellungserhebung
8 Gesamtteilnehmer der Evaluierungserhebung
9 Gesamtteilnehmer der Evaluationserhebung
10 Altersverteilung der Untersuchungs- und Kontrollgruppe
11 Geschlechtsverteilung der Untersuchungs- und Kontrollgruppe
12 Einschätzung der Gläubigkeit der Untersuchungs- und Kontrollgruppe
13 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Frage: Ist Sexualität allgemein ein wichtiges Thema?
14 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Häufig- keit der Gespräche über Sexualität in ihrer Herkunftsfamilie
15 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Häufig- keit der Gespräche über Sexualität in ihrer eigenen Familie
16 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Häufig- keit der Gespräche über Sexualität mit Kollegen und anderen
17 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Beschäf- tigung mit dem Thema
18 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der absolvier- ten Schulungen zum Thema
19 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Beurtei- lung der Wichtigkeit derartiger Schulungen
20 Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich des Wunsches nach mehr Information zum Thema
21 Motivation der Untersuchungsgruppe an ‘Special Love Talks’ teilzunehmen
22 Freiwillige Teilnehmer an ‘Special Love Talks’
23 Gründe der Nichtteilnahme am Modell
24 Wie haben Sie sich beim heutigen Arbeitskreistreffen gefühlt?
25 Wie war das Gesprächsklima in der Gruppe?
26 Wie haben sie die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Bewohnern und Mitar- beitern erlebt?
27 Wichtigste Themen während der Arbeitskreise
28 Rangreihung der wichtigsten Themen der Arbeitskreise
29 Wie haben Sie die Moderatoren erlebt?
30 Wie haben Sie die inhaltliche Bearbeitung der Themen erlebt?
31 Wie würden Sie Ihren persönlichen Gewinn aus dem heutigen Arbeitskreis bewerten?
32 Was wird am Modell besonders geschätzt?
33 Rangreihung der wichtigsten Themen bei der ‘Follow up’ Erhebung nach einem Jahr
34 Wichtigste Themen während der Arbeitskreise - Expertenbefragung
35 wichtigsten Themen während der Arbeitskreise
36 Rangreihung der Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer
37 Vergleich der Liberalitätswerte zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe
38 Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit dem Projekt und der Liberalität der Einstellung zur Sexualität von Menschen mit Behinderungen
39 Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit den einzelnen Arbeitskreisen und der Liberalität der Einstellung zur Sexualität von Menschen mit Behin- derungen
40 Zusammenhang zwischen Einschätzung der Wichtigkeit der Zusammenar- beit aller zum Thema und der Liberalität der Einstellung zur Sexualität von Menschen mit Behinderungen
41 Zusammenhang zwischen der Liberalität der Einstellung zur Sexualität von Menschen mit Behinderungen und dem Arbeitsaufwand im Projekt
42 Zusammenhang zwischen der Liberalität der Einstellung zur Sexualität von Menschen mit Behinderungen und dem Arbeitsaufwand in den Arbeitskrei- sen
43 Gesamtteilnehmer am leicht veränderten Modell
44 Regelmäßigkeit der Teilnahme am Modell
45 Wie haben sie sich bei den Arbeitskreisen gefühlt?
46 Das Gesprächsklima in der Gruppe war?
47 Die Zusammenarbeit in der Gruppe war?
48 Wie haben Sie die Moderatoren erlebt?
49 Welche Themen haben sie am meisten angesprochen?
50 Was haben ihnen persönlich die Arbeitskreistreffen gebracht?
51 Rückmeldungen an die Moderatoren
52 Rangreihung der Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer
Vorwort
Da es kaum Arbeiten und Konzepte im Bereich der Sexualpädagogischen Aufklärung für Menschen mit Behinderungen gibt, gründete der damalige pädagogischen Leiter der Le- benshilfe Salzburg, Dr. Wolfgang Plaute, 1997 einen Arbeitskreis zur Sexualpädagogik.
Aus dem amerikanischen Raum waren einige Studien bekannt (Brantlinger, 1983; Adams, et al. 1982; McCabe, 1983). Diese belegen, dass der Umgang mit Sexualität und die Mög- lichkeit als Mensch mit Behinderungen Sexualität zu leben maßgeblich von der Einstellung des Umfeldes abhängig ist. Die ersten Forschungsprojekte des Arbeitskreises, welche in Zu- sammenarbeit mit dem Institut für Psychologie in Salzburg unter der Leitung von Ao. Univ. Prof. Dr. Joachim Sauer stattfanden, hatten zum Ziel, den ‘Ist-Stand’ bezüglich der Thematik zu erheben. In dieser Grundlagenforschung wurde bereits versucht, einen Fokus auf die Ein- stellung zur Sexualität der verschiedenen Bezugsgruppen zu lenken und daraus den Umgang mit der Thematik abzuleiten. Die vier wichtigsten Personengruppen, nämlich Menschen mit geistiger Behinderung, Mitarbeiter (Assistenten) von Behinderteneinrichtungen, Eltern und Angehörige sowie Experten wurden zum Thema befragt.
Die Befragung der Expertengruppe (Gynäkologen) war damals das Thema meiner Diplomarbeit (Schlick, 1998). Dabei wurden wichtige Ergebnisse erzielt. So wurde die Annahme, dass die persönliche Einstellung signifikanter Personen von großer Bedeutung ist bestätigt (vgl. dazu auch Polleichtner, 1998).
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde deutlich, dass ein sexualpädagogisches Aufklärungsmo- dell nicht nur beim Menschen mit geistiger Behinderung ansetzen darf, sondern das gesamte relevante Umfeld (Bezugspersonen, Betreuer, Eltern und Angehörige und Experten) mit ein- beziehen sollte.
Im Projekt ‘Love Talks’, ein sexualpädagogisches Aufklärungsmodell für den Schulbereich, wurde bei der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen die Einbeziehung aller wichtigen Bezugsgruppen bereits erfolgreich umgesetzt. Fortlaufende, begleitende Evaluierungen bestätigten die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit des Modells (vgl. Gasteiger-Klicpera & Innerhofer, 1991; Brenn et al., 1998; Steck, 1999; Talebizadeh, 2001). Deshalb entstand auch die Idee, dieses erfolgreiche Modell für den Bereich von Menschen mit geistiger Behinderung weiterzuentwickeln und zu adaptieren.
Der Name des entwickelten Modells ist ‘Special Love Talks’. Der Grundgedanke des Mo- dells ‘Love Talks’, nämlich dass alle betroffenen Gruppen miteinander zum Thema Sexua- lität ins Gespräch kommen, wurde aufgenommen. Das heißt für den Bereich der Menschen mit Behinderungen, dass Menschen mit geistiger Behinderung, Eltern und Angehörige sowie Mitarbeiter von Behinderteneinrichtungen zusammenarbeiten. Es versucht, die spezifischen Bedürfnisse aller Betroffenen im Bereich der Sexualität und geistigen Behinderungen zu berücksichtigen und ihnen gerecht zu werden.
Das Modell ‘Special Love Talks’ ist die Grundlage der vorliegenden Studie. Sie hat zum einen das Ziel das Modell zu evaluieren, das heißt erste Daten zu gewinnen, um die Sinnhaf- tigkeit und Wichtigkeit des Modells darzustellen. Andererseits soll sie Entscheidungshilfe dafür sein, ob und in welcher Form dieses Modell institutionalisiert werden kann. Der Fo- kus wird wieder auf die Einstellung zur Sexualität gelenkt. Wir gehen davon aus, dass das Modell ‘Special Love Talks’ dazu beiträgt, die Einstellung zur Sexualität langfristig posi- tiv zu beeinflussen. Anhand der gesamten Daten wird analysiert, ob und welche positiven Langzeitwirkungen feststellbar sind.
Die vorliegende Arbeit ist der direkte Anknüpfungspunkt an meine Diplomarbeit. Einige theoretische Inhalte, welche auch für diese Arbeit entscheidend sind, wurden neu überarbeitet, und fließen mit ein.
Die Begriffe ‘geistig behinderten Frau/Mann/Menschen’ oder ‘Frau/Mann/Menschen mit geistiger Behinderung’ werden synonym verwendet. Auch wird ausschließlich die männliche Form in Ausdruck und Sprache verwendet, um die Lesbarkeit zu erleichtern. Selbstverständ- lich sind alle Anführungen auch für Personen weiblichen Geschlechts zu verstehen.
Teil A) Theoretischer Teil
1 Einleitung
Sexualität bei Menschen mit Behinderungen ist seit ungefähr 20 Jahren ein aktuelles Thema (Fegert & Müller, 2001). Zunächst bezogen sich die Publikationen allgemein auf Menschen mit Behinderungen. Geistig behinderten Menschen wurde zu dieser Zeit das Bedürfnis nach Sexualität häufig noch abgesprochen. In vielen Behinderteneinrichtungen wurde sogar darauf geachtet, Sexualität zu verhindern (vgl. Walter, 1994, Gaedt, 1999).
Mittlerweile rückt die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und geistiger Behin- derung immer stärker ins Blickfeld, auch wenn sich die Themen häufig nur auf Verhütung von Schwangerschaft und Sterilisation beziehen. Es gibt jedoch immer mehr Autoren, die Sexualität als ein Recht und ein Bedürfnis in der normalen Persönlichkeitsentwicklung, auch von Menschen mit geistiger Behinderung, betrachten (vgl. Walter, 1994; Zima, 1998; Heidl- mayer, 1999).
Dass Menschen mit geistiger Behinderung ein Recht auf Sexualität und Sexualerziehung ha- ben, bestreitet heutzutage kaum mehr jemand. Sexualität gilt zwar als Grundbedürfnis des Menschen, stellt aber trotzdem noch ein großes Tabu dar, vor allem, wenn es um die Kom- munikation darüber geht. Obwohl Sexualität einerseits sehr öffentlich geworden ist (zum Beispiel in den Medien) ist es uns andererseits noch nicht gelungen, eine angemessene Spra- che der Sexualität zu entwickeln, die es möglich macht, die Kommunikationslosigkeit zu brechen. Kaum ein Kind hat in seiner Jugend mit seinen Eltern über Sexualität gesprochen (Zartler, 1997; Polleichtner, 1998; Schlick, 1998). Zwischen Kindern und ihren Bezugsper- sonen bleibt ein Stück Sprachlosigkeit. Im Zusammenhang mit dem Themenbereich ‘Sexua- lität’ ergeben sich bei Menschen mit geistiger Behinderung eine Reihe von Problemen. Auf der einen Seite ist man mit ähnlichen Bedürfnissen konfrontiert wie sonst auch, auf der ande- ren Seite sind durch die meist kognitiven und körperlichen Einschränkungen der Menschen mit Behinderungen die Kommunikation, das Verständnis und der Zugang zu sich selbst, zu- sätzlich erschwert.
Viele Personen, die mit Menschen mit geistiger Behinderung in engem Kontakt sind, sind zu wenig informiert, teilweise hilflos und mit dem Thema und den daraus folgenden Situationen überfordert (vgl. Römer, 1995; Friske, 1995; Polleichtner, 1998; Walter, 2002c).
Senn (1993) kritisiert das fehlende Verständnis und die fehlende Akzeptanz des Umfeldes. Menschen mit geistiger Behinderung wurden und werden über einen grundlegenden Aspekt ihres persönlichen Lebens, nämlich der Sexualität, häufig nicht informiert. Nur wenige er- hielten eine Aufklärung über ihre Sexualität und - damit verbunden - die Folgen und Verant- wortlichkeiten. Daran hat sich auch heute, trotz vermehrter Diskussionen und Publikationen nur wenig geändert.
Daraus lässt sich erkennen, dass Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung von den Personen abhängig ist, die in ihrem Umfeld leben, die sie betreuen und nur ‘das Beste’ für sie wollen. Adams, et al. (1982), Brantlinger (1983), McCabe (1983), Polleichtner (1998) und Schlick (1998) bestätigten in ihren Studien die Abhängigkeit der Sexualität geistig be- hinderter Menschen von den persönlichen Einstellungen ihrer Bezugspersonen.
Auch werden Fragen nach Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung immer wichtiger. Dies sichert die Effizienz und Wirkung von pädagogischen Maßnahmen. Indem Evaluation als Begleitforschung selbstverständlich wird, kann eine ständige Qualitätssicherung gewähr- leistet werden.
Mit dieser vorliegenden Langzeitstudie soll ein wissenschaftlicher Beitrag zum besseren Gelingen der Sexualerziehung und Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung sowie der Integration der Sexualität ins tägliche Leben geleistet werden.
1.1 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile (A - C). Den theoretischen Teil, einen ‘Entwicklungsteil’ von ‘Special Love Talks’ und den empirischen Teil mit der Evaluationsstudie.
Teil A beginnt mit dem Vorwort und der Einleitung (Kapitel 1). Kapitel 2 befasst sich mit dem Thema der Evaluation. Bei Evaluationsstudien sind vor allem die Frage der Ziele und damit die Wahl des Designs von großer Bedeutung. Auf Definitionsklärungen, verschiedene Formen und Dimensionen, die Wahl des Designs sowie die Wichtigkeit der Qualitätssicherung wird näher eingegangen.
Kapitel 3 beschreibt den Bereich der geistigen Behinderung näher. Begriffsbestimmungen, Grundlagen und theoretische Konzepte, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, werden erläutert.
Auf den Bereich der Sexualität und geistigen Behinderung wird in Kapitel 4 näher eingegangen. Wiederum geht es um Begriffsbestimmungen, um die sexuelle Entwicklung in Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen und spezifische Bereiche der Sexualität. In den Erläuterungen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Kapitel 5 stellt die wichtigsten Bereiche der Einstellung zur Sexualität geistig behinderter Menschen dar und den Einfluss von Bezugspersonen auf die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung. In Kapitel 6 wird versucht die wichtigsten Bereiche, Inhalte und Voraussetzungen für sexualpädagogisches Handeln zu erläutern.
Teil B - der Entwicklungsteil von ‘Special Love Talks’ - behandelt hauptsächlich die Vorstellung des sexualpädagogischen Konzeptes ‘Love Talks’. Die Ergebnisse der Evaluierungsstudien von ‘Love Talks’ werden detailliert angeführt und eine Metaanalyse der Daten vorgestellt. Ebenso wird genau auf die Ergebnisse der Grundlagenforschung eingegangen, welche auch als Basis für die Entwicklung von ‘Special Love Talks’ gilt.
Der empirische Teil - Teil C - beginnt mit den Fragestellungen der Studie, gefolgt von der Beschreibung der Methodik und der Versuchsplanung, der Darstellung des Evaluationsdesigns und Untersuchungsablaufes sowie der Beschreibung der Stichprobe.
Der Ergebnisteil teilt sich in die unmittelbare Bewertung der einzelnen Arbeitskreise, in eine Vorher-Nachhermessung der Einstellung der teilnehmenden Personen, und die Bewertung sowie die Langzeitwirkung des Modells allgemein. Die verwendete Auswertungsmethodik zur Überprüfung der Fragestellungen wird beschrieben, die Daten der Ergebnisse deskriptiv und analytisch dargestellt. Ebenso wird die Weiterführung von ‘Special Love Talks’ bereits in einer leicht veränderten Form beschrieben. Die Veränderungen und das endgültige Design angeführt, und erste Ergebnisse der Zufriedenheit aller Beteiligten mit dem weiterentwickelten Modell ergänzend deskriptiv dargestellt.
Die abschließende Diskussion fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie und deren kritische Betrachtung zusammen. Den Abschluss bietet der Ausblick zum Thema.
2 Evaluation
In den letzten Jahren wird immer häufiger von Evaluation und Qualitätssicherung gesprochen. Vor etwa 30 Jahren war Evaluation ein Fachbegriff der Sozialwissenschaften, mit dem eine wissenschaftliche Erfolgskontrolle unter Benutzung von empirischen Verfahren angesichts standardisierter Erwartungen oder Maßstäbe bezeichnet wurde.
Ist das vorrangige Ziel Vergleichbarkeit, dann bedeutet Evaluation in der Regel die Über- prüfung, ob die vorgegebenen Normen erfüllt worden sind. Ist dagegen das vorrangige Ziel, wirkungsvollere Wege zu finden, dann bedeutet Evaluation das Bemühen, die Ursachen und Bedingungen der Qualität von Prozessen und Produkten zu verstehen (Becker, Ilsemann & Schratz, 2001).
Wenn man seine Verantwortung als Evaluator ernst nimmt, müssen folgende Fragen zu Beginn des Evaluationsprozesses definiert und geklärt werden:
1. Was genau wird bewertet?
2. Wofür werden die späteren Evaluationsergebnisse verwendet?
3. Wie sollen die nötigen Erkenntnisse möglichst effektiv in finanzieller und zeitlicher Hinsicht gewonnen werden?
Indem diese Fragen ernst genommen werden kann ein akzeptables Evaluationsdesign er- stellt werden. Soll, wie im Fall der vorliegenden Arbeit, ein neues Fortbildungsprogramm bewertet, optimiert und implementiert werden, ist die Auseinandersetzung mit der Frage der Evaluation von größter Bedeutung. Es wird im Folgenden auf für diese Arbeit wichtigen Bereiche der Evaluation aber nur in zusammenfassender Weise eingegangen. Eine genaue Analyse und Darstellung aller wichtigen Aspekte der Evaluation würde den Rahmen spren- gen. Das bedeutet für diese Arbeit, dass auf Definitionskriterien, die verschiedene Formen und Dimensionen, die Wahl des Designs und die Wichtigkeit der Qualitätssicherung näher eingegangen wird.
2.1 De nitionsversuch von Evaluation
Bereits in den dreißiger Jahren entwickelte sich in den USA die moderne Evaluationsfor- schung zu einem integralen Bestandteil der Sozialpolitik. Die Bewertung von Programmen, Interventionen und Maßnahmen im Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie die Entwick- lung von formalen Regeln und Kriterien für die Erfolgs- und Wirkungskontrolle derartiger Maßnahmen war Gegenstand der modernen Evaluationsforschung (Bortz & Döring, 2002).
Im deutschsprachigen Raum konnte die Evaluationsforschung im Bildungsbereich (Fend, 1982), in der Psychotherapieforschung (Grawe et al., 1993; Laireiter, 1998; Petermann, 1977) und der Arbeitspsychologie (Bräunling, 1982) erste Erfolge verzeichnen.
Zum Begriff ‘Evaluation’ findet man eine Reihe von Synonymen, zum Beispiel Erfolgskontrolle, Effizienzmessung, Lernerfolgskontrolle, Bewährungskontrolle, Wirkungsforschung, Wirkungskontrolle, Begleitforschung, Programmforschung oder Kosten-Nutzen-Analysen. Sie werden teilweise in einer spezialisierten Form von Evaluation verwendet.
Wottawa & Thierau (1998) beschreiben den Begriff ‘Evaluation’ als außerordentlich vielfältigen, der eine Menge möglicher Verhaltensweisen umfasst und sich einer umfassenden Definition entzieht.
Franklin & Trasher (1976, S. 20) beschreiben dies recht zutreffend:
To say that there are as many de nitions as there are evaluators is not to far from accurate.
Evaluation ist zwar in letzter Zeit in vielen Bereichen ein modisches Schlagwort geworden. Eine übereinstimmende inhaltliche Konkretisierung wurde dennoch nicht gefunden. Deshalb werden nun einige Definitionsversuche aus der gegenwärtigen Literatur vorgestellt.
Wird Evaluation als Anwendung wissenschaftlicher Methoden zur Beurteilung verstanden, ist die Beschreibung von Lösel & Nowack (1987) zu erwähnen. Für die beiden Autoren um- fasst Evaluation die Verwendung wissenschaftlicher Methoden zum Zwecke der Beurteilung eines Produkts, Programms oder Prozesses hinsichtlich seines Wertes für die Erreichung be- stimmter Ziele. Evaluation betrifft Fragen nach der Art, dem Ausmaß und der Verteilung des jeweiligen Programms, den Zielen und der Angemessenheit, dem planmäßigen Ablauf der Interventionen, dem Ausmaß der beabsichtigten Änderungen bei der Zielpopulation, den Nebenwirkungen sowie der Nützlichkeit entsprechender Kosten-Effektivitätsanalysen bezie- hungsweise Kosten-Nutzenanalysen.
Wottawa & Thierau (1998) sehen in der Evaluation vor allem eine Planungs- und Entscheidungshilfe mit dem primären Ziel, praktische Maßnahmen zu überprüfen, zu verbessern oder über sie zu entscheiden.
Auch Rossi & Freeman (1993) beschreiben Evaluation als Bewertungs-, Implementierungs- und Wirksamkeitsforschung. Evaluationsforschung beinhaltet für die beiden Autoren die systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Bewertung des Konzeptes, des Untersuchungsplanes, der Implementierung und der Wirksamkeit sozialer Interventions- programme.
Eine andere Möglichkeit ist, Evaluation zur Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards zu sehen. Früchtel (1995) definiert Evaluation als systematische Beschreibung und Bewertung zweckgerichteter Maßnahmen in Form eines prozessorientierten Designs mit dem Ziel der Qualitätssicherung eben dieser Maßnahme.
Trotz der vielen bestehenden Definitionen lassen sich drei allgemeine Kennzeichen wissenschaftlicher Evaluation zusammenfassen (Will, Winteler & Krapp, 1987):
1. Ziel- und Zweckorientiertheit: Evaluation ist immer ziel- und zweckgerichtet. Sie hat primär das Ziel, praktische Maßnahmen zu überprüfen, zu verbessern oder über sie zu entscheiden.
2. Systematisch gewonnenes Datenmaterial: Grundlage jeder Evaluation ist eine syste- matisch gewonnene Datenbasis über Voraussetzung, Kontext, Prozesse und Wirkungen der untersuchten praktischen Maßnahme. Evaluation ist eng mit der Effektivität, also der Wirksamkeit verbunden. Die Methoden der Datengewinnung müssen dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Techniken und Forschungsmethoden entsprechen (Wotta- wa & Thierau, 1998).
3. Bewertende Stellungnahme: Evaluation dient als Planungs- und Entscheidungshilfe. Sie beschäftigt sich somit mit der Bewertung von Handlungsalternativen. Evaluation bein- haltet eine bewertende Stellungnahme. Das bedeutet, dass die gewonnen Daten und Be- funde mit dem Hindergrund von Wertmaßstäben unter Anwendung bestimmter Regeln bewertet werden. Bei Früchtel (1995) spielt dabei die Prozesshaftigkeit eine besondere Rolle. Die aktuellen Forschungsergebnisse werden während des untersuchten Prozes- ses an die Praxis weitergegeben. Evaluation ist dabei ein Bestandteil der Entwicklung, Realisierung und Kontrolle planvoller Bildungsarbeit.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Definitionen den Aspekt der Bewertung beinhalten. Diese wird im Sinne der Einschätzung der Zweckmäßigkeit der betrachteten In- tervention verstanden und nicht, ob eine Sache gut oder schlecht ist. Evaluation stellt somit eine Möglichkeit dar, den Wert und die Wirksamkeit eines Konzeptes oder einer Intervention oder ähnliches unter Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden festzustellen.
2.2 Funktionen und Ziele von Evaluation
Welche Funktion und welche Ziele im Vordergrund stehen, hängt vom konkreten Einzelfall ab. Für den Auftraggeber steht meist die Bewertung im Vordergrund, für den Lehrenden oder Trainer die Kontrollfunktion und für den Evaluator selbst der Erkenntnisgewinn. Fest steht, dass Evaluation im Spannungsfeld verschiedenster Interessen steht. Will, Winteler & Krapp (1987) beschreiben unabhängig davon die grundlegenden Funktionen:
1. Bewertungs- und Beurteilungsfunktion: Das Ergebnis und die Wirkung einer Maßnahme soll beurteilt werden. Das Endergebnis wird mit festgelegten Bewertungsmaßstäben verglichen und ausschließlich nach dem erreichten Ausmaß der geforderten Ziel- und oder Nutzkriterien beurteilt. Die Aufgabe des Evaluators ist es, bewertend Stellung zu beziehen.
2. Steuerungs- und Optimierungsfunktion: Die Evaluation umfasst die Beurteilung der Planung, Entwicklung und Optimierung der Interventionen. Vor allem während einer Intervention werden Bewertungen gemacht, um Probleme zu klären und die Gestaltung der Maßnahme zu steuern, zu korrigieren und zu optimieren. Die Beteiligten werden unmittelbar in den Evaluationsprozess mit einbezogen. Dadurch soll die laufende Maßnahme im Sinne einer Erfolgsförderung verbessert werden.
3. Kontroll- und Disziplinierungsfunktion: Die Durchführung einer Bildungsmaßnahme und der Grad der Zielerreichung wird hier überprüft. Der Auftraggeber kann so kontrollieren, ob die Maßnahme - wie geplant - durchgeführt wurde und die Ziele erreicht wurden. Dabei werden die Leistungen der Teilnehmer und die der Trainer gleichermaßen untersucht, was eine Auslese von Lehrenden und Mitarbeitern zur Folge haben kann. Die Unsicherheit vor dieser Form ist besonders dann gegeben, wenn die zu bewertenden Personen zu wenig Mitspracherecht in den Evaluationsprozess und zu wenig Informationen bezüglich der verfolgten Ziele haben.
Diese drei Funktionen treten nicht in Reinform auf, sondern bieten lediglich den Hinweis, welchen Schwerpunkt die Evaluation verfolgt.
Ergänzend muss darauf hingewiesen werden, dass Evaluation auch als Intervention dienen kann. Das heißt die Evaluation verändert die zu evaluierende Maßnahme, sobald die Betrof- fenen davon erfahren. Intervention ist ein absichtsvoll eingesetztes Eingreifen in ein Treat- ment, welches das Ziel hat, dort Veränderungen hervorzurufen. Wenn die Auszubildenden ihre eigene Arbeit und den damit verbundenen Lernerfolg beurteilen, liefern sie den bes- ten Hinweis für die Praxistauglichkeit der Intervention. Auf der Ebene des Treatments dient Evaluation der Optimierung der Maßnahme. Auf individueller Ebene bietet sie durch Einbe- ziehen der Personen die Chance zur Reflexion und zur Steigerung der Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter. Insgesamt verhindert Evaluation das Erstarren von Berufsbildung und deren Or- ganisationsformen (Grob, 1993).
Evaluation macht nur Sinn, wenn es den Beteiligten auch etwas nützt. Balzer, Frey & Nenninger (1999) haben dazu einige Möglichkeiten formuliert. Evaluation kann:
- Entscheidungshilfe über die Einführung, Beibehaltung, Auswertung, Abschaffung oder Kürzung einer Intervention,
- Planungshilfe für eine zukünftige Maßnahme,
- Durchsetzungshilfe für eine geplante Maßnahme sein,
- die Entwicklung und Optimierung eines Programms ermöglichen,
- Hinweise auf Mängel und Bedürfnisse geben,
- einen Vergleich zwischen alternativen Interventionen beziehungsweise Teilmaßnahmen herstellen und
- eine Verantwortungsdelegation bei vorhandener Unsicherheit darstellen.
- Evaluation ist Erfolgskontrolle.
- Evaluation ist hilfreich bei der Analyse einer Maßnahme und sie gibt
- einen zusätzlichen Anreiz zur Reflexion über Bestandteile einer Intervention.
Daraus wird ersichtlich, wie vielseitig der Nutzen von Evaluation sein kann. Evaluation dient keinem Selbstzweck, sondern auf der Grundlage der Ergebnisse werden praktische Konsequenzen eingeleitet. Dies setzt eine genaue Zieldefinition voraus. Wottawa und Thierau (1998) schlagen folgende Zielkategorisierung vor:
- Bewertung ohne detaillierte Zielsetzung: Hier geht es um eine Überprüfung oder Kontrolle gemäß der Frage: ‘Was leistet eigentlich die Bildungsarbeit?’
- Durchsetzungshilfe: Der Auftraggeber erhofft hier, mit den Ergebnissen die vorgefasste Meinung stützen zu können. Der Drang nach gewünschten Ergebnissen ist hier beson- ders groß.
- Entscheidungshilfe: Es liegen mindestens zwei Alternativen, im Idealfall mehrere, vor. Die Evaluation liefert einen Katalog für die wichtig gehaltenen Auswirkungen inklusive der festgelegten Bewertung, der Ausprägungsgrade des Nutzens und der Kompensati- onsmöglichkeiten. Sie zielt auf die Entscheidung zwischen den Alternativen ab.
- Optimierungsgrundlage: Hier liegt der Zielschwerpunkt auf dem Versuch, die fragliche Maßnahme durch systematische Rückmeldung zu verbessern. Der Evaluator soll Hinweise geben, welche Aspekte der Maßnahme verbesserungswürdig sind und in welcher Form man dies erreichen könnte. Eine intensive Kooperation mit den Betroffenen ist Voraussetzung für eine derartige Gestaltungs- und Interventionsaufgabe.
Die vorliegende Studie ist somit als Durchsetzungshilfe aber vor allem als Optimierungsgrundlage zu sehen.
Natürlich handelt es sich bei den angeführten Zielen wiederum um eine theoretische Katego- risierung. Tatsache ist aber, dass keine Evaluation die endgültigen Folgen einer Maßnahme bewerten kann. Deshalb sind Zwischenziele notwendig. Tatsache ist auch, dass Evaluation nie die Ideallösung liefern kann. Sie kann nur dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit für die Auswahl der besonders guten Alternative zu erhöhen und die Wahl der besonders schlechten zu verringern. In diesem Sinne sprechen Wottawa und Thierau (1998, S. 21) auch davon, dass das Ziel einer Evaluierung eine Übelminimierung statt einer Ideallösung sein sollte .
2.3 Modelle und Formen der Evaluation
Innerhalb der zahlreichen Modellansätze scheint die Unterscheidung von Scriven (1980) zwischen formativer und summativer Evaluation die wichtigste zu sein.
Die formative Evaluation stellt vor allem für noch in der Vorbereitungs- oder Implementierungsphase befindliche oder laufende Programme, die verbessert werden sollen, Informationen bereit. Eine formative Evaluation findet während eines Prozesses statt und hat die Aufgabe, Rückkoppelungen zu ermöglichen und so Einfluss auf die weitere Arbeit zu nehmen. Durch die Wirkung auf einen noch im Gang befindlichen Prozess hat diese Form der Evaluation vor allem für die Prozessbeteiligten Bedeutung, da sie wesentlich zum Gelingen oder Misslingen eines Projektes beitragen kann.
Die summative Evaluation findet am Ende eines Projektes statt und dient der abschließen- den Beurteilung und Bewertung. Damit bezieht sich summative Evaluation auf das Endpro- dukt einer Arbeit. Sie beurteilt zusammenfassend die Wirksamkeit einer vorgegebenen Inter- vention, während die formative Evaluation regelmäßig Zwischenergebnisse erstellt. Sie hat das Ziel, die laufenden Interventionen zu modifizieren oder zu verbessern (Bortz & Döring, 2002). Die vorliegende Studie ist somit vorwiegend als summative Evaluierung zu sehen.
Wottawa und Thierau (1998) klassifizieren in diesem Zusammenhang folgende Aspekte:
1. Funktion: Entsprechend der benannten Funktionen lassen sich die produktorientier- te (summative), bei der eine abschließende Kontrolle der Effekte beziehungsweise Wirkungen eines Programms (Output) im Mittelpunkt steht, von der prozessorientier- ten (formativen) Evaluation unterscheiden, Verbesserung und Entwicklung geeigneter Handlungsformen.
2. Aufgabengebiete und Evaluationsfelder: Sie werden unter anderem von Will, Winteler und Krapp (1987) auch als Metaebenen der Evaluation bezeichnet, stellen Ebenen jeder Bildungsmaßnahme dar und sind auch unter dem Begriff ‘CIPP-Modell’ bekannt:
- C-ontext/Zielevaluation: Aufgabe der Evaluation ist eine Bestandsaufnahme im Sinne einer Bedarfsermittlung zur Feststellung der Ausgangsbedingungen bezie- hungsweise eine Bewertung der Rahmenbedingungen und Ziele eines Programms.
- I-nputevaluation: Sie untersucht die Möglichkeiten der Verwendung von Ressourcen für die Erreichung der Ziele, entwickelt und bereitet entsprechende Trainingsmaßnahmen vor.
- P-rocessevaluation: Sie liefert im Sinne einer formativen Evaluation periodische Rückmeldungen während der Ein- und Durchführungsphase eines Programms.
- P-roductevaluation: Sie wird auch als summative oder Transferevaluation bezeichnet und bietet eine Ergebniskontrolle im Lernfeld sowie eine Bewertung der längerfristigen Umsetzung und Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz.
Weitere Aspekte stellen die Rahmenbedingung, die Ziele, die Fragestellung, und Zeitper- spektive, die Bearbeitungsformen, die Aufbereitung und Sonderformen dar. Eine detaillierte Ausführung dieser Aspekte ist bei Wottawa & Thierau, (1998) und Will, Winteler & Krapp (1987) zu finden.
2.4 Gestaltungskomponenten von Evaluationsstudien
Ähnlich wie bei dem Versuch, eine einheitliche Definition für Evaluation zu finden, wird man auch bei der Erstellung eines Klassifizierungsrasters eine große Heterogenität vorfinden. Wottawa und Thierau (1998, S. 56) haben versucht, einige Aspekte zu erarbeiten, die eine erste grobe Beschreibung von Projekten erlauben.
1. Evaluationsziel(e): Warum wird evaluiert? Die Frage nach dem Ziel beginnt mit der Klärung der Auftragsverhältnisse, also in welchem Rahmen die Evaluation durchge- führt wird. Bei Evaluationen sind für gewöhnlich auch die Vorstellungen und Interes- sen des Auftraggebers auch mit zu berücksichtigen. Ziel der vorliegenden Studie ist die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit des Modells ‘Special Love Talks’ zu überprüfen.
2. Evaluationsbereich: In welchem gesellschaftlichen Bereich wird evaluiert? Nach der Feststellung der Ziele sollte das Praxisfeld, in dem die Evaluation stattfindet bestimmt werden, zum Beispiel der Bildungsbereich, was auch in der vorliegenden Studie der Fall ist.
3. Evaluationsobjekt(e): Wer oder was wird evaluiert? Das Evaluationsobjekt ist jeweils als Oberbegriff für die bewertenden Alternativen zu sehen. Personen, Umwelt- und Umgebungsfaktoren, Produkte, Techniken, Programme, Projekte, Systeme und For- schungsergebnisse, sowie in der vorliegenden Studie das Bildungs- und Aufklärungs- modell sind als Evaluationsobjekte denkbar. Wichtig ist die eigentlichen Evaluations- objekte von den Objekten, welche nur als Hilfsmittel fungieren zu unterscheiden.
4. Evaluationsort(e): Wo wird evaluiert? Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Evaluation im Labor und im Feld. Die meisten Evaluationen wie auch diese, finden im Feld statt.
5. Evaluationsmodell: Wie wird evaluiert? Innerhalb der zahlreichen unterschiedlichen Modelle hat vor allem die Unterscheidung zwischen summativer und formativer Eva- luation die größte Bedeutung. Die Evaluation dieser Studie kann vorwiegend als sum- mativ eingestuft werden.
6. Evaluationsnutzung: Wie werden die Ergebnisse aufbereitet und entscheidungsrelevant verwendet? Bei der Auswertung muss, entsprechend der ethischen Grundprinzipien, die Vertraulichkeit gewährleistet sein. In welcher Form und ob überhaupt die Ergebnisse offen gelegt werden liegt im Ermessen des Auftraggebers und des Evaluators. Kommt es zu einer Berichtlegung soll dem eine sorgfältige Zielgruppenanalyse vorausgehen, um die Ergebnisse möglichst zielgruppenorientiert zu gestalten.
Evaluation wird nur dann durchgeführt, wenn die Chance besteht, dass der Nutzen die Aufwendungen übersteigt. Der Evaluator muss sich stets seiner Verantwortung für eventuelle Folgen, die durch unrichtige Ergebnisse, Datenauswertungen oder Interpretationen verursacht werden können, bewusst sein.
2.5 Methoden der Evaluation
Für die Durchführung von Evaluationen gibt es verschiedenste Gründe. Je nachdem, um welche Fragestellungen es sich handelt, ist die Auswahl der Methoden und Instrumente von großer Bedeutung. Die Art des Projektes und die damit verbundenen Zielsetzungen haben in jedem Fall Einfluss auf die Methodenwahl. Das setzt voraus, dass der Evaluator die optimale Technik auswählt und anwendet. Der Evaluationsprozess muss von den Evaluatoren häu- fig neu konzipiert werden, das heißt, dass entweder keine entsprechenden Methoden oder Techniken bekannt sind. In diesen Fällen kann eine Kombination aus bekannten Evaluati- onsmethoden notwendig werden, neue Techniken und Methoden aufgrund der gewünschten Ziele selbst müssen entwickelt oder Adaptierungen von Methoden vorgenommen werden, welche am besten die Zielvorstellungen verfolgen. Wichtig ist, dass jede Evaluation soziale und gruppendynamische Prozesse in Gang setzt. Aufgrund dieses Wissens sollten Evalua- toren die Methode sorgfältig auswählen, damit die Methoden nicht zu Unverständnis oder Ablehnung führen, was ein Misslingen der Evaluation zur Folge haben könnte (Allgäuer, 1997).
Die Grundlage aller Evaluationen stellt die zweckgerichtete Datensammlung und deren Auf- bereitung und Bewertung dar. Die Frage nach den hierfür geeigneten Methoden wirft sofort auch die Frage der Entscheidung zwischen quantitativer und qualitativer Zugangsweise auf. Die starke Polarisierung der beiden methodologischen Paradigmen hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend aufgeweicht. In dem Maße, wie sich Evaluationsforschung entwickelt und zunehmend eine unabhängige Identität erlangt, die sich von traditioneller wissenschaftlicher Forschung unterscheidet, wächst auch die Einsicht, dass die besondere Aufgabe der Evaluationsforschung auch ein spezielles Methodeninstrumentarium erfordert. Aus der Fülle der verschiedenen Ansätze ergibt sich, dass sich weder eine einheitliche or- ganisatorische, inhaltlich-theoretische noch methodologische Struktur herausbilden konnte und kann. Es ist unmöglich von der Methode oder dem Modell der Evaluation zu sprechen. Vielmehr lässt sich im aktuellen wissenschaftlichen Sprachgebrauch eine breite Palette von verschiedenartigen sozialwissenschaftlichen Methoden und Konzepten erkennen.
Quantitative Methoden finden eher bei summativen Evaluationsmodellen, wo das technischfunktionale Erkenntnisinteresse im Vordergrund steht, Verwendung. Der quantitative Ansatz ist angemessen, wenn umfangreiche Programme mit hohen Kosten und Personalaufwand überprüft werden, hohe Objektivität und Vergleichbarkeit gefordert ist, statistische Ergebnisse erwünscht sind und klar definierte Effektkriterien vorliegen.
Qualitative Methoden finden eher bei formativen Evaluationsstudien ihren Einsatz. Sie sind flexibel, adaptiv und für komplexe Situationen geeignet. Die Resultate haben unmittelbar praktische Relevanz, sind adressatenorientiert und stoßen auf hohe Akzeptanz bei den Be- teiligten. Der qualitative Ansatz dient vor allem dazu, die Wirkung von Programmen aus der Sicht der Betroffenen zu verstehen. Er empfiehlt sich besonders, die unmittelbar Be- troffenen in die Entscheidung mit einzubeziehen, wenn die zu berücksichtigenden Effekte und Konsequenzen aus der Durchführung der Maßnahme noch nicht festgelegt sind und die menschliche Bedeutung im Vordergrund steht (Will, Winteler & Krapp, 1987; Grob, 1993).
Versucht man die vorhandenen Methoden vereinfacht zusammen zu fassen, lassen sich die Methoden in vier große Gruppen einteilen, nämlich in die schriftliche Befragung, das Interview, die Beobachtung und die Auswertung vorhandener Daten.
Eine Möglichkeit der Befragung, welche auch in dieser Studie gewählt wurde, ist die Be- fragung mittels Tests oder Fragebögen. Schriftliche Befragungen werden für die Datenge- winnung herangezogen und lassen Vergleichsmöglichkeiten zu. Aus Gründen der Exakt- heit wären sorgfältig konstruierte Testverfahren besonders wünschenswert. Laut Wottawa und Thierau (1998) gibt es aber kaum Evaluationsprojekte, in denen es möglich ist, den dafür erforderlichen Konstruktionsaufwands zusätzlich zu den sonstigen Arbeiten abzude- cken. Man ist daher im Regelfall auf vorhandene Messverfahren angewiesen. Diese Verfah- ren sind aber meist für Forschungszwecke mit starker Anlehnung an theoretisch-psycholo- gische Konstrukte oder für angewandt-diagnostische Fragen entwickelt worden und deshalb auch nicht für Evaluationszwecke geeignet. Dies bringt vor allem das Problem der geringen Änderungssensitivität mit. Ebenso sind die Verfahren oft zu lang und deshalb zu aufwän- dig. Die Konstrukte decken nicht den Operationalisierungsbedarf von Evaluationsprojekten ab und der Zusammenhang zwischen Testwert und Nutzen ist kaum bekannt. In Anbetracht dieser Sachlage gibt es nur wenige Bereiche, in denen wissenschaftlich konstruierte Test- verfahren empfehlenswert sind. In vielen Bereichen der Evaluation haben sich daher selbs- terstellte Fragebögen als probates Mittel erwiesen. Diese Form von Messmethode ist zwar weniger fundiert, sie stellt aber häufig das einzig denkbare Vorgehen da, um ein interessantes Kriterium zu messen. Entscheidend für die Verwertbarkeit des eigens erstellten Fragebogens ist die Fragestellung selbst. Vorab ist zu klären, welche Ziele, welcher Gegenstand und wel- che Beteiligten für die Studie von Bedeutung sind. Auch, ob offene oder geschlossene oder kombiniert gestaltete Fragen die Grundlage bilden sollen. Wichtig ist, die Befragten nicht zu überfordern, um deren subjektive Eindrücke und Empfindungen messen zu können. Diese Subjektivität oder Selbsteinschätzung lässt natürlich auch immer Zweifel in Bezug auf den Praxisbezug zu (Allgäuer, 1997; Wottawa & Thierau, 1998).
Das Interview und die Beobachtung (vgl. dazu Allgäuer, 1997) wurden in der vorliegenden Studie, aufgrund des zeitlichen und technischen Aufwandes, völlig ausgespart.
2.6 E ektivität und Wirksamkeit
Im Zuge der Methodendiskussion ist es wichtig, die Frage nach Effektivität und Wirksamkeit aufzuwerfen. Bei der Beurteilung der Effektivität, an denen die Wirksamkeit des Programms gemessen wird, geht es darum, ob das Ziel erreicht worden ist, oder in welchem Bereich Abweichungen festzustellen sind und ob ein vertretbares Verhältnis zwischen dem erreichten Ziel und der dazu benötigten Anstrengung besteht (Allgäuer, 1997).
Vor allem die Taxonomie von Kirkpatrick (1960, 1976) sei hier genannt. Er beschreibt in seinem Modell vier verschiedene Ebenen: Reaktionen, Lernen, Verhalten und Resultate. An diesen vier verschiedenen Ebenen soll Evaluation ansetzen um die Effekte einer Maßnahme festzustellen.
Unter Reaktionen versteht Kirkpatrick (1976) subjektive Bewertungen. Einstellungen und Gefühle zum untersuchten Gegenstand werden mittels Fragebogen oder Interview erhoben. Der methodische Zugang ist die Erfassung der Zufriedenheit der Teilnehmer während und nach dem Treatment. Burke & Day (1986) sprechen auch von subjektivem Lernerfolg.
Die zweite Ebene stellt das Lernen dar. Dabei geht es um die Aufnahme Verarbeitung und Bewältigung der Lerninhalte welche durch standardisierte Testverfahren oder Fremdbeob- achtung gemessen werden (Martens, 1987; Holling & Liepmann, 1993). Mit Verhalten ist die Umsetzung der Lerninhalte im Arbeitskontext gemeint. Verhaltensänderungen der Teil- nehmer werden durch Verhaltensbeobachtungen (Martens, 1987) sowie Interviews oder Befragungen, nicht nur der Teilnehmer, sondern auch anderer Personen, wie zum Beispiel Vorgesetzter, untersucht (Holling & Liepmann, 1993).
Die vierte Ebene stellt die Resultate dar. Für Martens (1987) und Holling & Liepmann (1993) stellt diese Ebene das wichtigste Effektivitätskriterium dar. Burke & Day (1986) sprechen hier von objektiven Verhaltensänderungen.
Die meisten Evaluationen werden vorwiegend auf der ersten Ebene durchgeführt. Es zeigen sich nur geringe Korrelationen zwischen Reaktionsebene und den anderen drei Ebenen. Hohe Korrelationen zeigen sich hingegen zwischen Lernen und Verhaltensänderung (Allinger & Janak, 1989; Burke & Day, 1986).
Es ist anzunehmen, dass zwar Beziehungen zwischen den Ebenen bestehen, diese aber einerseits von geringer Effektstärke und andererseits von vielen anderen Variablen beeinflusst werden. Evaluationsergebnisse können daher nicht von einer Ebene auf die anderen Ebenen transformiert werden (Holling & Liepmann, 1993).
Um den Erfolg einer Schulung zu bestimmen, sollten zwei Gruppen von Maßnahmen unterschieden werden:
1. Maßnahmen, die die Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Schulungsmaßnamen erfas- sen und
2. Maßnahmen, die den Lernerfolg der Teilnehmer erfassen (Martens, 1987).
Findet Evaluation auf der ersten Ebene statt, ergibt sich die Frage nach der ersten Maßnah- me, nämlich der Zufriedenheit als diagnostisches Kriterium. Diese Zufriedenheit bezieht sich auf das Treatment oder die Intervention. Die Zufriedenheit bezieht sich auf auslösende Er- eignisse und Situationen. Häufig sind diese aber bereits vergangen und in der Erinnerung oft verklärt. Darauf bezieht sich auch die Kritik der Zufriedenheitsmessung (vgl. Brandstätter, 1990; Fussi, 1999).
Die Zufriedenheit bezieht sich also auf die Gegenwart oder die Vergangenheit. Derzeit sind noch keine Kenntnisse vorhanden, welchen Prozessen derartige Beurteilungen unterliegen. Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass das Kriterium nicht die valide Repräsen- tation alltäglicher Erfahrungen darstellt, sondern sich andauernd verändert. Die Stimmung oder Zufriedenheit hat laut Martens (1987) nur in Extremfällen etwas mit der Lernleistung zu tun. Das wesentliche Erfolgkriterium für eine Aus- oder Fortbildung sollte der Lerner- folg sein. Martens stellt Beispiele vor, in denen er sogar einen negativen Zusammenhang zwischen der Stimmung im Seminar und den beiden Erfolgskriterien gegeben hat (Martens, 1987). Beim dort vorgestellten Seminar wurde bei der besten Stimmung das schlechteste Ergebnis erzielt und umgekehrt. Martens weist darauf hin, dass die Ergebnisse nicht den Eindruck erwecken sollen, dass eine negative Stimmung im Seminar zu besseren Ergebnis- sen führe. Er warnt lediglich vor einer schnellen Gleichsetzung von Zufriedenheitswerten und Seminarerfolg.
Kognitive Lernziele lassen sich insofern leichter als affektive Veränderungen messen, weil Wissen relativ problemlos durch schriftliche Testaufgaben überprüft werden kann.
Bei affektiven Veränderungen wird meist ein Einstellungsfragebogen verwendet. Um wirklich zu befriedigenden Testergebnissen zu kommen, sollte eine Testwiederholung durchgeführt werden. In der Regel werden Ergebnisse direkt nach einem Treatment anders ausfallen, als einige Monate danach. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erreichen, sollte auf mehrere Messzeitpunkte, auch einige Zeit nach dem Treatment, nicht verzichtet werden. Martens (1987) spricht hier von einer Vergessenkurve. Im Laufe der Zeit sinken die Ergebnisse. Das Vergessensniveau ist von zwei Faktoren abhängig. Einmal von der Qualität der Schulung und zweitens von der Auswahl der Lerninhalte beziehungsweise von der Auswahl der getesteten Inhalte: Je praxisnäher nämlich Inhalt des Seminars und der Testaufgaben gewählt wird, desto geringer ist der Prozentsatz des Vergessens.
Martens (1984; 1987) stellte fest, dass bei der Messung von Einstellungsänderungen, zum Beispiel mit einem Einstellungsfragebogen in den Wochen und Monaten nach der Beeinflus- sung, mit anderen Verlaufskurven zu rechnen ist, als bei einem Wissenstest. Seine Unter- suchungen lassen einen Verlauf vermuten, sodass der Höhepunkt der Einstellungsänderung zwei bis vier Wochen nach der Beeinflussung liegt. Es scheint so zu sein, dass der Wider- stand während einer Beeinflussung besonders groß ist. Vor allem wenn es um Veränderungen tiefverwurzelter Einstellungen geht. Der Widerstand scheint später abzunehmen, die affek- tive Beeinflussung wirkt nach und die Einstellungsänderung wird verstärkt. Voraussetzung ist aber, dass die Adressaten auch nach Beendigung der Schulung offen ihre Werthaltungen und ihr Verhalten zeigen können. Wenn beispielsweise Gruppenzwänge ein solches neues Verhalten nicht zulassen, sollte man mit einer Abnahme der Wirksamkeit der Beeinflussung rechnen. Martens (1984; 1987) stellte in seinen Untersuchungen ebenso fest, dass unmittel- bar nach einem Training zwar eine positivere Einstellung nachzuweisen war (vgl. Linden, 1994), die Anwendung des Gelernten in der Praxis in den ersten drei Monaten nach der Schulung aber zu einer massiven Einstellungsverschlechterung führte. Erst nach ungefähr acht Monaten ließen sich realistische konstante Einstellungsveränderungen nachweisen.
Um Verhaltensänderungen wirklich auf eine Maßnahme zurückzuführen, sollten zusätzlich noch Kontrollgruppen installiert werden. Die Wirksamkeit kann nur im Hinblick auf einen Vergleichsmaßstab, zum Beispiel einer Kontrollgruppe, beurteilt werden (Baumann & Rei necker-Hecht, 1998). Der Vergleich der Kontrollgruppe, ohne Schulung, und der Testgruppe, mit Schulung, ergibt dann, ob tatsächlich die Trainingsmaßnahme Ursache für die Verände- rung war.
In der vorliegenden Studie wurde besonders darauf geachtet, die eben genannten Faktoren wie die Vorsicht der Gleichsetzung von Zufriedenheit und Lernerfolg, die Vergessenskurve und die Vergleichbarkeit mittels Kontrollgruppe mit zu berücksichtigen.
2.7 Notwendigkeit der Evaluation
Analysiert man die in diesem Kapitel angeführten vielfältigen Anschauungen von Evalua- tion, kommt man zu dem Schluss, dass Evaluation in jüngster Zeit nicht nur an Bedeutung gewonnen hat, sondern dass Evaluation auch von besonderem Nutzen und notwendig für die Forschung ist.
Betrachtet man nun systematische Evaluation von Interventionen können Entscheidungen für oder wider bestimmte Maßnahmen rationaler und transparenter gestaltet werden.
Nicht nur die abschließende summarische Bewertung (summative Evaluation), sondern auch die kontinuierliche Bewertung (formative Evaluation) ist dabei von großer Bedeutung. Durch formative Evaluationsmaßnahmen können Maßnahmen entscheidend verbessert werden. Die Planung, Steuerung und Durchführung einer Maßnahme unterliegt dabei einer konstruktiven Kritik. So können notwendig werdende Korrekturen rechtzeitig erfolgen.
Ein Grund, warum Evaluation notwendig ist, ist die Verstärkung der Qualitätssicherung. Die Festschreibung und Erreichung gewisser Standards kann nur durch begleitende Evaluierungsstudien gewährleistet werden. Dies lässt Vergleiche zu anderen Möglichkeiten zu, und die Entscheidung für die beste Wahl wird möglich.
Geforderte Mindeststandards müssen belegbar werden, um ein Mindestmaß an Qualität ge- währleisten zu können. Die stärkere Verlagerung der Entscheidungskompetenz, von ‘oben nach unten’ sollte Qualitätssicherung und damit Evaluation zu einem fixen Bestandteil von Interventions- und Maßnahmenforschung machen. Wenn Maßnahmen und Interventionen re- flektiert und hinterfragt werden, und somit auch Qualität sichern, ist man dazu ‘gezwungen’ zu evaluieren.
Der Wunsch nach Veränderung ist ebenso ein wichtiger Punkt, der Evaluation notwendig macht. Bedürfnisse verändern sich. Im gesamten Bildungsbereich ist es immer wieder not- wendig, den Ist-Zustand zu evaluieren, dadurch möglichst alle Probleme und Diskrepanzen aufzuzeigen und Veränderungsmöglichkeiten auszuloten. Dadurch können neue Entwicklungen eingeleitet werden.
Evaluation ermöglicht ebenso Lernen. Steht Evaluation am Ende und am Beginn jeder Ver- änderung beziehungsweise jedes Projektes, kann nach Erreichung eines Zieles Rückschau gehalten sowie Stärken und Schwächen der geleisteten Arbeit hinterfragt werden. Daraus gewonnene Erkenntnisse können wieder die Grundlage für weitere Entwicklungsschritte bil- den. Der Zyklus der Weiterentwicklung und des Lernens wird dadurch vorangetrieben.
Die optimale Nutzung von Ressourcen ist ein ausschlaggebender Punkt. Evaluation sollte helfen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen so effizient zu nutzen, dass sinnvolles päd- agogisches und wirtschaftliches Handeln trotz knapper Ressourcen noch möglich ist, oder Geldgeber von der Sinnhaftigkeit ihres Geldeinsatzes für ein Projekt zu überzeugen.
Diese angeführten Punkte gehen natürlich von einer optimalen Evaluationsforschung mit optimal nutzbaren Ergebnissen aus. Tatsache ist, dass man bei allen Evaluationsprojekten immer wieder Kritikpunkte finden wird, da die ideale Konzeption eines solchen Vorhabens selbst bei unbegrenzten Ressourcen niemals realisierbar ist. Evaluationsvorhaben rechtfertigen sich nicht aufgrund des Findens von absoluten Wahrheiten, sondern aufgrund ihres Beitrages zu einem Entscheidungsprozeß bezüglich der Auswahl von Verhaltensalternativen. Selbst relativ gering verbesserte Prognosequoten über die Güte der einzelnen Alternativen sind ein Fortschritt. Ziel sollte daher sein, wie Wottawa und Thierau formulieren (1998), das Übel zu minimieren anstatt eine Ideallösung zu finden.
3 Geistige Behinderung
3.1 Allgemeine Begri sbestimmung
Nachdem sehr lange Menschen mit geistiger Behinderung als doof, dumm, unreif, defekt, mangelhaft, schwachsinnig, geistlos oder auch als Idioten, Imbezille und Narren bezeich- net wurden, hat sich der Ausdruck ‘geistig behindert’ oder ‘mental retardiert’ durchgesetzt (Mühl, 1991).
Der Begriff ‘geistige Behinderung’ selbst wurde 1958 von der Elternvereinigung ‘Lebenshilfe für das behinderte Kind’ geprägt (Enge, 1983).
Plaute (2002) formulierte folgende Möglichkeit der Definition von geistiger Behinderung:
Geistige Behinderung ist allgemein durch verspätete intellektuelle Entwick- lung gekennzeichnet und manifestiert sich in ungeeigneten bzw. unreifen Re- aktionen auf die Umwelt und durch unterdurchschnittliche Leistungen in aka- demischen, psychologischen, physischen und sozialen Bereichen. Derartige Beschränkungen machen es für die betro ene Person sehr schwierig, auf die täglichen Herausforderungen richtig zu reagieren, bei denen von anderen Men- schen des selben Alters, sozialen und kulturellen Hintergrundes normalerweise adäquate Reaktionen erwartet werden (Plaute, 2002, S. 1).
Wird von einer ganz allgemeinen Einstellung der Umwelt ausgegangen, bedeutet geistige Behinderung, lebenslang unfähig zu sein, ein mündiger und unabhängiger Erwachsener zu werden (Walter, 1987).
Hahn (1981) spricht bereits dann von Behinderung, wenn ein ‘Mehr an Abhängigkeit’ von stützender Fremdhilfe von einer betroffenen Person im alltäglichen Lebensvollzug gebraucht wird.
Ebenso werden Aspekte wie Unselbstständigkeit, Abhängigkeit, geringe Leistungsfähigkeit, Unreife, Ehelosigkeit, keine Sexualität und gesellschaftliche Separierung mit geistiger Behinderung in Zusammenhang gebracht (Hahn, 1996).
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass aufgrund der großen Heterogenität dieser Personengruppe deutlich wird, dass sich Menschen mit Behinderungen in ihrer Gesamtsituation eine große Variabilität aufweisen. Je deutlicher einige wenige Eigenschaften der geistigen Behinderung als typische Charakteristika von nicht behinderten Menschen herausgearbeitet werden, um so mehr besteht die Gefahr der Stigmatisierung, das heißt der Blick für die positiven Merkmale bleibt verstellt (Rüschoff, 1984).
Eine eindeutige Festlegung der Definition ist daher nur schwer möglich. Der Bogen an Definitionen spannt sich von den alten und defizitorientierten Bezeichnungen, wie zum Beispiel Oligophrenie, bis hin zur völligen Auflösung, nämlich, dass es geistig behinderte Menschen nicht gäbe (vgl. Kobi, 1999).
3.2 De nition nach der AAMR
Typische ältere Definitionen (vgl. Tredgold, 1937; Doll, 1941) stimmen in ihren formulierten Charakteristika überein, dass geistig behinderte Menschen intellektuell mangelhaft seien, eine entwicklungsbedingte Unreife aufwiesen, Defizite im Anpassungsverhalten hätten und geistige Behinderung unheilbar wäre. Diese Definitionen boten aber für die Weiterentwicklung darauffolgender Definitionen durch das AAMR die Grundlage. Die Definitionsversuche der American Association on Mental Retardation haben sich international durchgesetzt und die alten defizitorientierten Sichtweisen neu interpretiert.
1992 wurde von der American Association on Mental Retardation unter der Leitung von Ruth Luckasson eine Definition veröffentlicht, die sich am Grad der intellektuellen und sozialen Handlungsfähigkeit in bezug auf relevante Bereiche des täglichen Lebens von Menschen mit Behinderungen orientierte. Die Bereiche des alltäglichen Lebens umfassen Kommunikation, Selbstversorgung, Wohnen, Sozialverhalten, Benutzung der Infrastruktur, Selbstbestimmung, Gesundheit und Sicherheit, lebensbedeutsame Schulbildung, Freizeit und Arbeit. Die Definition lautet wie folgt (AAMR, 1992, S. 1):
Mental retardation refers to substantial limitations in present functioning. It is characterized by signi cantly subaverage intellectual functioning, existing concurrently with related limitations in two or more of the following applicable adaptive skill areas: communication, self care, home living, social skills, community use, self-direction, health and safety, functional academies, leisure, and work. Mental retardation manifests before age 18.
Diese Definition wählt einen funktionalen Zugang. Dabei geht es um die Interaktion der persönlichen Fähigkeiten, der individuellen Umwelt mit ihren spezifischen Faktoren und dem sich daraus ergebenden persönlichen Level an benötigter Unterstützung.
Vier Annahmen wurden formuliert, die zum Verständnis der Definition herangezogen werden müssen (AAMR, 1992):
1. Valid assessment considers cultural and linguistic diversity, as well as differences in communication and behavioral factors.
2. The existence of limitations in adaptive skills occurs within the context of community environments typical of the individual’s age peers and is indexed to the person’s individualized needs for support.
3. Specific adaptive limitations often coexist with strengths in other adaptive skills or other personal capabilities.
4. With appropriate supports over a sustained period, the life functioning of the person with mental retardation generally will improve.
Wesentlich ist die Neukonzipierung des Konzeptes ‘Adaptive Behavior’ durch die Festlegung der bereits erwähnten zehn spezifischen Bereiche. Ebenso geht die Definition von einem dreistufigen Prozess von Diagnose, Klassifizierung und Unterstützungsmaßnahmen aus. Das Klassifizierungsmodell orientiert sich am Grad des Levels an Unterstützungsmassnahmen. Um die benötigten Unterstützungsmassnahmen definieren zu können, wurde ein vierdimensionales Profil entwickelt.
Die erste Dimension beinhaltet die intellektuellen Fähigkeiten und das adaptive Verhalten. Die zweite Dimension beschäftigt sich mit psychologischen und emotionalen Überlegungen, die dritte mit physischen, gesundheitlichen und ätiologischen Überlegungen und die vierte beinhaltet umweltbezogene Überlegungen. Die erste Dimension ist in Bezug auf die grund- legende Diagnose von Bedeutung. Die drei weiteren Dimensionen werden herangezogen, um die persönlichen Bedürfnisse und die Form sowie das Ausmaß der Hilfeleistungen zu definieren, wobei es keine statisch festgelegte Form von Unterstützung gibt, sondern eine Variation innerhalb einer Personen von Fertigkeit zu Fertigkeit möglich ist.
Um den Grad der Behinderung, die persönlichen Bedürfnisse und die Form und das Ausmaß der Hilfeleistungen zu definieren, gibt es folgende Formen von Unterstützung (Westling & Fox, 1996, S. 6):
- Intermittent (zeitweise): Support on an ‘as needed basis’. Characterized by episodic nature, person not always needing the support(s), or short-term supports needed during life-span transitions (e.g., job loss or an acute medical crisis). Intermittent supports may be high or low intensity when provided.
- Limited (begrenzt): An intensity of supports characterized by consistency over time, time-limited but not of an intermittent nature, may require fewer staff members and less cost than more intense levels of support (e.g., time-limited employment training or transitional supports during the school to adult provided period).
- Extensive (ausgedehnt): Supports characterized by regular involvement (e.g., daily) in at least some environments (such as work or home) and not time-limited (e.g., longterm support and longterm home living support).
- Pervasive (allumfassend): Supports characterized by their constancy, high intensity; provided across environments; potential life-sustaining nature. Pervasive supports ty- pically involve more staff members and intrusiveness than do extensive or timelimited supports.
Weitere 10 Jahre später wurde im Frühjahr 2002 die neueste Definition der AAMR vorgelegt. Auch diese Definition wurde unter der Leitung von Ruth Luckasson entwickelt und lautet wie folgt (AAMR, 2002, S.1):
Mental retardation is a disability characterized by signi cant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before age 18.
In dieser Definition wurden im Vergleich zur 1992 formulierten Definition nicht vier, son- dern fünf Grundannahmen integriert, die zum Verständnis der Definition herangezogen wer- den müssen. Die unter Punkt vier angeführte Annahme ist neu, welche die Wichtigkeit der genauen Beschreibung der Defizite heranzieht, um optimale Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die vier anderen Grundannahmen wurden nur geringfügig verändert (AAMR 2002, S. 1):
1. Limitations in present functioning must be considered within the context of community environments typical of the individuals age, peers and culture.
2. Valid assessment considers cultural and linguistic diversity as well as differences in communication, sensory, motor, and behavioral factors.
3. Within an individual, limitations often coexist with strength.
4. An important purpose of describing limitations is to develop a profile of supports.
5. With appropriate personalized supports over a sustained period, the life functioning of the person with mental retardation generally will improve.
Auch in der 2002 formulierten Definition wurden Dimensionen angenommen, diesmal fünf, im Unterschied zu den vier formulierten der Vorgängerdefinition. Einerseits um wiederum die benötigten Unterstützungsmassnahmen definieren zu können und andererseits um mit der Beschreibung der Weltgesundheitsbehörde, der WHO kompatibel zu sein. Die nachfolgende Tabelle 1 stellt eine Gegenüberstellung der beiden Systeme dar (AAMR, Luckasson, 2002, S. 9):
Durch die Einführung der Dimension III ist diese Definition gut geeignet, die Zielperspekti- ven der vorliegenden Arbeit besser zu charakterisieren. Die Definition geht an dieser Stelle explizit auf die sozialen Dimensionen menschlichen Seins ein und liefert somit optimal den Übergang von der Definition zum praxisrelevanten Teil der Sexualpädagogik. Dimension
Tabelle 1
Gegenüberstellung der Dimensionsmodelle von 1992 und 2002
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkungen: die römischen Zi ern stellen die Dimensionen dar, III wurde 2002 neu de - niert III beschreibt die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Beziehungen und soziale Rollen. Diese neue Dimension wurde in die Definition aufgenommen, um die Kompatibilität der Definition der WHO zu erhöhen und um die Bedeutung der sozialen Situation von Menschen mit geistiger Behinderung zu thematisieren (vgl. Empowerment: Theunissen & Plaute, 2002). Daher sind folgende Zusammenhänge von wesentlicher Bedeutung:
1. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (participation) bezieht sich immer auf die Beteiligung der betroffenen Person an ‘echten’ Aufgaben und Tätigkeiten, die in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft stattfinden. Sie bezeichnet und beschreibt den Grad der Beteiligung und die Reaktionen der Umwelt auf die Leistungen der betroffe- nen Personen.
2. Mängel im Bereich der ‘Teilnahme’ beziehungsweise ‘Interaktion’ können daraus re- sultieren, dass Ressourcen, Wohnmöglichkeiten oder Dienstleistungen überhaupt feh- len oder für Menschen mit Behinderungen nicht erreicht werden können.
3. Mängel im Bereich der ‘Teilnahme’ beziehungsweise ‘Interaktion’ führen häufig dazu, dass die betroffenen Menschen keine sozial wertvollen Rollen übernehmen können.
Insgesamt wird mit der neuen Definition die Multidimensionalität der Phänomens ‘Geistige Behinderung’ noch einmal vertieft und hervorgehoben. Die fünf verschiedenen Dimensionen dienen dabei der Konzeptualisierung des Konstruktes ‘Geistige Behinderung’, verdeutlichen die verschiedenen Dimensionen menschlichen Handelns und betonen das Bedürfnis der betroffenen Menschen nach individuellen Support-Maßnahmen.
Besonders hervorzuheben ist die ‘Mediatorenrolle’. Durch entsprechende Begleit- und As- sistenzmaßnahmen kann das Gelingen individueller Lebensvollzüge gewährleistet werden. Geeignete Assistenzmaßnahmen stehen zwischen den einzelnen Dimensionen und dem in- dividuellen ‘Funktionieren’. Dies bedeutet gleichzeitig, dass jenen Personen, die die Begleitung und Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung übernommen haben, eine zentrale Rolle zukommt. Das neue Definitionssystem will grundsätzlich drei Funktionen ab- decken: Diagnose, Klassifikation und Definition von geeigneten Assistenzmaßnahmen. Als eine wesentliche Zielsetzung dieser Definition gilt die Erfassung von individuellen Unter- stützungsnotwendigkeiten und die Formulierung geeigneter Hilfepläne (supports):
Supports are ressources and strategies that aim to promote the development, education, interests, and personal well-being of a person and that enhance individual functioning. Services are one type of support provided by profes- sionals and agencies. Individual functioning results from the interaction of supports with the dimensions of Intellectual Abilities; Adaptive Behavior; Par- tizipation, Interaction, and Social Roles; Health; and Context. The assessment of support needs can have di erent relevance, depending on whether it is done for purposes of classi cation or planning supports (Luckasson, 2002, S. 145).
Auch wenn dieses System des ‘Support’ keinesfalls neu ist, so ist bei dieser Definition doch zu erwähnen, dass explizit davon ausgegangen wird, dass geeignete ‘Support-Maßnahmen’ in der Lage sind, die funktionalen Möglichkeiten der betroffenen Personen signifikant zu verbessern. Folgende Aspekte sind wichtig, um das vorliegende ‘Support-Konzept’ für Menschen mit geistiger Behinderung entsprechend zu verstehen:
- Das Modell baut auf die Erfassung der Diskrepanz zwischen den individuellen Fähigkeiten und den Anforderungen einer konkreten Umwelt auf.
- Individuelle Risiken und schützende Faktoren der physischen und psychischen Gesundheit sowie Umweltfaktoren können die ‘Support-Maßnahmen’ beeinflussen, die die persönlichen Fähigkeiten verbessern sollen.
- Die Diskrepanz zwischen persönlichen Fähigkeiten und Anforderungen der Umwelt wird nach neun verschiedenen Gebieten evaluiert: menschliche Entwicklung, Unter- richt und Erziehung, Wohnen, Leben in der Öffentlichkeit/Gemeinschaft, Arbeit, Ge- sundheit und Sicherheit, Verhalten, Soziales beziehungsweise Schutz und Vertretung.
- Die Intensität der ‘Support-Maßnahmen’ wird für jeden dieser Bereiche festgelegt.
- ‘Support-Maßnahmen’ haben verschiedene Funktionen zur Reduktion der Diskrepanz zwischen der Person und den Anforderungen der Umwelt: Unterricht, Freundschaft, Finanzplanung, Arbeitsassistenz, Wohnassistenz, Verhaltensunterstützung, Zugang und Nutzung öffentlicher und gesellschaftlicher Ressourcen beziehungsweise Unterstützung im Gesundheitsbereich.
- Die Quelle dieser Funktionen kann entweder in der natürlichen Umgebung der Person liegen oder aus entsprechenden Dienstleistungen entstehen. So sollten Dienstleistungen als eine mögliche Form von ‘Support-Maßnahmen’ durch Agenturen beziehungsweise Professionals betrachtet werden.
- Das Ziel von ‘Support-Maßnahmen’ sind Verbesserungen in den Bereichen Unabhängigkeit, Beziehungen, Beihilfen, Schule, Teilnahme am öffentlichen Leben oder persönliches Wohlbefinden.
Die Intensität der notwendigen Support-Maßnahmen definiert gewissermaßen den Grad der Behinderung und hat sich seit der 1992 formulierten Definition nicht geändert. Die vier ver- schiedenen Intensitäten stellen wiederum ‘intermittent, limited, extensive und pervasive’ dar.
3.3 Alternative Perspektiven
Die folgenden beiden in Unterabschnitt 3.3.1 und 3.3.2 vorgestellten Sichtweisen von geistiger Behinderung werden ergänzend dargestellt, da sie meist in deutschsprachigen Ländern verwendet werden und in vielen Publikationen gängiger sind.
3.3.1 Einteilung von geistiger Behinderung im deutschsprachigen Raum
Die im deutschsprachigen Raum wohl gängigste Definition geht auf Kobi (1993) zurück, der geistige Behinderung folgendermaßen einteilt:
1. Grenzfälle zu Lernbehinderungen und Teilleistungsstörungen: Die betroffenen Men- schen können bürgerliche Rechte und Pflichten wahrnehmen. Sie zeigen lediglich Un- sicherheiten in komplexen Situationen. Die betroffenen Personen werden in der Öffent- lichkeit kaum als behindert wahrgenommen. In den USA wird dieser Grad an Behin- derung als ‘mild mental retardation’ bezeichnet. Der IQ-Näherungswert liegt zwischen 65 und 75.
2. leichtgradig geistig Behinderte: Die betroffenen Personen können Probleme im sprach- lichen Bereich und beim verinnerlichten Handeln aufweisen. Es gibt häufig Diskrepan- zen zwischen normal wirkendem Habitus mit wenig auffälligem Gesamtverhalten und situativen Fehlleistungen. In den USA wird dieser Grad an Behinderung als ‘moderate mental retardation’ bezeichnet. Der IQ-Näherungswert liegt zwischen 40 und 60.
3. mittelgradig geistig Behinderte: Die betroffenen Personen können zusätzlich durch psy- chomotorische, perzeptive und sprachliche Störungen auffallen. Sie werden in der Öf- fentlichkeit als ‘behindert’ erkannt und sind häufig nur beschränkt handlungsfähig. In den USA wird dieser Grad an Behinderung als ‘severe mental retardation’ bezeichnet. Der IQ-Näherungswert liegt zwischen 25 und 45.
4. hochgradig geistig Behinderte: Bei Personen, welche dieser Gruppe zuzuteilen sind, sind Entwicklungsstörungen und Mehrfachbehinderungen, extreme Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit die Regel. Sie können sich ohne soziale Stütze und Begleitung in der Öffentlichkeit nicht bewegen. In den USA wird dieser Grad an Behinderung als ‘profound mental retardation’ bezeichnet. Der IQ-Näherungswert liegt unter 20/25.
Die Beschreibung der Menschen mit geistiger Behinderung kann somit mit der in den USA zumindest nach den früheren AAMR Definitionen (vgl. dazu Grossmann 1977, 1983) als ‘moderately’, ‘severly’, oder ‘profoundly retarded’ verglichen werden. Doch ist bei IQNäherungswerten darauf zu achten, dass die einzelnen Werte durch die Verwendung unterschiedlicher Testverfahren nicht gleichen Werten entsprechen können.
3.3.2 Der Mehrebenenansatz zur Erläuterung der geistigen Behinderung
Im internationalen Verständnis ist nach einer Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation die Unterscheidung von Schädigung, Behinderung und Benachteiligung üblich (Cloerkes, 1997). Der Mehrebenenansatz ist somit auch der einzige Ansatz, der den Aspekt der Benachteiligung geistig behinderter Menschen hervorhebt.
1. Unter Schädigung (impairment) wird jede Abweichung von der Norm verstanden, die sich in einer fehlerhaften Funktion, Struktur, Organisation oder Entwicklung des Gan- zen oder einer seiner Anlagen, Systeme, Organe oder Glieder auswirkt.
2. Behinderung (disability) ist jede Beeinträchtigung, die das geschädigte Individuum bei einem Vergleich mit einem nicht geschädigten Individuum des gleichen Alters, Ge- schlechts und des gleichen kulturellen Hintergrundes, erfährt. Es wird also der objektive Funktionsverlust aufgrund einer Schädigung beschrieben.
3. Benachteiligung (handicap) ist die ungünstige Situation, die ein bestimmter Mensch infolge der Schädigung oder Behinderung in für ihn adäquaten psychosozialen, körper- lichen, beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten erfährt. Ein ‘handicap’ (Benach- teiligung) ergibt sich als mögliche soziale Folge der Behinderung. Es wird im Zusam- menhang mit der Situation definiert und ist kulturell bedingt. Der Begriff ‘handicap’ umschreibt somit den sozialen Aspekt.
Für Kobi (1993) ist es wichtig, nicht die Behinderung als solche, sondern das Beziehungsfeld zwischen Merkmalen, subjektivem Erleben, Normen und den Aussichten der Normalisierungsbemühungen zu sehen. Diese Verknüpfungen werden in Abbildung 1 dargestellt (Kobi, 1993, Bedeutungsschema, S.114).
Aufgrund des dargestellten Denkmodells kann davon ausgegangen werden, dass Behinderung aus der individuellen Schädigung resultiert, diese wiederum zu Benachteiligung führt und in der Folge zu sozialer Isolation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
Bedeutungsschema des Mehrebenenansatzes nach Kobi, 1993.
3.4 Gesamtbetrachtung von Geistiger Behinderung
Betrachtet man die verschiedenen Definitionsmöglichkeiten von geistiger Behinderung stellt die AAMR Definition eine Art Leitdefinition für die vorliegende Arbeit dar. Die AAMR Definition betont die Unterstützungsnotwendigkeit und nicht den Behinderungsgrad, kategorisiert nach dem Ausmaß an notwendiger Unterstützung und fokussiert die Bedeutung des Anpassungsverhaltens. Die Diagnose dient dem Zweck der Interventionsplanung. Die angeführte Definition vom AAMR hat sich von einem Defizit - zu einem Supportmodell weiterentwickelt. Die Wichtigkeit von adäquaten Unterstützungs- und Interventionsmaßnahmen und damit verbunden die Betreuungspersonen von Menschen mit geistiger Behinderung, sind in Bezug auf den Bereich der Sexualität besonders hervorzuheben.
Ebenso werden die vorgestellten Ansätze und Definitionen, wie der Mehrebenenansatz, der als einziger die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen diskutiert und die Einteilung nach Kobi (1993) für den deutschsprachigen Raum, als sehr wichtig erachtet. Sie sind für die Gesamtbeschreibung von ‘geistiger Behinderung’ unverzichtbar.
Ein gewisser stigmatisierender Charakter der Begrifflichkeit ‘Geistige Behinderung’ ist zwar nicht abzustreiten, aber die alleinige Abschaffung der Begrifflichkeit ist kein Garant für eine Nicht Aussonderung oder Integration von Menschen mit Behinderungen. Speck (1997) spricht davon, dass euphemistische Austauschversuche von Bezeichnungen nur zeitlich begrenzte Chancen haben. Denn nicht sie sind es, die diskreditieren, sondern deren Benutzer, deren Einstellung und deren latente Bewertungen.
4 Sexualität und Geistige Behinderung
Sexualität ist nicht als feste Größe definierbar, sondern muss stets als ein Ergebnis bestimm- ter Gegebenheiten und Entwicklungen betrachtet werden. Dazu zählen bestimmte Lernvor- aussetzungen, Erziehungseinstellungen und -einflüsse, aber auch bestimmte Lebenssituatio- nen. Diese Einflussgrößen unterliegen einer Wechselwirkung und sind als Bindungsgeflecht zu verstehen. Es wäre auch sicher falsch, würde man von ‘der’ Sexualität sprechen. Denn die Sexualität jedes Einzelnen, gleich ob behindert oder nicht behindert, ist stets von der Viel- zahl der genannten Faktoren abhängig und nicht nur Ausdruck einer Schädigung. Menschen mit einer geistigen Behinderung haben oft erhebliche Schwierigkeiten, Informationen auf- zunehmen, zu verarbeiten und zu speichern. Deshalb kommt es auch im sexuellen Bereich zu Defiziten in Ausdrucks- und Verhaltensdispositionen. Die abwehrenden und diskriminie- renden Reaktionen der Umwelt wirken zusätzlich erschwerend und gehen oft weit über die direkten, behinderungsbedingten Erschwerungen hinaus.
Zu einem großen Teil könnte man die sexuellen Probleme von geistig behinderten Menschen als soziale Probleme bezeichnen, denn die Problematik liegt meist nicht in ihrer Sexualität, sondern in den Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Die Sexualität von den Betrof- fenen wurde selbst von Experten lange Zeit einfach ignoriert, und deshalb scheint es nicht verwunderlich, wenn die breite Masse mit Vorurteilen und Ablehnung reagiert. Hier gilt es, die Unvereinbarkeit im Alltagsverständnis von Sexualität und geistiger Behinderung zu überwinden. Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung sollte keine besondere und abgesonderte Sexualität sein. Denn Sexualität ist bei Behinderten nichts anderes als bei nichtbehinderten Menschen auch: eine Energie, die Beziehungen aufnehmen, Zärtlichkeit und Liebe erfahren und geben lässt. Sexualität existiert nie als Abstraktum, sondern immer in der individuellen Ausformung durch einzelne Menschen und deren sexuelle Sozialisation. Und so, wie jeder Mensch subjektive Individualität lebt, mit oder ohne irgendwie gearteter Behinderung, so erhält die Sexualität eines Menschen durch seine Behinderung `lediglich' eine weitere Facette an individueller Eigenart 1981, S. 469).
(Schröder, Nach Goldstein & McBride (1976) kann der Geschlechtstrieb auf die Dauer nicht unbefrie- digt gelassen werden, ohne dass es zu Störungen in der Leistungs-, Kontakt- und Liebesfä- higkeit kommt. Dennoch negieren viele Eltern und Betreuer die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung. Möglicherweise auch deshalb, weil sie eine Schwangerschaft fürch- ten. Sexualität wird somit ausschließlich auf die Fortpflanzung reduziert, was nach Kluge & Sparty (1977) eine grobe und daher unzulässige Verkürzung bedeutet. Für Feuser (1988, S. 203) folgt daraus:
Ist ein Bereich nicht realisierbar, zum Beispiel die Fortp anzung, sei es aus biologischen oder psychosozialen Gründen, so kann und darf das nicht als Alibi für die Verhinderung oder Unterdrückung auch der anderen Bereiche dienen. Allein der Aspekt subjektiven Lustgewinns durch sexuelle Betätigung, auch wenn er die Dimension partnerschaftlicher Zuwendung nicht erreicht, ist Grund genug, die Entwicklung der Sexualität umfassend zu fördern und sie einem Menschen zu ermöglichen, sei er nun behindert oder nicht.
Die Tatsache, dass gesellschaftliche Einflüsse Behinderungen entstehen lassen oder begünstigen können, ist nicht neu. Die Frage der Entwicklung und des Verstehens von Menschen mit geistiger Behinderung kann nur durch die Miteinbeziehung der gesellschaftlichen Beeinflussung behandelt werden.
Glücklicherweise wird immer mehr erkannt, dass auch Menschen mit einer geistigen Be- hinderung Recht auf ein Privatleben haben, das sexuelle Empfindungen und Lustgefühle einschließt. Diese neuen Freiräume erlauben die Erfahrung einer Geschlechtsrollenidentität und die Selbstbestätigung als ‘normaler Mann’ und als ‘normale Frau’ anerkannt zu werden. Sexualität ist als menschliches Grundbedürfnis zu verstehen, als motivationale Grundener- gie mitmenschlichen Seins, dessen ersatzlose Streichung zur Vermehrung der Behinderung führt.
4.1 Begri sbestimmung: Sexualität
Sexualität galt lange Zeit nur als Akt der Fortpflanzung, als Genitalsexualität. Mit dem Wan- del gesellschaftlicher Normen und durch die Möglichkeit der Kontrazeption ist die reine Fortpflanzungsfunktion heute in den Hintergrund getreten. Das heißt, dass verschiedene For- men des sozialen Kontaktes, zwischenmenschliche Beziehungen und der sogenannte ‘Mit- telbereich’ von Zärtlichkeit, Sensualität und Erotik bedeutsame Aspekte der menschlichen Sexualität bilden.
Der Mittelbereich spielt bei Menschen mit geistiger Behinderung eine wichtige Rolle. Er stammt von Sporken (1974), der versucht hat, den Begriff Sexualität in einem dreistufigen Schema zu erfassen. Sexualität meint:
1. Das ganze Gebiet von Verhaltensweisen in den allgemein menschlichen Beziehungen (im sogenannten koedukativen Alltag),
2. den Mittelbereich von Zärtlichkeit, Sexualität, Erotik und
3. die Genitalsexualität.
Der Mittelbereich der Sexualität spielt zwar bei Menschen mit geistiger Behinderung eine wichtige Rolle, jedoch sollte die genitale Sexualität nicht gänzlich vergessen werden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Haben Menschen mit geistiger Behinderung ein Recht auf Sexualität?
Ja, Sexualität wird heute als Grundbedürfnis und Recht in der normalen Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen, auch bei geistiger Behinderung, anerkannt.
Was ist das Ziel des Modells „Special Love Talks“?
Das Modell dient der sexualpädagogischen Begleitung, um die Sprachlosigkeit zu brechen und Menschen mit Behinderungen sowie deren Umfeld beim Umgang mit Sexualität zu unterstützen.
Welche Probleme ergeben sich bei der Sexualerziehung in diesem Bereich?
Häufige Hürden sind kognitive Einschränkungen in der Kommunikation, gesellschaftliche Tabus sowie eine Überforderung oder mangelnde Information seitens der Betreuer und Eltern.
Was wird unter der Diskrepanz zwischen Sexualalter und Intelligenzalter verstanden?
Es beschreibt den Umstand, dass die körperliche sexuelle Entwicklung oft dem kognitiven Entwicklungsstand vorausgeht, was spezifische pädagogische Ansätze erfordert.
Welche Rolle spielen die Einstellungen der Betreuer und Gynäkologen?
Die Einstellungen des Umfelds sind entscheidend für die sexuelle Selbstbestimmung der Betroffenen. Vorurteile oder Unsicherheiten können den Zugang zu Sexualität unnötig einschränken.
Welche Themen werden in der sexualpädagogischen Begleitung behandelt?
Die Palette reicht von Partnerschaft und Masturbation über Verhütung und Sterilisation bis hin zu Kinderwunsch und dem Schutz vor Missbrauch.
- Citar trabajo
- Antonia Schlick (Autor), 2004, Special Love Talks - Evaluierung und Implementierung eines Modells zur sexualpädagogischen Begleitung für den Lebensbereich von Menschen mit geistiger Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29830