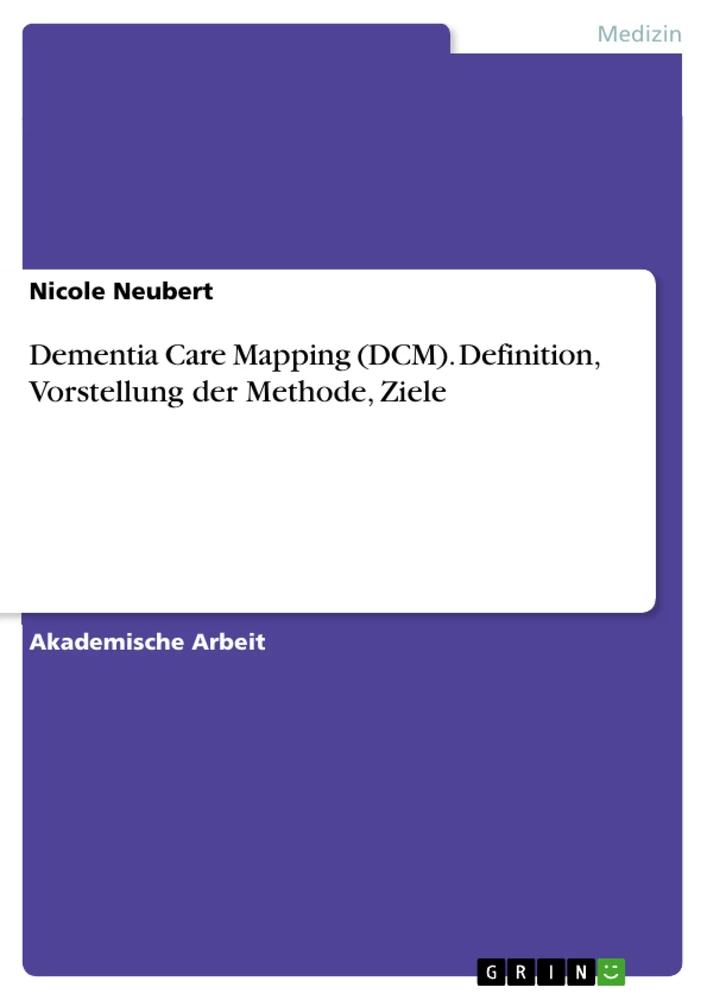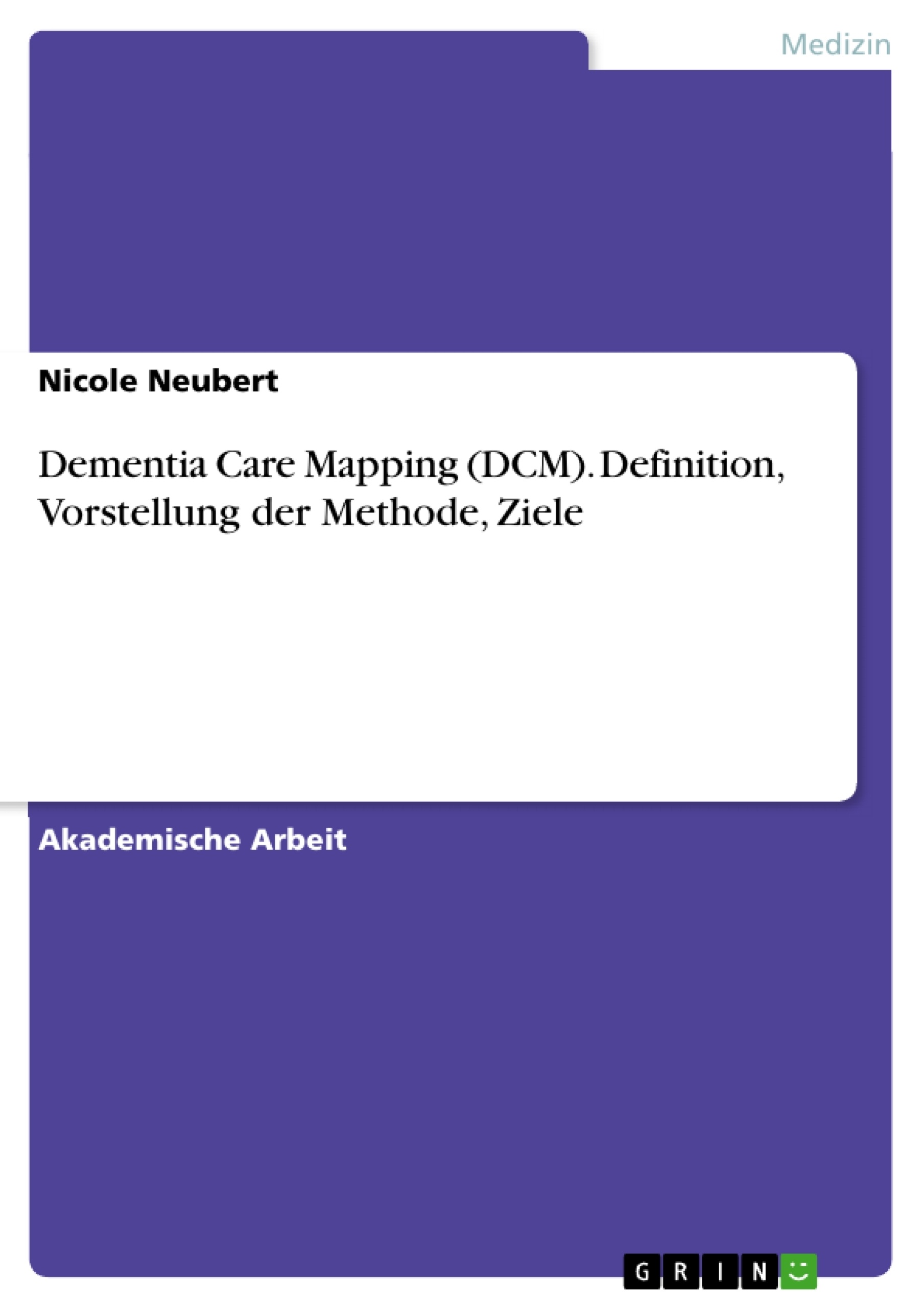In der Diskussion um die Qualität in der Pflege dementiell erkrankter Menschen lassen sich drei Tendenzen beobachten: erstens die Abkehr von klinischen und funktionalen Qualitätskriterien, die die Verfolgung funktional bestimmter Ziele, die Aufrechterhaltung der Kontrolle über Körper, Gefühlsausdruck und Verhalten und die Erreichung eines im Vorhinein bestimmten Gesundheitsstatus anstreben; zum zweiten stehen psychologische Fragen des Wohlbefindens in Abhängigkeit zu Fragen der gesundheitlichen Verfassung und umgekehrt, d.h. die Gesundheitsfrage kann nicht unabhängig von den damit verbundenen Gefühlen und Bewertungen betrachtet werden; so gibt es demnach keine strikte Trennung zwischen subjektiven und objektiven Qualitätsaspekten. Eine dritte Tendenz spiegelt sich dahingehend wider, dass nicht objektive Zustände, sondern die subjektiven Bewertungen entscheidend sind; nicht der Zustand an sich, sondern wie der Betroffene selbst den Zustand sieht, bewertet und einschätzt ist ausschlaggebend.
Schlussfolgernd daraus gewinnen die subjektiven, personenbezogenen Qualitätskriterien zunehmend an Bedeutung, insbesondere das psychologische Wohlbefinden und die individuelle Wahrnehmung und Wertung der Lebensqualität. Subjektive Lebensqualität bezieht sich auf Gefühle, Emotionen als auch auf subjektive Interpretationen und Wertungen dieser Gefühle. Bezogen auf die Pflege und Betreuung dementiell Erkrankter besteht die Herausforderung darin, die Gefühle, Präferenzen und Wertungen jener Menschen zu verstehen, die sich nicht verlässlich äußern können, besonders auch dann, wenn biographische Daten kaum vorhanden sind oder aber wenig darüber aussagen, wie der Demente vor Eintreten der kognitiven Beeinträchtigung sein Leben betrachtete oder Gefühle und Werte zum Ausdruck brachte. Es besteht somit die Notwendigkeit, durch Beobachten Wohlbefinden, Affekte, Vorlieben und Abneigungen entsprechend zu deuten bzw. zu rekonstruieren anhand des von der Behinderung bereits „überformten“ Ausdrucks, der Körpersprache und Interaktionsweisen aber auch der Tätigkeiten und Aktivitäten des dementiell Erkrankten. Das Resultat bildet ein nachempfundenes, eingefühltes Wohlempfinden eines Dementen durch einen beobachtenden Dritten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition und Vorstellung der Methode DCM
- 3 Ziele
- 4 Voraussetzungen für die Anwendung von Dementia Care Mapping
- 5 Ethische, sozialpsychologische und neurologische Bedeutung des Personseins
- 6 Maligne Sozialpsychologie (MSP)
- 7 Positive Personenarbeit (PPW) und ihre Wirkung
- 8 Studie zur Einführung von DCM am Beispiel des AWO-Feierabendheims
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Methode des Dementia Care Mapping (DCM) vorzustellen und deren Bedeutung für die Pflege dementiell erkrankter Menschen zu erläutern. Es werden die Grundlagen, die Anwendung und die ethischen Implikationen des Verfahrens diskutiert.
- Definition und Anwendung von Dementia Care Mapping (DCM)
- Ethische und sozialpsychologische Aspekte der Demenzpflege
- Bedeutung des Personseins bei Demenz
- Positive Personenarbeit (PPW) im Kontext von DCM
- Einführung von DCM in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt drei beobachtbare Tendenzen in der Diskussion um die Qualität der Pflege dementiell erkrankter Menschen: die Abkehr von rein klinischen und funktionalen Qualitätskriterien zugunsten subjektiver, personenbezogener Kriterien; die Verknüpfung von psychischem Wohlbefinden und gesundheitlicher Verfassung; und die zunehmende Bedeutung subjektiver Bewertungen der Lebensqualität. Die Herausforderung besteht darin, die Gefühle und Präferenzen von Menschen mit Demenz zu verstehen, die sich nicht verlässlich artikulieren können. Die Methode Dementia Care Mapping (DCM) wird als Ansatz zur Erfassung und Verbesserung des Wohlbefindens vorgestellt.
2 Definition und Vorstellung der Methode DCM: Dieses Kapitel definiert und beschreibt die Methode Dementia Care Mapping (DCM), die von Tom Kitwood entwickelt wurde. DCM ist ein werteorientiertes und personenzentriertes Verfahren, das das Wohlbefinden dementiell erkrankter Menschen anhand ihres Verhaltens und Erscheinungsbildes detailliert erfasst. Es basiert auf einem Beobachtungssystem mit Kodierung von Verhaltenskategorien und Wohlfühlwerten, um ein besseres Verständnis der individuellen Bedürfnisse und des Erlebens der Betroffenen zu ermöglichen. Die Methode dient der Verbesserung der Pflegequalität durch die Identifizierung von Ressourcen und personenzentrierten Handlungsweisen. Der "Mapper" beobachtet ausgewählte Bewohner und kodiert ihr Verhalten in fünfminütigen Intervallen, wobei verschiedene Kategorien und Wohlfühlwerte berücksichtigt werden. Die Auswertung ermöglicht die Verbesserung der Pflege und Tagesstrukturierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Dementia Care Mapping (DCM)"
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Methode des Dementia Care Mapping (DCM), ihre Anwendung in der Demenzpflege und deren ethische Implikationen. Es beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Beschreibung der Methode, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselthemen.
Was ist Dementia Care Mapping (DCM)?
Dementia Care Mapping (DCM) ist eine von Tom Kitwood entwickelte, werte- und personenzentrierte Methode zur Erfassung und Verbesserung des Wohlbefindens dementiell erkrankter Menschen. Sie basiert auf detaillierten Beobachtungen des Verhaltens und Erscheinungsbildes der Betroffenen, die in Kategorien und Wohlfühlwerten kodiert werden. Ziel ist es, die individuellen Bedürfnisse und das Erleben der Betroffenen besser zu verstehen und die Pflegequalität zu verbessern.
Wie funktioniert DCM in der Praxis?
Ein "Mapper" beobachtet ausgewählte Bewohner über fünfminütige Intervalle und kodiert ihr Verhalten anhand verschiedener Kategorien und Wohlfühlwerte. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht die Identifizierung von Ressourcen und die Entwicklung personenzentrierter Handlungsweisen zur Verbesserung der Pflege und Tagesstrukturierung.
Welche ethischen und sozialpsychologischen Aspekte werden behandelt?
Das Dokument thematisiert die ethische und sozialpsychologische Bedeutung des Personseins bei Demenz und diskutiert den Einfluss von maligner Sozialpsychologie (MSP) im Gegensatz zur positiven Personenarbeit (PPW). Es betont die Wichtigkeit, die Gefühle und Präferenzen von Menschen mit Demenz zu verstehen und zu berücksichtigen, auch wenn diese sich nicht immer verlässlich artikulieren können.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Einleitung, Definition und Vorstellung von DCM, Zielen, Voraussetzungen für die Anwendung von DCM, ethischer, sozialpsychologischer und neurologischer Bedeutung des Personseins, maligner Sozialpsychologie (MSP), positiver Personenarbeit (PPW) und deren Wirkung, sowie eine Fallstudie zur Einführung von DCM in einem AWO-Feierabendheim.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, DCM vorzustellen, seine Bedeutung für die Demenzpflege zu erläutern und die Grundlagen, Anwendung und ethischen Implikationen zu diskutieren. Es soll ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse dementiell erkrankter Menschen ermöglichen und die Verbesserung der Pflegequalität fördern.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Definition und Anwendung von DCM, ethische und sozialpsychologische Aspekte der Demenzpflege, die Bedeutung des Personseins bei Demenz, positive Personenarbeit (PPW) im Kontext von DCM und die praktische Einführung von DCM.
- Quote paper
- Nicole Neubert (Author), 2004, Dementia Care Mapping (DCM). Definition, Vorstellung der Methode, Ziele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298244