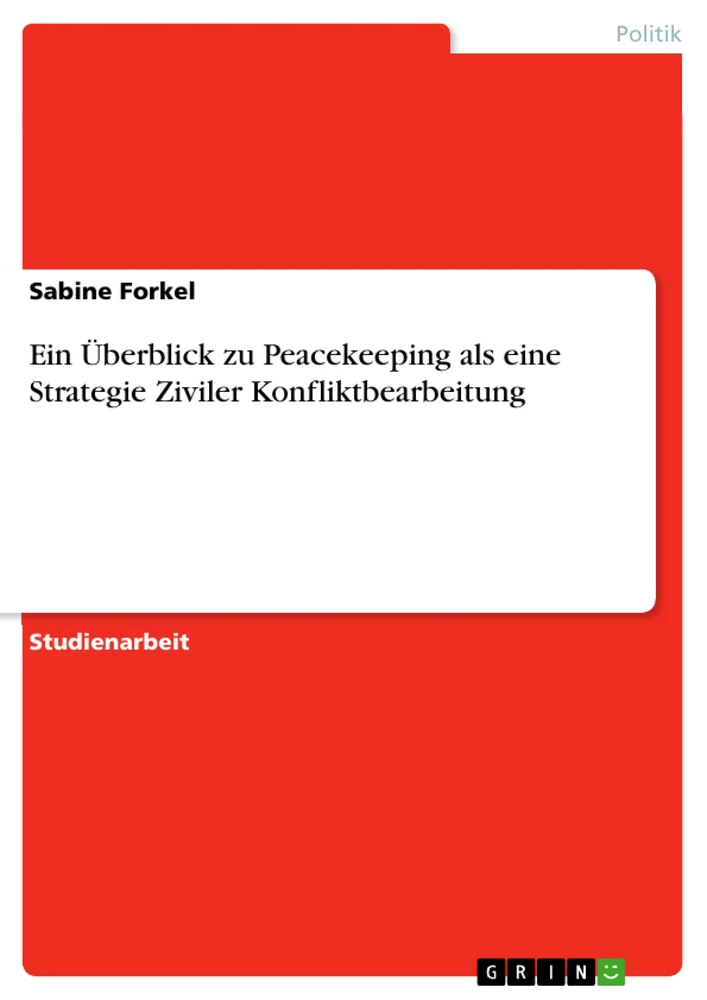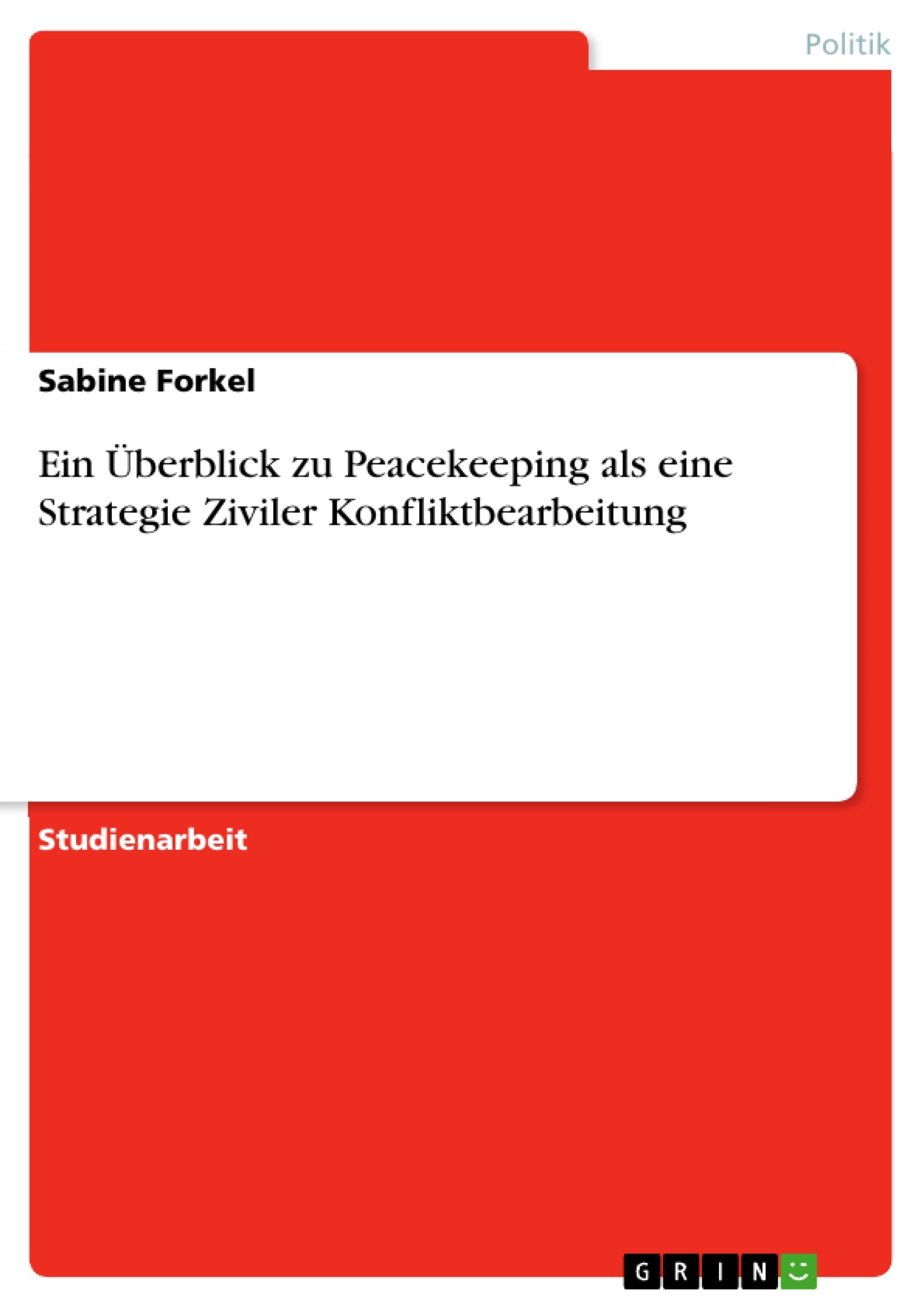Spätestens seit den Demokratisierungsprozessen in einigen arabischen Staaten Nordafrikas realisiert die Weltgemeinschaft die seit langem prognostizierten positiven Entwicklungen vieler Entwicklungsländer hinsichtlich Wirtschaftswachstum und Demokratisierung. Vorzeigestaaten wie zum Beispiel Ghana werden gern als Beispiel für einen nachhaltigen und gewissenhaften Umgang mit Staatsressourcen herangezogen und zeigen, dass sich trotz ethnischer, kultureller und wirtschaftlicher Heterogenität innerstaatliche Konflikte langfristig vermeiden lassen.
Dennoch sind weite Teile der Erde weiterhin von gewaltvollen Konflikten betroffen, welche eine politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung blockieren und die Regionen langfristig destabilisieren. Spätestens seit die Gefahr internationaler Terrorregime zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückte, wandelte sich auch der internationale Blick auf Krisengebiete in Afrika und Asien. Diese werden von internationalen Organisationen wie der UN zunehmend als etwaige Keimzellen für eine internationale terroristische Gefahr angesehen.
Damit änderte sich die Einstellung vieler Industriestaaten hinsichtlich der Verantwortung gegenüber außerkontinentalen, kriegerischen Konflikten und deren Folgen für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch die seit wenigen Jahrzehnten zunehmende Bedeutung des Schutzes universell gültiger Menschenrechte sowie auch die zunehmende politische und wirtschaftliche Autorität und Souveränität regionaler Staatengemeinschaften wie zum Beispiel der Afrikanischen Union spielen dabei eine wichtige Rolle, auf die jedoch im Folgenden nicht weiter eingegangen werden soll.
Stattdessen wirft diese Arbeit die Frage auf, wie internationale Organisationen und Gemeinschaften der Gewalt gegenübertreten und wie sich der Umgang mit gewaltvollen Konflikten in den vergangenen Jahren verändert hat. Da jedoch auch diese Fragestellung den Rahmen dieser im Umfang sehr begrenzten Arbeit sprengen würde, möchte ich mich dabei lediglich auf das relativ neue Konzept des Zivilen Peacekeepings begrenzen, welches als Teilgebiet der Zivilen Konfliktbearbeitung eine Strategie für eine gewaltfreie Konfliktintervention und die Schaffung eines langfristigen Friedensprozesses darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. PEACEKEEPING
- 2.1 ENTWICKLUNG DES KONZEPTS
- 2.2 AKTEURE
- 2.3 EINSATZBEREICHE VON PEACEKEEPERN
- 2.4 WIE ERFOLGEN PEACEKEEPING-EINSÄTZE?
- 3. KRITIK UND PROBLEME DES KONZEPTS
- 4. FAZIT
- 5. BIBLIOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept des Zivilen Peacekeepings als Strategie der Zivilen Konfliktbearbeitung. Sie bietet einen Überblick über die Entwicklung, Akteure, Einsatzbereiche und die Funktionsweise von Peacekeeping-Missionen. Darüber hinaus wird die Kritik am Konzept und dessen Probleme beleuchtet. Die Arbeit zielt darauf ab, ein Verständnis für die Rolle des Zivilen Peacekeepings in der internationalen Konfliktbearbeitung zu vermitteln.
- Entwicklung des Peacekeeping-Konzepts
- Akteure im Peacekeeping
- Einsatzbereiche und -methoden von Peacekeeping-Missionen
- Kritik und Probleme des Peacekeeping-Konzepts
- Bedeutung von Peacekeeping für die Schaffung eines langfristigen Friedens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Kontext für die Diskussion um Peacekeeping dar. Dabei wird die Bedeutung des Konzepts im Hinblick auf gewaltvolle Konflikte und die Rolle internationaler Organisationen hervorgehoben.
2. Peacekeeping
Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Peacekeeping-Konzepts. Es behandelt die Entwicklung des Begriffs, die beteiligten Akteure, die Einsatzbereiche von Peacekeepern und die Vorgehensweise bei Peacekeeping-Missionen. Darüber hinaus werden zentrale Aspekte des Friedensbegriffs, insbesondere der Unterschied zwischen negativem und positivem Frieden, erörtert.
2.1 Entwicklung des Konzepts
Hier wird die historische Entwicklung des Peacekeeping-Konzepts anhand von Schlüsselereignissen und Beispielen von frühen Peacekeeping-Missionen der Vereinten Nationen beschrieben.
Schlüsselwörter
Peacekeeping, Zivile Konfliktbearbeitung, Frieden, Gewalt, Internationale Organisationen, Vereinte Nationen, Blauhelmsoldaten, Konfliktintervention, positive Frieden, negative Frieden, Friedensmissionen, Humanitäre Hilfe, Sicherheitsstabilisierung.
- Quote paper
- Sabine Forkel (Author), 2013, Ein Überblick zu Peacekeeping als eine Strategie Ziviler Konfliktbearbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298227