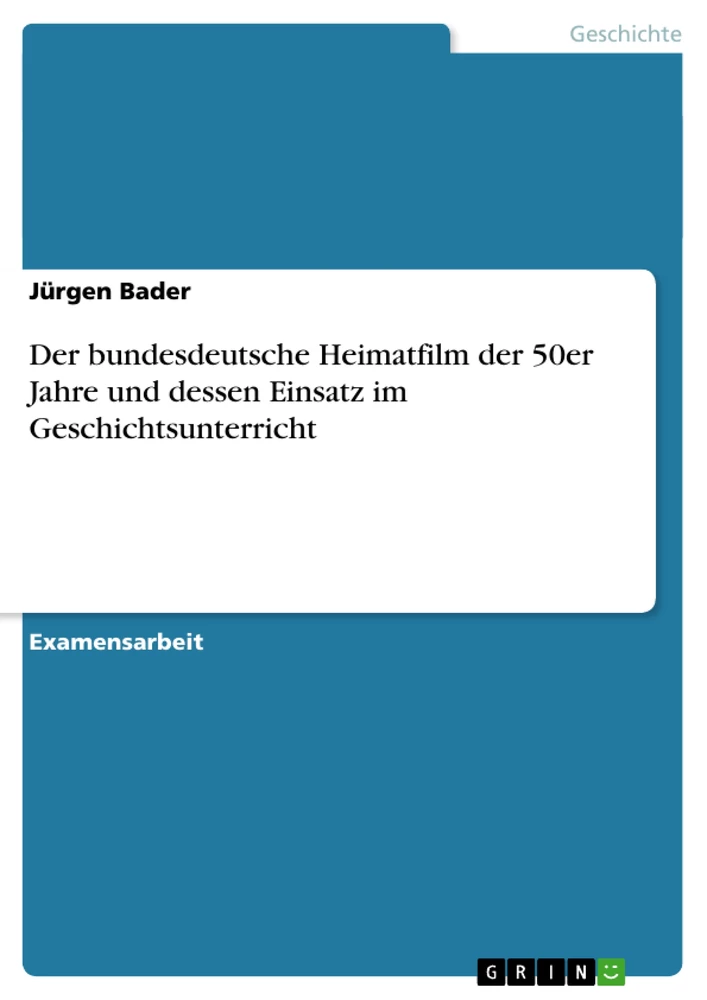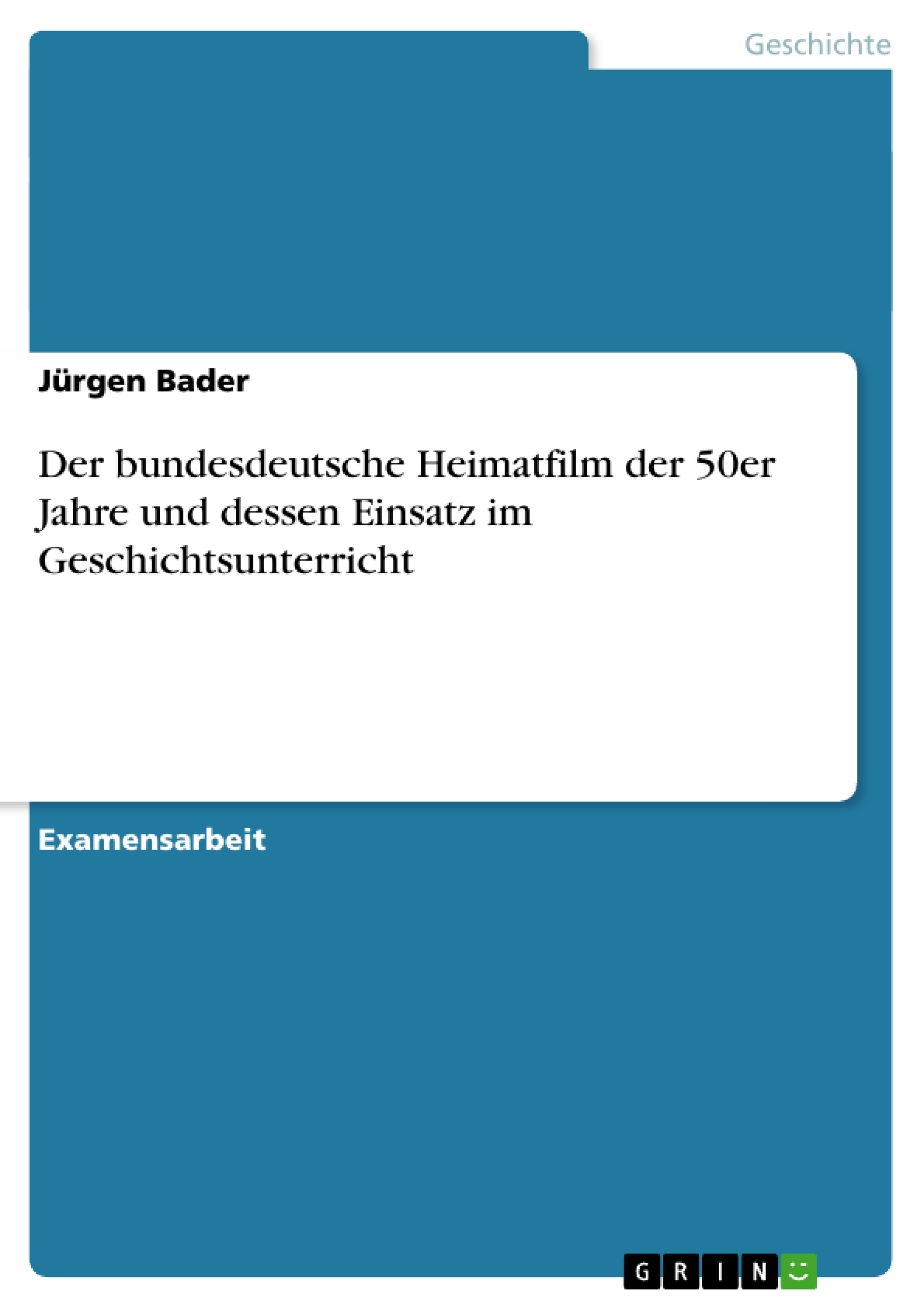Denkt man an die Heimatfilme der 50er, so fallen einem Personen wie das Schwarzwaldmädel oder der Förster vom Silberwald und beeindruckende Landschaften, beispielsweise Heide, Schwarzwald und insbesondere die Alpen ein. Man denkt an seichte Handlungsstränge und imposante Naturaufnahmen, an Liebe, Wilderer und Förster, die mit ihrer Klugheit und Umsichtigkeit die Natur und die Landbevölkerung vor der Zerstörung retten.
Umso mehr mag es deshalb für manchen unerklärbar sein, wie dieses Genre sich zu damaliger Zeit einen solch großen Zuspruch beim Publikum erarbeiten konnte und diesen teilweise auch heute noch hat, denkt man nur an die ständigen Wiederholungen im Fernsehen. Ein Erfolg, den kein anderer Filmtyp in der Filmgeschichte der Bundesrepublik jemals wiederholen konnte und deren Zuschauerzahlen wahrscheinlich für immer unerreicht werden bleiben, lockte doch allein der „Förster vom Silberwald“ zwischen 1955 und 1958 22 Millionen Zuschauer ins Kino2 und das gegen die Konkurrenz von Filmklassikern wie „Verdammt in alle Ewigkeit“ (1953), „Das verflixte 7. Jahr“ (1955) oder „Die zwölf Geschworenen“ (1957). Vergleicht man diese Zahlen mit heutigen erfolgreichen deutschen Filmen, etwa „Good by Lenin“ den bisher gut 6,3 Millionen3 sahen, bekommt man einen ungefähren Anhaltspunkt über den Publikumserfolg dieser Filme. Diesem Genre würde man aber nicht gerecht werden, wenn man sich dieser Betrachtungsweise anschließen würde. Sicherlich werden die Vorurteile beim oberflächlichen Betrachten dieser Filme zunächst bestätigt. Unbestreitbar sind diese Filme alle nach dem gleichen Muster aufgebaut und natürlich kann nicht von einer Handlung auf hohem Niveau gesprochen werden, doch gerade hinter dem Trivialem verbirgt sich mehr als sich auf den ersten Blick erkennen lässt - nämlich das Lebensgefühl einer ganzen Gesellschaft mit all ihren Sehnsüchten und Bedürfnissen, der Wunsch nach anerkannten Werten und stabilen Institutionen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wissenschaftlicher Teil
- 1.1 Der Begriff Heimat
- 1.5 Zur Geschichte und Identität der Deutschen
- 1.5.1 Die gesellschaftspolitische Lage nach 1945
- 1.5.1 Thematisierung der Thematik Heimat im Film
- 2. Der Heimatfilm
- 2.1 Die Entstehung des Films
- 2.4 Der Heimatfilm der 50er Jahre
- 2.4.1 Die Wurzeln und die Namensgebung
- 2.4.2 Entwicklung, Bedeutung und Erfolg
- 2.5 Einteilung der Heimatfilme in drei Phasen
- 2.6 Überblick über die Heimatfilmforschung
- 3. Die Handlungsstränge der Heimatfilme und inhaltliche Aspekte
- 3.1 Die Handlungsstränge der Heimatfilme
- 3.2 Inhaltliche Aspekte
- 4. Die Funktion der Heimatfilme
- 5. Resümee
- 6. Die systematische Filmanalyse
- 7. Der Heimatfilm im Geschichtsunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den bundesdeutschen Heimatfilm der 1950er Jahre und dessen Eignung für den Geschichtsunterricht an Realschulen. Ziel ist es, die filmischen, inhaltlichen und gesellschaftlichen Aspekte dieser Filmgenre zu beleuchten und pädagogische Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Der Begriff "Heimat" im Wandel der Zeit
- Die Entstehung und Entwicklung des Heimatfilms
- Inhaltliche Aspekte und Handlungsstränge der Heimatfilme der 1950er Jahre
- Die gesellschaftliche Funktion der Heimatfilme
- Der Einsatz von Heimatfilmen im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Wissenschaftlicher Teil: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es befasst sich mit der Definition des Begriffs "Heimat" in verschiedenen historischen Kontexten und analysiert die gesellschaftspolitische Situation nach 1945, die die Entstehung des Heimatfilms maßgeblich beeinflusst hat. Die Entwicklung des Heimatfilmbegriffs wird von 1931 bis 2004 nachgezeichnet und die Bedeutung der Thematik "Heimat" im Film beleuchtet.
2. Der Heimatfilm: Dieses Kapitel verfolgt die Entstehung und Entwicklung des Heimatfilms, beginnend mit den Berg- und Skifilmen der 1920er Jahre und den "Blut und Boden"-Filmen des Nationalsozialismus. Der Fokus liegt auf dem Heimatfilm der 1950er Jahre: seine Wurzeln, seine Entwicklung, seine Bedeutung und seinen Erfolg. Es werden verschiedene Phasen des Heimatfilms unterschieden und die einschlägige Forschungsliteratur vorgestellt.
3. Die Handlungsstränge der Heimatfilme und inhaltliche Aspekte: Dieses Kapitel analysiert die typischen Handlungsstränge des Heimatfilms der 1950er Jahre, insbesondere den Umgang mit der Natur, die Darstellung von Liebesgeschichten (oft Dreiecksbeziehungen) und die Verwendung der Verwechslung als dramaturgisches Mittel. Es werden inhaltliche Aspekte wie die Stellung der Frau, die Besetzung der Hauptrollen, die Erziehung, die familiären Strukturen, das Verhältnis von Natur und Mensch sowie die Gegenüberstellung von Stadt und Land eingehend untersucht.
4. Die Funktion der Heimatfilme: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Funktion der Heimatfilme. Es geht insbesondere um die Vermittlung von Werten und Normen, die Integration von Flüchtlingen und die Funktion als Urlaubsersatz. Die Analyse zeigt auf, wie der Heimatfilm die Nachkriegsgesellschaft prägte und zur Stabilisierung beitrug.
6. Die systematische Filmanalyse: Dieses Kapitel beschreibt methodische Ansätze zur Filmanalyse mit Fokus auf Einstellungsgrößen, -perspektiven und -bewegungen. Es beinhaltet exemplarisch ein Sequenzprotokoll zu "Schwarzwaldmädel" und eine Dialogliste aus "Der Förster vom Silberwald". Dies dient als Grundlage für die didaktische Betrachtung im folgenden Kapitel.
7. Der Heimatfilm im Geschichtsunterricht: Dieser Teil widmet sich der didaktischen Nutzung von Heimatfilmen im Geschichtsunterricht der Realschule. Er beleuchtet notwendige Voraussetzungen und Kenntnisse, den Bezug zum aktuellen und zukünftigen Bildungsplan sowie die Darstellung der 1950er Jahre in Schulbüchern. Es wird ein konkreter methodischer Ansatz zur didaktischen Aufbereitung und Vermittlung des Themas skizziert.
Schlüsselwörter
Heimatfilm, 1950er Jahre, bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte, Filmgeschichte, Geschichtsunterricht, Realschule, Filmanalyse, Identität, Wertevermittlung, gesellschaftliche Funktion, Sozialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des bundesdeutschen Heimatfilms der 1950er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den bundesdeutschen Heimatfilm der 1950er Jahre und seine Eignung für den Geschichtsunterricht an Realschulen. Sie beleuchtet die filmischen, inhaltlichen und gesellschaftlichen Aspekte dieses Genres und zeigt pädagogische Einsatzmöglichkeiten auf.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Begriff "Heimat" im Wandel der Zeit, die Entstehung und Entwicklung des Heimatfilms, inhaltliche Aspekte und Handlungsstränge der Heimatfilme der 1950er Jahre, die gesellschaftliche Funktion der Heimatfilme und den Einsatz von Heimatfilmen im Geschichtsunterricht. Es werden auch methodische Ansätze zur Filmanalyse vorgestellt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument gliedert sich in mehrere Kapitel: einen wissenschaftlichen Teil mit der Definition von "Heimat", ein Kapitel über die Geschichte des Heimatfilms (inklusive seiner Entstehung und Entwicklung in verschiedenen Phasen), eine Analyse der Handlungsstränge und inhaltlichen Aspekte der Filme, eine Betrachtung der gesellschaftlichen Funktion der Heimatfilme, ein Kapitel zur systematischen Filmanalyse mit Beispielen und schließlich ein Kapitel über den Einsatz von Heimatfilmen im Geschichtsunterricht.
Welche Aspekte des Heimatfilms werden analysiert?
Die Analyse umfasst die typischen Handlungsstränge (z.B. Umgang mit der Natur, Liebesgeschichten, Verwechslungen), inhaltliche Aspekte wie die Stellung der Frau, familiäre Strukturen, das Verhältnis von Stadt und Land, die Vermittlung von Werten und Normen, die Integration von Flüchtlingen und die Funktion als Urlaubsersatz. Die filmische Analyse betrachtet z.B. Einstellungsgrößen, -perspektiven und -bewegungen.
Welche Bedeutung hat der Heimatfilm für die Nachkriegsgesellschaft?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Heimatfilms für die Stabilisierung der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Es wird analysiert, wie der Heimatfilm zur Vermittlung von Werten und Normen beitrug und die Integration von Flüchtlingen unterstützte.
Wie können Heimatfilme im Geschichtsunterricht eingesetzt werden?
Das Dokument skizziert einen methodischen Ansatz zur didaktischen Aufbereitung und Vermittlung von Heimatfilmen im Geschichtsunterricht der Realschule. Es werden notwendige Voraussetzungen und Kenntnisse, der Bezug zum Bildungsplan und die Darstellung der 1950er Jahre in Schulbüchern beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimatfilm, 1950er Jahre, bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte, Filmgeschichte, Geschichtsunterricht, Realschule, Filmanalyse, Identität, Wertevermittlung, gesellschaftliche Funktion, Sozialgeschichte.
Gibt es Beispiele für die Filmanalyse?
Ja, das Kapitel zur systematischen Filmanalyse enthält ein exemplarisch ausgeführtes Sequenzprotokoll zu "Schwarzwaldmädel" und eine Dialogliste aus "Der Förster vom Silberwald".
- Arbeit zitieren
- Jürgen Bader (Autor:in), 2004, Der bundesdeutsche Heimatfilm der 50er Jahre und dessen Einsatz im Geschichtsunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29801