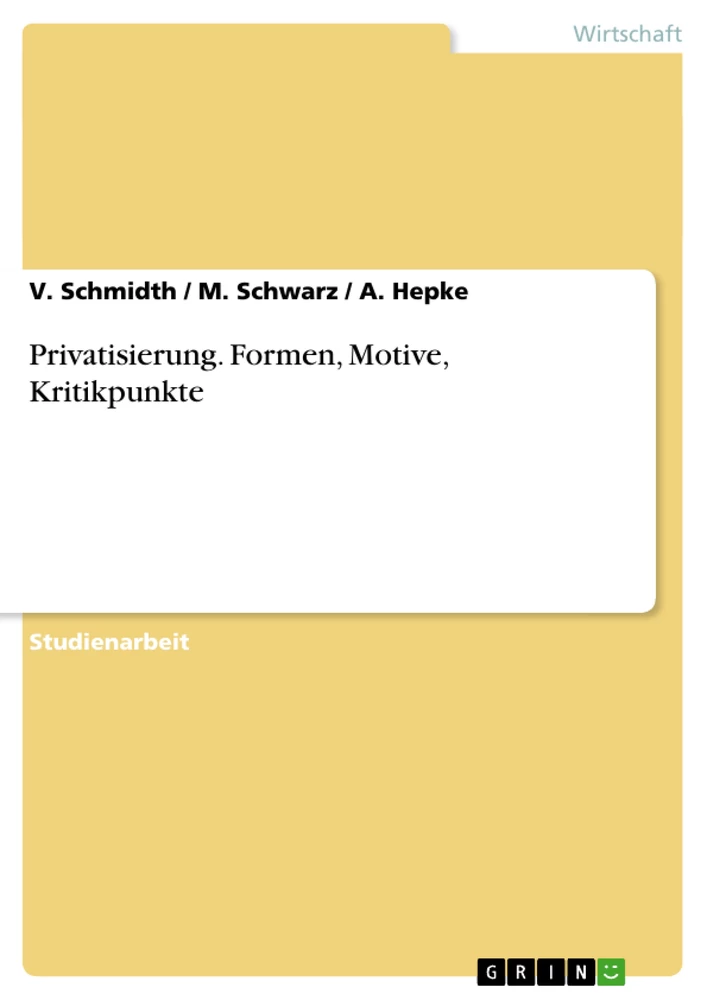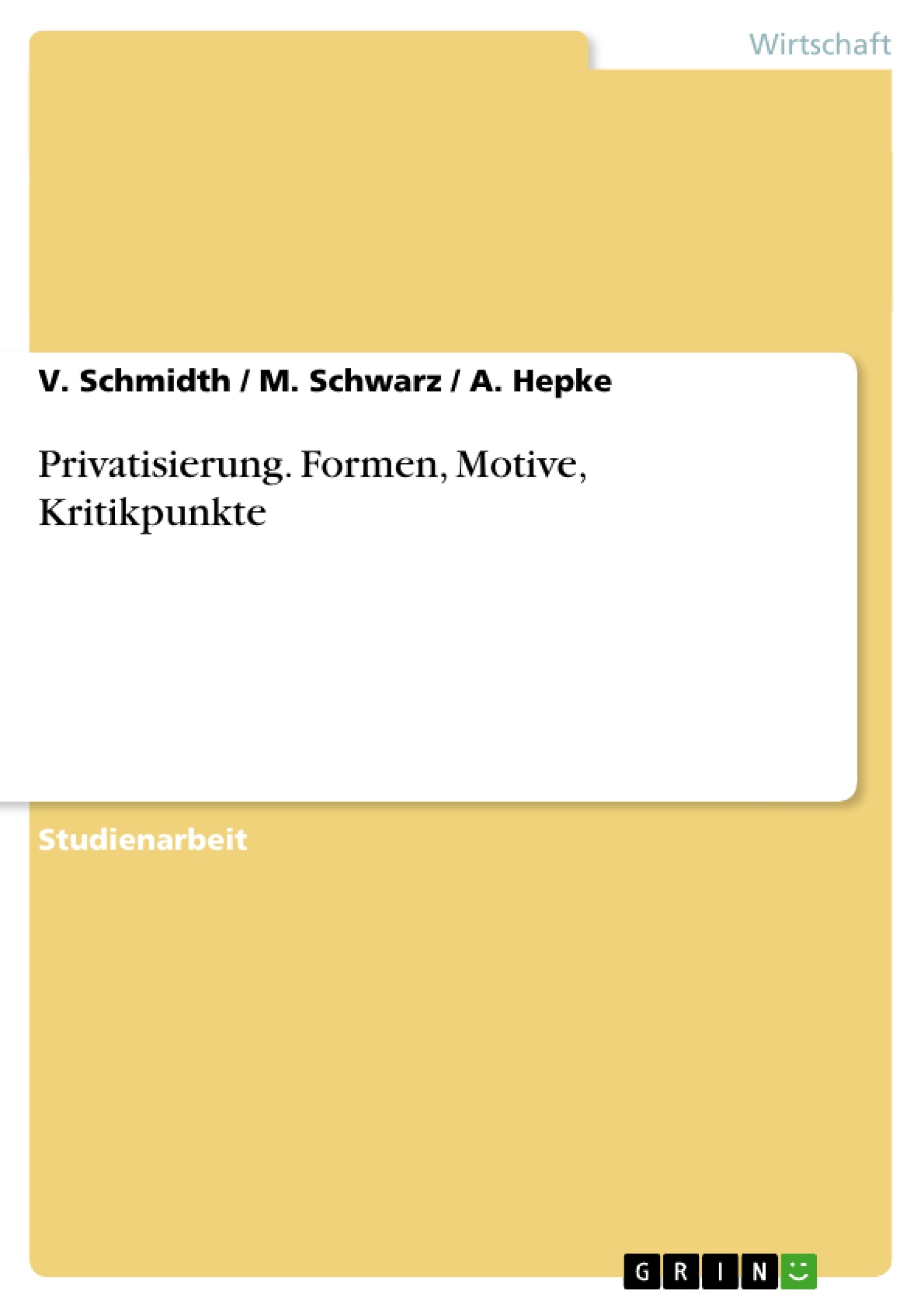Vor allem der defizitäre Zustand der Staatsfinanzen nährt gegenwärtig die Privatisierungsdiskussion. Das Diktat der leeren Kassen und zunehmender Verschuldung des öffentlichen Sektors zwingt immer mehr Gebietskörperschaften zum Abschied von der Praxis einer expansiven Ausgabenpolitik. Beweggrund für die Privatisierung öffentlicher Unternehmensbeteiligungen ist daher oftmals eine angestrebte Entlastung des Haushalts. Diese erhofft man sich einerseits durch die Erzielung von Einnahmen in Form von Privatisierungserlösen, andererseits durch die Einsparungen von Ausgaben in Form von Subventionen, wie z.B. Zuschüsse, Zuwendungen und Verlustausgleiche.
Kritik an der öffentlichen Verwaltung wird überwiegend global vorgetragen, d.h., sie bezieht sich in der Regel auf die öffentliche Verwaltung als Ganzes. Pauschalurteile sind zwar außerordentlich publikumswirksam geben aber keine konkreten Hinweise, was zu verbessern wäre. In dieser Seminararbeit wird versucht, das komplexe System Privatisierung unter verschiedenen Blickwinkeln zu konkretisieren. Abschließend sei hier noch festgehalten, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit der Seminararbeit mit Substantiven männlichen Geschlechts - wie z.B. Masseverwalter - immer auch das weibliche Geschlecht angesprochen ist.
Privatisierung (Schwarz Martina)
Seit Ende der 80er Jahre ist das Schlagwort „Privatisierung“ zunehmend in Verwendung. Es wurde damals besonders in Verbindung mit Veränderungen gesetzt.
Begriff der Privatisierung
Der Begriff der Privatisierung wird unterschiedlich definiert. In dieser Arbeit wird nur eine mögliche Definition wiedergegeben. „Wir verstehen unter Privatisierung die Übereignung von staatlichem oder kommunalem Eigentum an Private, wobei es sich um die vollständige oder teilweise Übertragung bzw. Veräußerung von öffentlichem Vermögen (Grundstücke, Betriebe oder Unternehmensbeteiligungen) an private Personen oder Unternehmen handelt.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Privatisierung (Schwarz Martina)
- Begriff der Privatisierung
- Privatisierungsziele und Zielkonflikte
- Privatisierungsformen (Martina Schwarz)
- Leistungsprivatisierung
- Formelle Privatisierung (Organisationsprivatisierung)
- Materielle Privatisierung
- Organisatorische Privatisierung
- Funktionale Privatisierung
- Vermögensprivatisierung
- Motive der Privatisierung (Viktoria Schmidt)
- Kritikpunkte zur Privatisierung (Viktoria Schmidt)
- Verschlechterung der Beschäftigungsbedingungen
- Abziehen der Entscheidungskompetenz
- Erhöhter Regulierungsbedarf
- Geringerer Verbrauchernutzen
- Argumente für Privatisierung (Viktoria Schmidt)
- Effizienzvorteile
- Exkurs: Anforderungen an Effizienzvergleiche
- Einsatzbereiche von PPP
- Niedrigeres Niveau der Leistungsqualität
- Wegfall des öffentlichen Dienstrechts
- Entpolitisierung der Entscheidungsprozesse
- Wettbewerbspolitik der EU (Viktoria Schmidt)
- Public Private Partnership (Anja Hepke)
- Definition
- Grundgedanke des PPP-Konzeptes
- PPP-Grundformen
- Öffentlich-private Vertragsbeziehungen
- Gesellschaftsrechtliche Formen
- Bürgerschaftliche Kooperationen
- Informelle Kooperationen
- Bisherige Erfahrungen mit Public Private Partnership
- USA
- Großbritannien
- Deutschland
- Österreich im Bereich Verkehr
- Vor- und Nachteile von PPP-Finanzierungsmodelle
- Vorteile
- Nachteile
- Kooperationsansätze
- Motive für PPP
- Risiken und Probleme
- Konkurrieren statt Privatisieren (Martina Schwarz)
- Alternative zur Privatisierung: New Public Management (Viktoria Schmidt)
- Internationale Entwicklungen (Viktoria Schmidt)
- Großbritannien
- Neuseeland
- Praktisches Beispiel: Privatisierung Wasserversorgung (Viktoria Schmidt)
- Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Privatisierung (Viktoria Schmidt)
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Privatisierung und analysiert die verschiedenen Formen, Motive und Kritikpunkte dieses Prozesses. Es wird die Frage untersucht, inwieweit Privatisierung zu einer Verbesserung der Effizienz und Qualität öffentlicher Leistungen führen kann, sowie welche Auswirkungen sie auf die Beschäftigungssituation und die Entscheidungsfindung hat.
- Analyse der verschiedenen Privatisierungsformen und ihrer Auswirkungen
- Untersuchung der Motive und Argumente für und gegen Privatisierung
- Bewertung der Effizienz und Qualität öffentlicher Leistungen nach Privatisierung
- Beurteilung der Auswirkungen von Privatisierung auf Beschäftigung und Entscheidungsfindung
- Analyse des Konzepts Public Private Partnership (PPP) und seiner Anwendungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Privatisierung vor und skizziert die Inhalte der Arbeit. Kapitel 2 behandelt den Begriff der Privatisierung und die wichtigsten Privatisierungsziele. Kapitel 3 geht auf die verschiedenen Formen der Privatisierung ein, darunter die Leistungsprivatisierung, die formelle und die materielle Privatisierung. Kapitel 4 untersucht die Motive für die Privatisierung, während Kapitel 5 die Kritikpunkte an diesem Prozess beleuchtet. Kapitel 6 diskutiert Argumente für Privatisierung, insbesondere im Hinblick auf die Effizienz. Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Wettbewerbspolitik der EU im Zusammenhang mit Privatisierung. Das Kapitel über Public Private Partnership (PPP) analysiert das Konzept, seine Grundformen, Erfahrungen in verschiedenen Ländern und die Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsmethode. In Kapitel 12 wird die Alternative zur Privatisierung, das New Public Management, vorgestellt. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einer Schlussfolgerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Privatisierung, Privatisierungsformen, Effizienz, Qualität, Beschäftigung, Entscheidungsfindung, Public Private Partnership (PPP), New Public Management, Wettbewerbspolitik der EU, und die Auswirkungen dieser Themen auf den öffentlichen Sektor.
- Quote paper
- V. Schmidth (Author), M. Schwarz (Author), A. Hepke (Author), 2002, Privatisierung. Formen, Motive, Kritikpunkte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29756