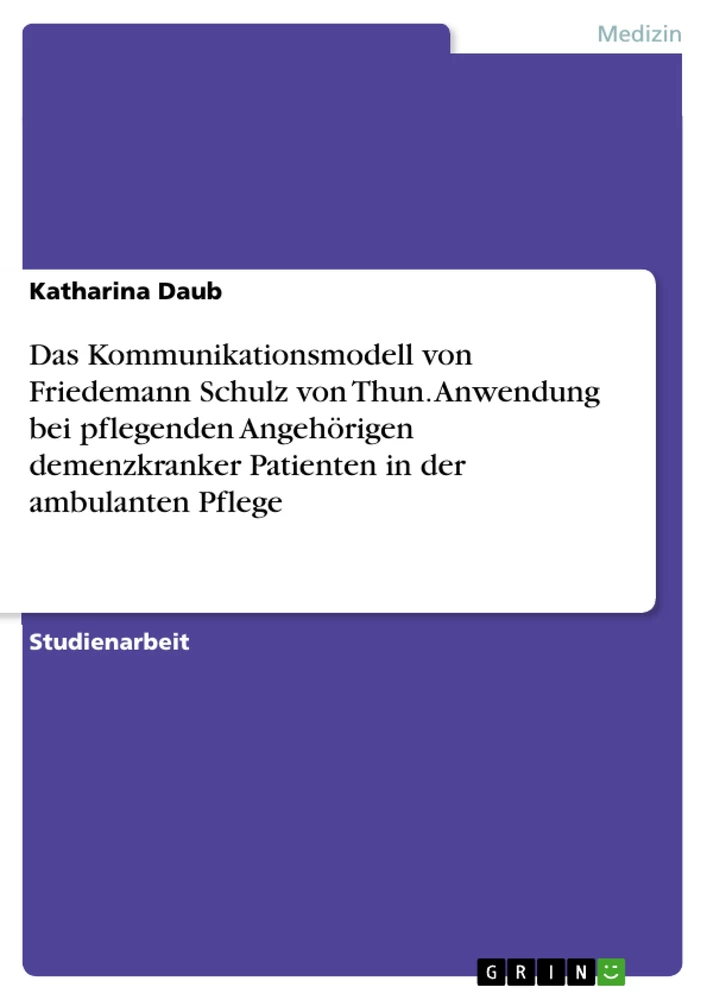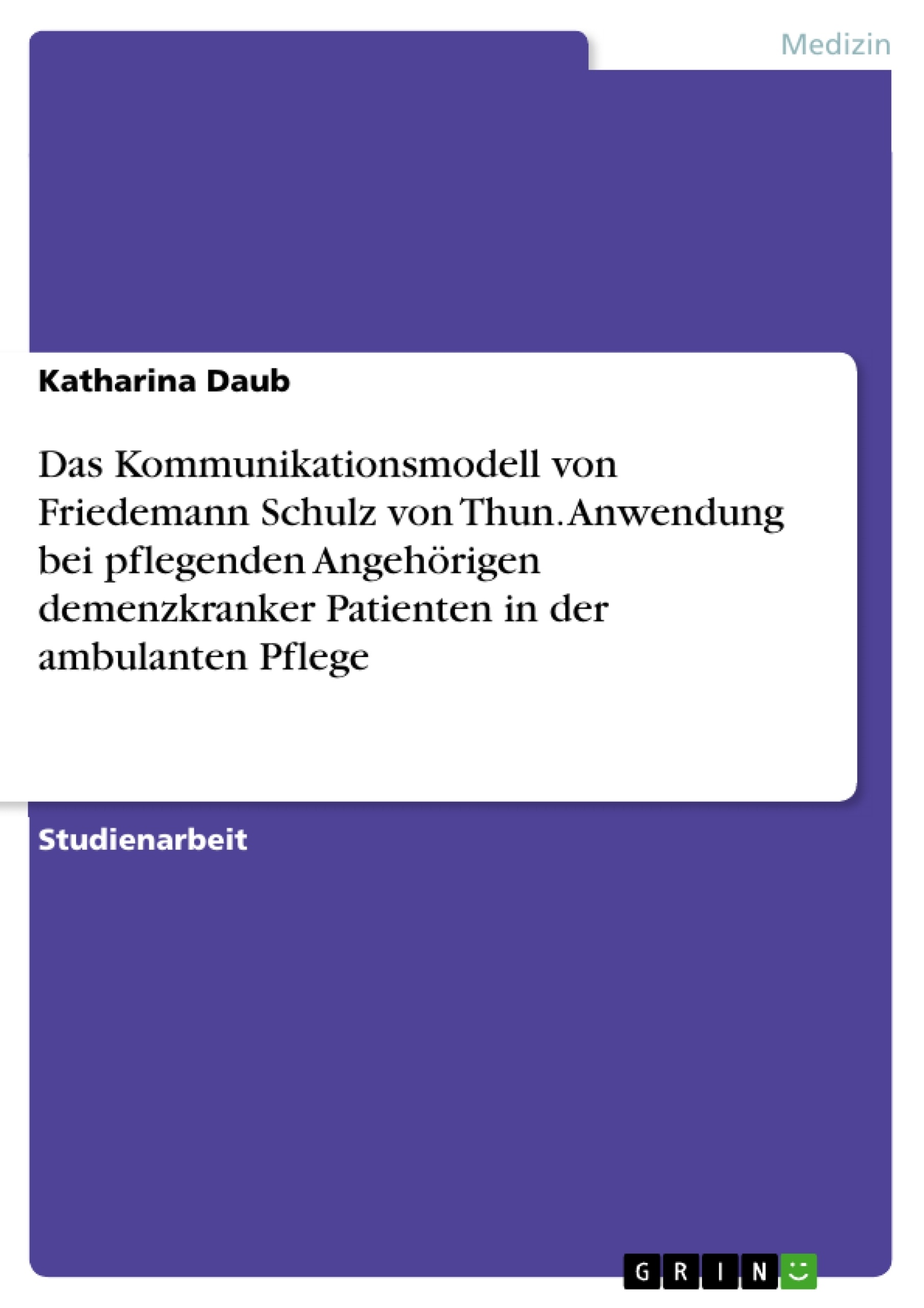„Die Demenzerkrankung erfasst im Krankheitsverlauf alle Lebensbereiche: Der Betroffene wird nicht nur vergesslicher, sondern verliert Zug um Zug seine Fähigkeiten, selbstständige Tätigkeiten auszuüben, für sich zu sorgen und Beziehungen zu pflegen. Das heißt, er wird schrittweise immer hilfloser. Das ist nicht nur für ihn ein sehr schweres Los, sondern auch für die anderen Familienmitglieder und natürlich besonders für diejenigen, der die Hauptlast der Pflege auf sich nimmt.“ (Engel 2006, 12).
In Deutschland leben nach Schätzungen ca. 1,3 Millionen Menschen mit einer Demenz (Schüttlerlin 2011). Aufgrund des demografischen Wandels werden die Zahlen der demenziell erkrankten Menschen in Deutschland stetig wachsen (Schüttlerlin 2011). Die meisten der an Demenz erkrankten werden nach wie vor zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung versorgt (Schüttlerlin 2011). Die Belastung der pflegenden Angehörigen bei demenziell erkrankten Menschen ist sehr hoch. Da die zu leistende Pflege psychisch sehr belastend ist, aufgrund von Wesensveränderungen durch die Demenz, kann es bspw. zu einem gestörtem Tag-/Nachtrhythmus etc. kommen (Schüttlerlin 2011).
Häufig werden pflegende Angehörige bei der täglichen Pflege von ambulanten Pflegediensten unterstützt, gerade bei professionellen Pflegekräften kann von den Angehörigen auch einmal „Dampf abgelassen“ werden. Immer wieder kommt es vor, dass Angehöriger demenziell erkrankter Menschen, Kritik an professionelle Pflegekräfte richten. Dabei zeigt die Erfahrung in diesem Bereich und Kenntnisse über Kommunikationsmodelle aus der Ausbildung und einem mehrtägigen Kommunikationstraining, dass diese Kritik häufig nicht an die professionellen Pflegekräfte persönlich gerichtet ist, sondern häufig ganz andere Ursachen hat (demenz-kompakt 2012).
Im ersten Teil dieser Hausarbeit, soll das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun in seinen Kernelementen beschrieben werden. Es werden die Entstehung, die Grundlagen und die Ziele des Kommunikationsmodells beschrieben. Diese Beschreibung wird sich allgemein auf die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger beziehen. Im zweiten Teil dieser Hausarbeit wird das Kommunikationsmodell in den Kontext der Thematik pflegender Angehöriger demenziell erkrankter Menschen gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methode
- 3. Kommunikationsmodell – Friedemann Schulz von Thun
- 3.1. Entstehung des Kommunikationsmodells
- 3.2. Grundlagen einer Nachricht
- 3.3. Die Sachseite
- 3.4. Die Selbstoffenbarungsseite
- 3.5. Die Beziehungsseite
- 3.6. Die Appellseite
- 3.7. Das vier Ohren Modell
- 3.7.1. Das Sach-Ohr
- 3.7.2. Das Beziehungs-Ohr
- 3.7.3. Das Selbstoffenbarungs-Ohr
- 3.7.4. Das Appell-Ohr
- 3.8. Der Empfang einer Nachricht
- 3.9. Interaktion
- 4. Die Anwendung des Kommunikationsmodells in der Praxis
- 4.1. Fallbeispiel
- 4.2. Pflegende Angehöriger demenziell erkrankter Menschen
- 4.3. Anwendung des Kommunikationsmodells im Umgang mit pflegenden Angehörigen demenziell erkrankten Menschen in der ambulanten Pflege, am Beispiel des Fallbeispiels
- 4.4. Ziele für die Anwendung des Kommunikationsmodells im Umgang mit pflegenden Angehörigen demenziell erkrankten Menschen für die Pflege
- 5. Zusammenfassung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun im Kontext der Kommunikation zwischen professionellen Pflegekräften und Angehörigen demenziell erkrankter Menschen. Ziel ist es, die Herausforderungen der Kommunikation in dieser Situation zu beleuchten und aufzuzeigen, wie das Kommunikationsmodell zur Verbesserung der Interaktion beitragen kann.
- Das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun und seine Kernelemente
- Belastungen pflegender Angehöriger demenziell erkrankter Menschen
- Gestörte Kommunikation zwischen pflegenden Angehörigen und professionellen Pflegekräften
- Anwendung des Kommunikationsmodells zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen
- Verbesserung der Kommunikation und des Umgangs in der Pflegepraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen der Demenzerkrankung für Betroffene und Angehörige, insbesondere die hohe Belastung pflegender Angehöriger. Sie führt in die Thematik ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun im Umgang mit pflegenden Angehörigen demenziell erkrankter Menschen und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Angehörigen und professionellen Pflegekräften. Die Einleitung stellt die hohe Anzahl an Demenzkranken in Deutschland heraus und betont die Bedeutung der häuslichen Pflege und die damit verbundenen Belastungen. Sie begründet die Notwendigkeit des Verständnisses von Kommunikationsmodellen zur Bewältigung dieser Herausforderungen.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Hausarbeit, welche auf Literaturrecherche basiert. Es wird die Schwierigkeit, relevante Literatur zum Thema Kommunikation zwischen pflegenden Angehörigen und professionellen Pflegekräften zu finden, thematisiert. Die Arbeit stützt sich daher teilweise auf Praxiserfahrungen und eine nicht-wissenschaftliche Webseite, die im Literaturverzeichnis aufgeführt ist. Das Kapitel erläutert die Fokussierung auf Kernelemente des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun aufgrund des Umfangs der Arbeit und verzichtet auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Demenzerkrankung selbst, konzentriert sich stattdessen auf die Belastungen der pflegenden Angehörigen.
3. Kommunikationsmodell – Friedemann Schulz von Thun: Dieses Kapitel widmet sich der Erläuterung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun. Es beschreibt die Entstehung des Modells, ausgehend von einem Forschungsprojekt zur verständlichen Informationsvermittlung. Die zentralen Elemente – die vier Seiten einer Nachricht (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellseite) – werden eingeführt und kurz erläutert, um als Grundlage für die spätere Anwendung im Kontext der Pflege zu dienen. Das Kapitel betont die Bedeutung des Feedbacks und den Unterschied zwischen expliziten und impliziten Botschaften, sowie die Rolle der nonverbalen Kommunikation.
4. Die Anwendung des Kommunikationsmodells in der Praxis: Dieses Kapitel wendet das Kommunikationsmodell auf die Situation pflegender Angehöriger demenziell erkrankter Menschen an. Es analysiert die Belastungen der pflegenden Angehörigen und wie diese zu Kommunikationsstörungen zwischen Angehörigen und professionellen Pflegekräften führen können. Anhand eines Fallbeispiels wird die praktische Anwendung des Kommunikationsmodells illustriert und Möglichkeiten aufgezeigt, wie professionelle Pflegekräfte durch Anwendung des Modells Kommunikationsstörungen vermeiden können und die Kommunikation verbessern können. Die einzelnen Unterkapitel (4.1 - 4.4) befassen sich mit konkreten Aspekten der Anwendung und der Zielsetzung einer verbesserten Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun im Umgang mit pflegenden Angehörigen demenziell erkrankter Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun in der Kommunikation zwischen professionellen Pflegekräften und Angehörigen demenziell erkrankter Menschen. Ziel ist es, Herausforderungen in dieser Kommunikation zu beleuchten und aufzuzeigen, wie das Modell zu Verbesserungen beitragen kann.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun (inkl. der vier Seiten einer Nachricht), die Belastungen pflegender Angehöriger, gestörte Kommunikation zwischen Angehörigen und Pflegekräften, die Anwendung des Modells zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen und die Verbesserung der Kommunikation in der Pflegepraxis.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Methode, Erläuterung des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun, Anwendung des Modells in der Praxis (inkl. Fallbeispiel) und Zusammenfassung/Diskussion. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht der einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Hausarbeit basiert auf Literaturrecherche. Aufgrund von Schwierigkeiten, ausreichend relevante Literatur zum Thema zu finden, werden teilweise Praxiserfahrungen und eine nicht-wissenschaftliche Webseite (im Literaturverzeichnis aufgeführt) herangezogen. Die Arbeit konzentriert sich auf Kernelemente des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun.
Wie wird das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun erläutert?
Das Kapitel zum Kommunikationsmodell beschreibt seine Entstehung, die vier Seiten einer Nachricht (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellseite) und betont die Bedeutung von Feedback, expliziten/impliziten Botschaften und nonverbaler Kommunikation.
Wie wird das Kommunikationsmodell in der Praxis angewendet?
Das Kapitel zur praktischen Anwendung analysiert die Belastungen pflegender Angehöriger und wie diese zu Kommunikationsstörungen führen können. Ein Fallbeispiel illustriert die Anwendung des Modells und zeigt Möglichkeiten auf, wie Pflegekräfte Kommunikationsstörungen vermeiden und die Kommunikation verbessern können.
Was sind die Ziele der Anwendung des Kommunikationsmodells in der Pflege?
Die Ziele umfassen die Vermeidung von Kommunikationsstörungen, die Verbesserung der Interaktion zwischen pflegenden Angehörigen und professionellen Pflegekräften und letztlich eine Verbesserung des Umgangs in der Pflegepraxis.
Welche Zielgruppe spricht die Hausarbeit an?
Die Hausarbeit richtet sich an Personen, die sich mit der Kommunikation in der Pflege, insbesondere im Umgang mit Angehörigen demenziell erkrankter Menschen, auseinandersetzen. Dies umfasst professionelle Pflegekräfte, Angehörige und Studierende im Pflegebereich.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Literaturverzeichnis der Hausarbeit enthält die verwendeten Quellen. Zusätzliche Informationen können über eine Recherche zu den im Text genannten Themen (z.B. Demenz, Kommunikationsmodelle, Pflege) gefunden werden.
- Quote paper
- Katharina Daub (Author), 2013, Das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Anwendung bei pflegenden Angehörigen demenzkranker Patienten in der ambulanten Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296363