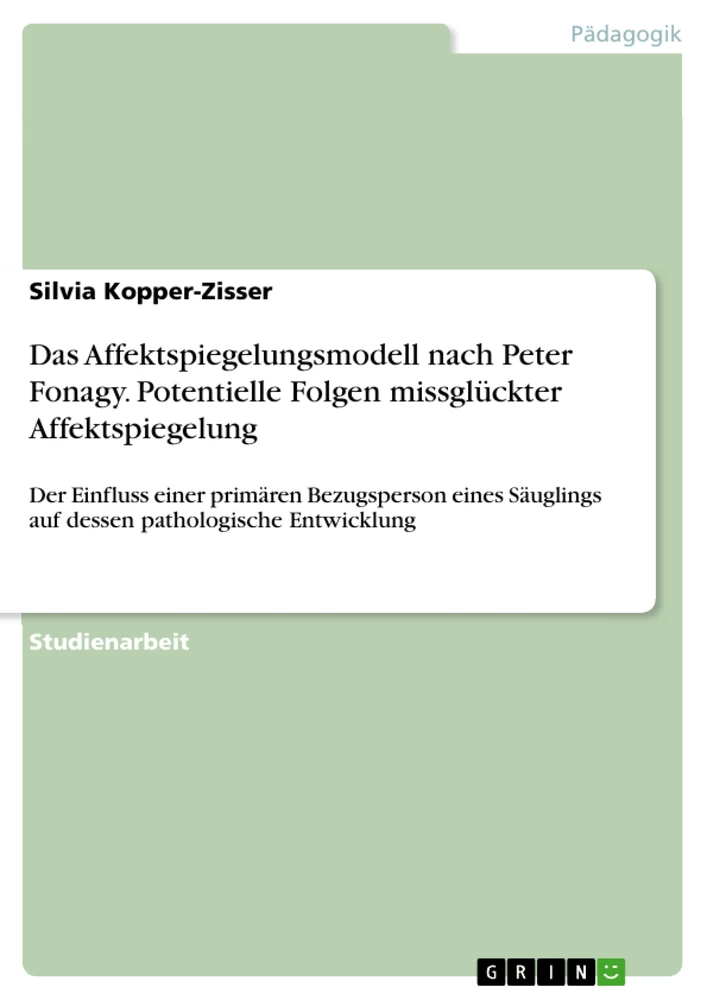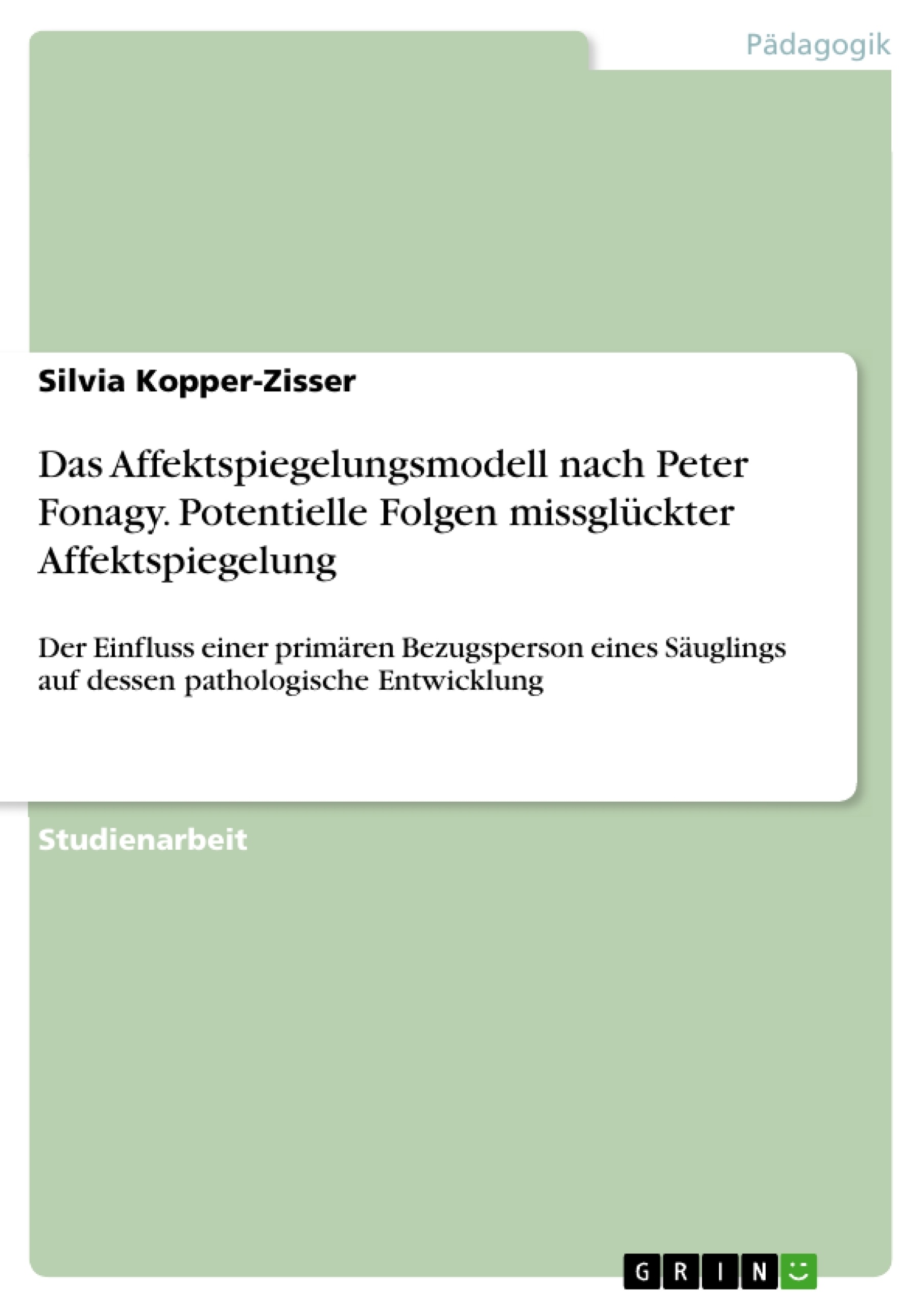Ein be- und anerkanntes Konzept, das Mysterium der Affektspiegelung zu enthüllen, entwickelte die Forschungsgruppe um Peter Fonagy in Form des Konzeptes der Mentalisierung, das die Fähigkeit, das eigene Verhalten oder jenes Anderer durch Zuschreibung mentaler Zustände zu integrieren, beschreibt.
Voraussetzung für die Mentalisierung ist das Verständnis für die Natur des Mentalen, also das Wissen, dass die Realität im Geist nur repräsentiert wird. Die Fähigkeit zu mentalisieren wird in den ersten Lebensmonaten entwickelt. Dafür notwendig ist mindestens eine Bindungsbeziehung mit einer im sozialen Austausch befindlichen Hauptbezugsperson, wodurch das Kind lernt, Affekte zu unterscheiden, zu verstehen und zu kontrollieren.
Durch den Erwerb dieser Fähigkeit kann schlussendlich die Welt als Selbst und Welt erlebt werden. (vgl. Dornes 2004a, 175) Als Voraussetzungen diese Fähigkeit zu erwerben, sind also schon im frühkindlichen Stadium des Säuglings Bezugspersonen notwendig, die seine Affekte spiegeln. Diese Funktion wird zumeist und zu einem überwiegenden Teil von der Mutter übernommen, wodurch ihr eine wichtige Funktion in der psychischen Entwicklung des Säuglings zukommt.
Aus einer missglückten Affektspiegelung resultierende Folgen führen zur anschließenden Forschungsfrage: Wie beeinflussen missglückte mentalisierende Prozesse bezugnehmend auf das Affektspiegelungsmodell von Fonagy et al. (2002) in der Dyade einer weiblichen primären Bezugsperson und einem Säugling im ersten Lebensjahr die pathologische psychische Entwicklung jenes Säuglings?
Es ist anzunehmen, dass Persönlichkeitsstörungen wie die komorbiden dissozialen (APS) (Bateman et al. 2010, Bauers et al 2007) und BorderlinePersönlichkeitsstörungen (BPS) auf unzureichende Affektspiegelung zurückzuführen sind, worauf mehrere Spezialisten der Mentalisierung verweisen (vgl. Dornes 2004a, Brockmann et al. 2010; Köhler, 2004, Bateman et al, 2010).
Im Rahmen dieser Arbeit soll erschlossen werden, welche pathologischen Folgen eine missglückte Affektspiegelung nach sich zieht. Grundlage dazu wird das im Werk „Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst“ vorgestellte soziale Biofeedbackmodell der mütterlichen Affektspiegelung Fonagys und seiner ForscherkollegInnen sein.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Das soziale Biofeedbackmodell der mütterlichen Affektspiegelung
- 2.1. Das Konzept der Mentalisierung Fonagys et al.
- 2.1.1. Die Bindungstheorie nach J. Bowlby
- 2.1.2. Die Affektspiegelung nach G. Gergely
- 2.1.3. Der Kontingenzentdeckungsmechanismus
- 2.2. Die gelungene Affektspiegelung
- 2.3. Die misslungene Affektspiegelung
- 2.3.1. Deviante Stile der Affektspiegelung
- 2.3.2. Bekannte Folgen misslungener Affektspiegelung
- 2.1. Das Konzept der Mentalisierung Fonagys et al.
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit den potentiellen Folgen missglückter Affektspiegelung in der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Sie untersucht, wie die Interaktion zwischen einer primären Bezugsperson und einem Säugling im ersten Lebensjahr die psychische Entwicklung des Kindes beeinflusst.
- Das Konzept der Mentalisierung nach Fonagy et al.
- Die Rolle der Affektspiegelung in der Entwicklung der Mentalisierung.
- Die Auswirkungen von missglückter Affektspiegelung auf die psychische Entwicklung.
- Die Beziehung zwischen missglückter Affektspiegelung und Persönlichkeitsstörungen.
- Die Bedeutung des sozialen Biofeedbackmodells der mütterlichen Affektspiegelung.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Folgen missglückter Affektspiegelung auf die psychische Entwicklung des Säuglings im ersten Lebensjahr vor. Sie führt in das Konzept der Mentalisierung ein und betont die Bedeutung der Affektspiegelung in diesem Kontext.
- Kapitel 2: Das soziale Biofeedbackmodell der mütterlichen Affektspiegelung Dieses Kapitel beschreibt das Konzept der Mentalisierung, einschließlich der Bindungstheorie von John Bowlby und dem Modell der Affektspiegelung von György Gergely. Es beleuchtet den Kontingenzentdeckungsmechanismus und erläutert die Bedeutung der Affektspiegelung für die Entwicklung der Mentalisierung.
- Kapitel 2.1: Das Konzept der Mentalisierung Fonagys et al. Dieser Abschnitt beschreibt das Konzept der Mentalisierung als zentrale Fähigkeit, soziale Realität zu prüfen. Es beleuchtet die Verbindung von "Theory-of-Mind"-Forschung, Bindungsforschung und psychoanalytischen Ansätzen.
- Kapitel 2.1.1: Die Bindungstheorie nach J. Bowlby Dieser Abschnitt erläutert Bowlbys Bindungstheorie und wie die Interaktion zwischen Mutter und Kind die Bindungsqualität beeinflusst. Es beschreibt unterschiedliche Bindungsstile und ihre Auswirkungen auf die sozioemotionale Entwicklung.
- Kapitel 2.1.2: Die Affektspiegelung nach G. Gergely Dieser Abschnitt erklärt die Theorie der Affektspiegelung nach Gergely, welche die Fähigkeit des Säuglings, seine Gefühle zu verstehen, durch die Spiegelung der Mutter beschreibt. Es beleuchtet die Bedeutung dieser Spiegelung für die Entwicklung des Säuglings.
- Kapitel 2.1.3: Der Kontingenzentdeckungsmechanismus Dieser Abschnitt beschreibt den Kontingenzentdeckungsmechanismus, der die Grundlage für die Entwicklung der Mentalisierung bildet. Er erläutert wie das Kind lernt, die Welt als Selbst und Welt zu erleben.
- Kapitel 2.2: Die gelungene Affektspiegelung Dieser Abschnitt beschreibt die gelungene Affektspiegelung und ihre positive Bedeutung für die Entwicklung der Mentalisierung.
- Kapitel 2.3: Die misslungene Affektspiegelung Dieser Abschnitt untersucht die Folgen missglückter Affektspiegelung und beschreibt deviante Stile der Affektspiegelung. Es beleuchtet bekannte Folgen wie die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Mentalisierung, Affektspiegelung, Bindungstheorie, soziale Biofeedback, frühkindliche Entwicklung, psychische Entwicklung, Persönlichkeitsstörungen, Bowlby, Gergely, Fonagy.
- Quote paper
- BA Silvia Kopper-Zisser (Author), 2013, Das Affektspiegelungsmodell nach Peter Fonagy. Potentielle Folgen missglückter Affektspiegelung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296278