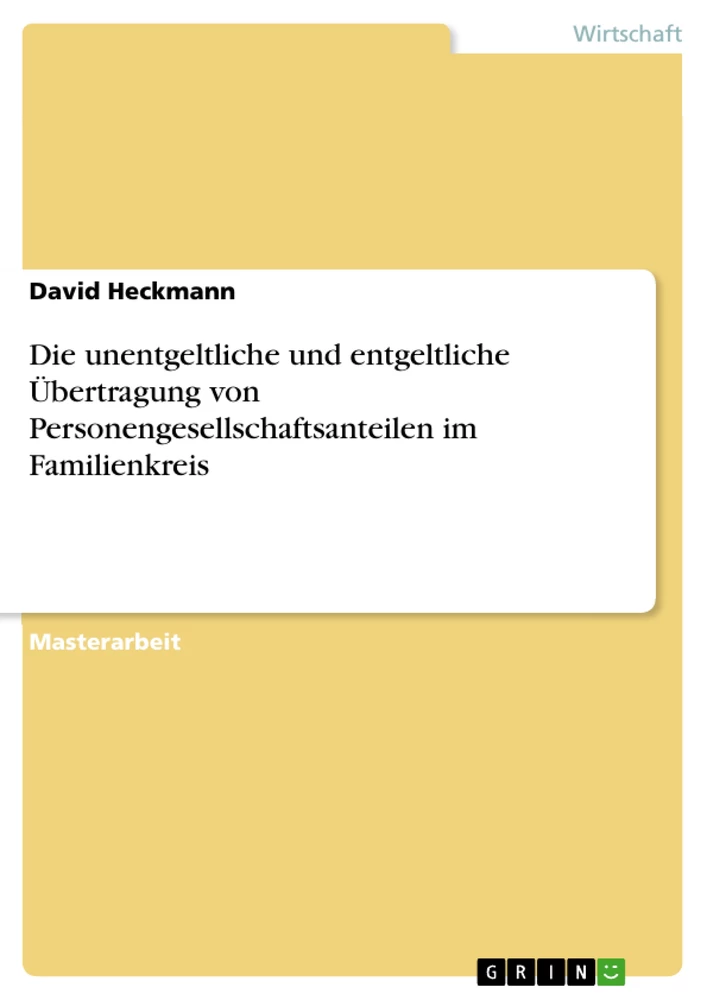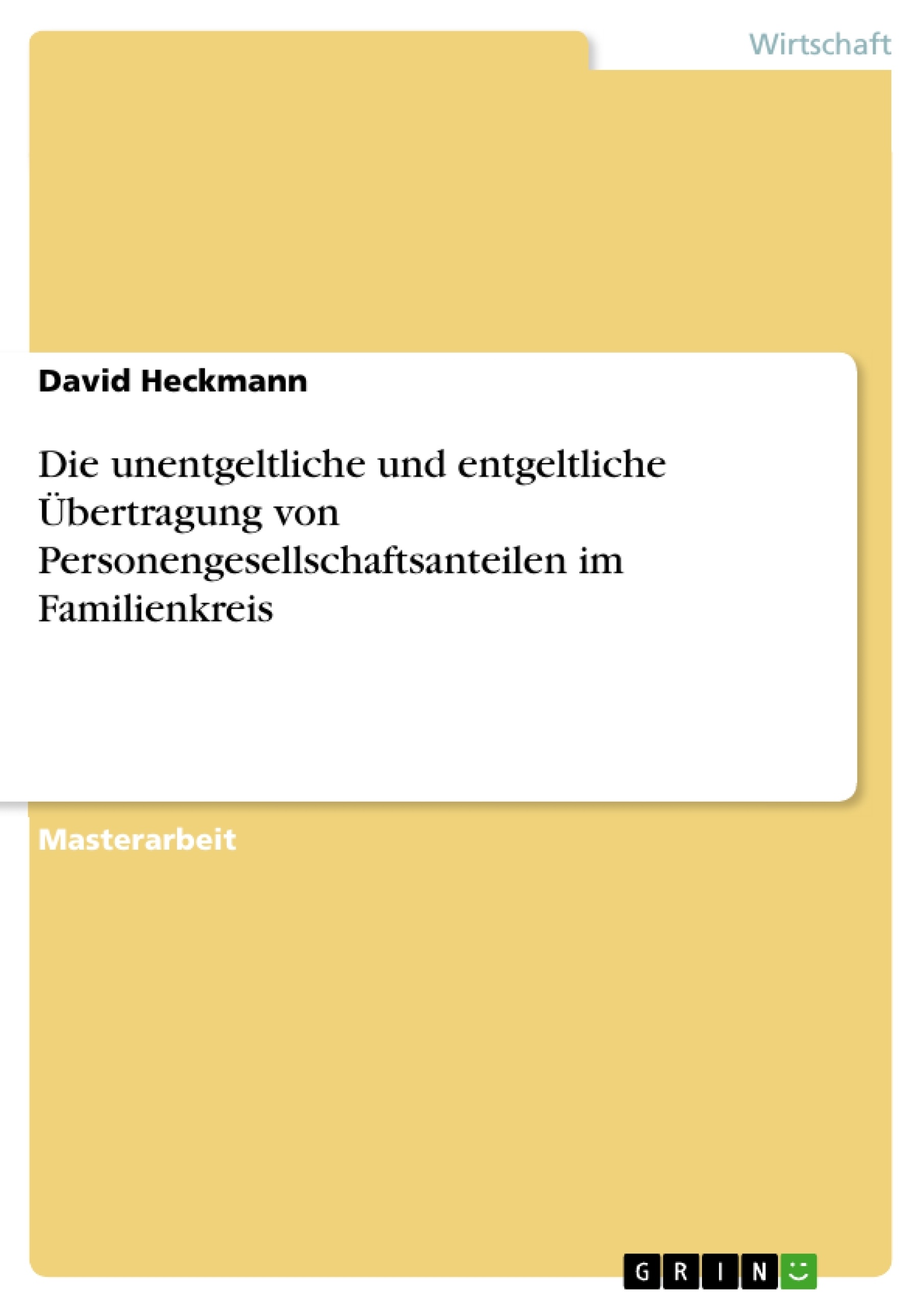Die Unternehmensnachfolge im Familienkreis ist eines der relevantesten Themen des deutschen Mittelstandes. Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn ermittelte im Jahr 2010 einen Unternehmensbestand, mit Sitz oder Geschäftsleitung in Deutschland, in Höhe von (i.H.v.) 3,7 Millionen Unternehmen. Von diesen Unternehmen sind knapp 95 v.H., also rund 3,5 Millionen, Familienunternehmen. Das „IfM Bonn“ differenziert im Weiteren zwischen Unternehmen, die einen Jahresgewinn von weniger als 49.512,- Euro erzielt haben und jenen, deren Gewinn über diesem Wert liegt, da lediglich die gewinnträchtigen Unternehmen als zur Übertragung würdig eingestuft werden. Die Anzahl dieser übertragungswürdigen Unternehmen beläuft sich auf 730.000 Unternehmen; bestehend aus Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Von diesen stehen 110.000 Unternehmen im betrachteten Fünf-Jahres-Zeitraum, datiert auf die Jahre 2010 bis 2014, zur Übergabe an. 80 v.H. dieser Nachfolgen sind altersbedingt. Da krankheits- oder durch ein unerwartetes Ableben bedingte Nachfolgen im Gegensatz zu altersbedingten Nachfolgen nicht planbar sind, sollte die Unternehmensnachfolge so früh wie möglich vertraglich geregelt werden. Diese wissenschaftliche Untersuchung beschränkt sich auf die ertragssteuerlichen, erb- und schenkungssteuerlichen sowie grunderwerbssteuerlichen Folgen einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung von Personengesellschaftsanteilen im Familienkreis. Die entgeltliche Übertragung ist für den veräußernden Mitunternehmer in § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt. Der Vorzug einer entgeltlichen Übertragung beruht auf der Sicherstellung der Altersversorgung des bisherigen Mitunternehmers, die durch eine Veräußerung gegen Einmalzahlung oder aber auch gegen wiederkehrende Versorgungszahlungen sicher gestellt werden kann. Die unentgeltliche Übertragung, die typischerweise aufgrund der Übertragung ohne Gegenleistung (Schenkung) nur für die familiäre Nachfolge in Personengesellschaften genutzt wird, ist in § 6 Abs. 3 EStG normiert. Die Übertragung von Mitunternehmeranteilen bei Personengesellschaften ist bei einer entgeltlichen Übertragung ggf. durch einen Freibetrag und eine Tarifermäßigung begünstigt. Als problematisch erweist sich die Klassifizierung von eventuell vorhandenem Sonderbetriebsvermögen als funktional wesentliche oder unwesentliche Betriebsgrundlage sowie die unterquotale oder überquotale Übertragung von [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Unternehmensnachfolge in Deutschland
- Der mitunternehmerische Personengesellschaftsanteil
- Die Tatbestandsmerkmale der ent- und unentgeltlichen Übertragung
- Die Steuerhistorische Auslegung des § 6 Abs. 3 EStG
- Der Begriff der wesentlichen Betriebsgrundlage
- Unentgeltlichkeit, Teilentgeltlichkeit und Entgeltlichkeit
- Ertragssteuerliche Folgen der Übertragung von Mitunternehmeranteilen
- Die unentgeltliche Übertragung
- Die Übertragung mit Sonderbetriebsvermögen
- Die Teilanteilsübertragung
- Die teilentgeltliche Übertragung
- Die entgeltliche Übertragung
- Ertragssteuerliche Folgen für den Übertragenden
- Ertragssteuerliche Folgen für den Übernehmer
- Die Nachfolgegestaltung im Übertragungsfall
- Die gesetzliche und die vorweggenommene Erbfolge
- Die einfache und qualifizierte Nachfolgeklausel
- Der Nießbrauchsvorbehalt
- Wiederkehrende Versorgungsleistungen
- Das Ausgliederungsmodell GmbH & Co. KG
- Das Zurückbehalten eines Mini-Anteils am Gesamthandvermögen
- Die erbschafts- und grunderwerbssteuerlichen Übertragungsfolgen
- Die Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Die Grunderwerbssteuer
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die steuerlichen Folgen der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen im Familienkreis, sowohl unentgeltlich als auch entgeltlich. Ziel ist es, die komplexen ertragssteuerlichen, erbschaftsteuerlichen und grunderwerbssteuerlichen Aspekte dieser Übertragungen umfassend darzustellen und zu analysieren.
- Ertragssteuerliche Auswirkungen der unentgeltlichen, teilentgeltlichen und entgeltlichen Übertragung von Mitunternehmeranteilen
- Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge bei Übertragung von Personengesellschaftsanteilen
- Erbschaftsteuerliche und grunderwerbssteuerliche Folgen der Anteilsübertragungen
- Relevanz der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
- Zusammenhang zwischen der Gestaltung der Unternehmensnachfolge und den steuerlichen Konsequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unternehmensnachfolge in Deutschland: Dieses Kapitel liefert einen einführenden Überblick in die Thematik der Unternehmensnachfolge in Deutschland. Es beleuchtet die Bedeutung der Nachfolgeplanung und die Herausforderungen, die mit der Übertragung von Unternehmen im Familienkreis verbunden sind. Der Fokus liegt auf den besonderen Aspekten der Personengesellschaften und der Notwendigkeit einer frühzeitigen und umfassenden steuerlichen Beratung. Die Bedeutung verschiedener Modelle zur Nachfolgeplanung, z.B. die vorweggenommene Erbfolge oder die Gründung einer GmbH & Co. KG, werden angerissen. Der Kontext wird durch die Betrachtung der aktuellen wirtschaftlichen und demografischen Situation in Deutschland geschaffen, die die Notwendigkeit einer fundierten Unternehmensnachfolgeplanung unterstreicht.
Der mitunternehmerische Personengesellschaftsanteil: In diesem Kapitel wird der mitunternehmerische Personengesellschaftsanteil definiert und seine Besonderheiten im Hinblick auf die Übertragung im Familienkreis herausgestellt. Es werden die Tatbestandsmerkmale der entgeltlichen und unentgeltlichen Übertragung detailliert analysiert, insbesondere die steuerrechtliche Relevanz der Unentgeltlichkeit, Teilentgeltlichkeit und Entgeltlichkeit. Der Begriff der „wesentlichen Betriebsgrundlage“ wird im Kontext der Übertragung erläutert und dessen Bedeutung für die steuerliche Beurteilung hervorgehoben. Die Kapitel analysiert auch die steuerhistorische Auslegung des § 6 Abs. 3 EStG und seine Auswirkungen auf die Praxis der Anteilsübertragungen.
Ertragssteuerliche Folgen der Übertragung von Mitunternehmeranteilen: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den ertragssteuerlichen Konsequenzen der Übertragung von Mitunternehmeranteilen. Es differenziert zwischen unentgeltlichen, teilentgeltlichen und entgeltlichen Übertragungen und untersucht die Auswirkungen auf sowohl den Übertragenden als auch den Übernehmer. Die Besonderheiten der Übertragung mit Sonderbetriebsvermögen und die Teilanteilsübertragung werden detailliert dargestellt und mit Beispielen illustriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung und Interpretation der relevanten steuerlichen Vorschriften und der Berücksichtigung der Rechtsprechung des BFH. Die Analyse zeigt die Komplexität der ertragssteuerlichen Auswirkungen und die Notwendigkeit einer professionellen Beratung.
Die Nachfolgegestaltung im Übertragungsfall: Dieses Kapitel konzentriert sich auf verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge im Zusammenhang mit der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen. Es werden verschiedene Modelle wie die gesetzliche und vorweggenommene Erbfolge, einfache und qualifizierte Nachfolgeklauseln, der Nießbrauchsvorbehalt, wiederkehrende Versorgungsleistungen, das Ausgliederungsmodell GmbH & Co. KG und das Zurückbehalten eines Mini-Anteils am Gesamthandvermögen detailliert beschrieben und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf den steuerlichen Implikationen jeder einzelnen Gestaltungsoption und deren Auswirkungen auf den Übertragenden und den Übernehmer. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle im Kontext der individuellen Bedürfnisse der Beteiligten gewürdigt.
Die erbschafts- und grunderwerbssteuerlichen Übertragungsfolgen: Dieses Kapitel analysiert die erbschafts- und grunderwerbssteuerlichen Auswirkungen der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen. Es werden die Besonderheiten der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie der Grunderwerbssteuer im Kontext der Unternehmensnachfolge beleuchtet. Die komplexen Interaktionen zwischen den verschiedenen Steuerarten werden im Detail erläutert und die Bedeutung der jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten für die Steuerminimierung herausgestellt. Der Einfluss verschiedener Faktoren, wie z.B. der Wert des übertragenen Anteils und die familiäre Beziehung zwischen Übertragenden und Übernehmer, auf die Höhe der Steuerlast wird umfassend diskutiert.
Schlüsselwörter
Personengesellschaftsanteile, Unternehmensnachfolge, Familienkreis, Ertragssteuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerbssteuer, unentgeltliche Übertragung, entgeltliche Übertragung, teilentgeltliche Übertragung, Steuergestaltung, BFH-Rechtsprechung, § 6 Abs. 3 EStG, wesentliche Betriebsgrundlage, Nachfolgeklausel, Nießbrauch, GmbH & Co. KG.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Steuerliche Folgen der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen im Familienkreis
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht umfassend die steuerlichen Folgen der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen innerhalb der Familie, sowohl bei unentgeltlicher als auch bei entgeltlicher Übertragung. Dabei werden die ertragssteuerlichen, erbschaftsteuerlichen und grunderwerbssteuerlichen Aspekte detailliert analysiert.
Welche Steuerarten werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit behandelt die Ertragssteuer (EStG), die Erbschaftsteuer und die Grunderwerbssteuer im Kontext der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen.
Welche Arten der Übertragung werden unterschieden?
Es werden die unentgeltliche, die teilentgeltliche und die entgeltliche Übertragung von Mitunternehmeranteilen unterschieden und jeweils die steuerlichen Konsequenzen analysiert.
Welche Bedeutung hat der Begriff „wesentliche Betriebsgrundlage“?
Der Begriff „wesentliche Betriebsgrundlage“ spielt eine entscheidende Rolle bei der steuerlichen Beurteilung der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen. Seine Definition und Auswirkungen auf die Steuerpflicht werden in der Arbeit detailliert erläutert.
Welche Rolle spielt § 6 Abs. 3 EStG?
Die steuerhistorische Auslegung von § 6 Abs. 3 EStG und seine Auswirkungen auf die Praxis der Anteilsübertragungen werden in der Arbeit untersucht.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge, darunter die gesetzliche und vorweggenommene Erbfolge, einfache und qualifizierte Nachfolgeklauseln, der Nießbrauchsvorbehalt, wiederkehrende Versorgungsleistungen, das Ausgliederungsmodell GmbH & Co. KG und das Zurückbehalten eines Mini-Anteils am Gesamthandvermögen.
Wie werden die erbschafts- und grunderwerbssteuerlichen Folgen behandelt?
Die Arbeit analysiert die komplexen Interaktionen zwischen Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer und Grunderwerbssteuer im Kontext der Unternehmensnachfolge und zeigt auf, wie verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten die Steuerlast beeinflussen können.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)?
Die Rechtsprechung des BFH spielt eine wichtige Rolle und wird in der Arbeit berücksichtigt, um die Anwendung und Interpretation der relevanten steuerlichen Vorschriften zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind unter anderem: Personengesellschaftsanteile, Unternehmensnachfolge, Familienkreis, Ertragssteuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerbssteuer, unentgeltliche Übertragung, entgeltliche Übertragung, teilentgeltliche Übertragung, Steuergestaltung, BFH-Rechtsprechung, § 6 Abs. 3 EStG, wesentliche Betriebsgrundlage, Nachfolgeklausel, Nießbrauch, GmbH & Co. KG.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die komplexen steuerlichen Aspekte der Übertragung von Personengesellschaftsanteilen im Familienkreis umfassend darzustellen und zu analysieren, um eine fundierte Grundlage für die steuerliche Beratung in diesem Bereich zu schaffen.
- Quote paper
- David Heckmann (Author), 2014, Die unentgeltliche und entgeltliche Übertragung von Personengesellschaftsanteilen im Familienkreis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295952