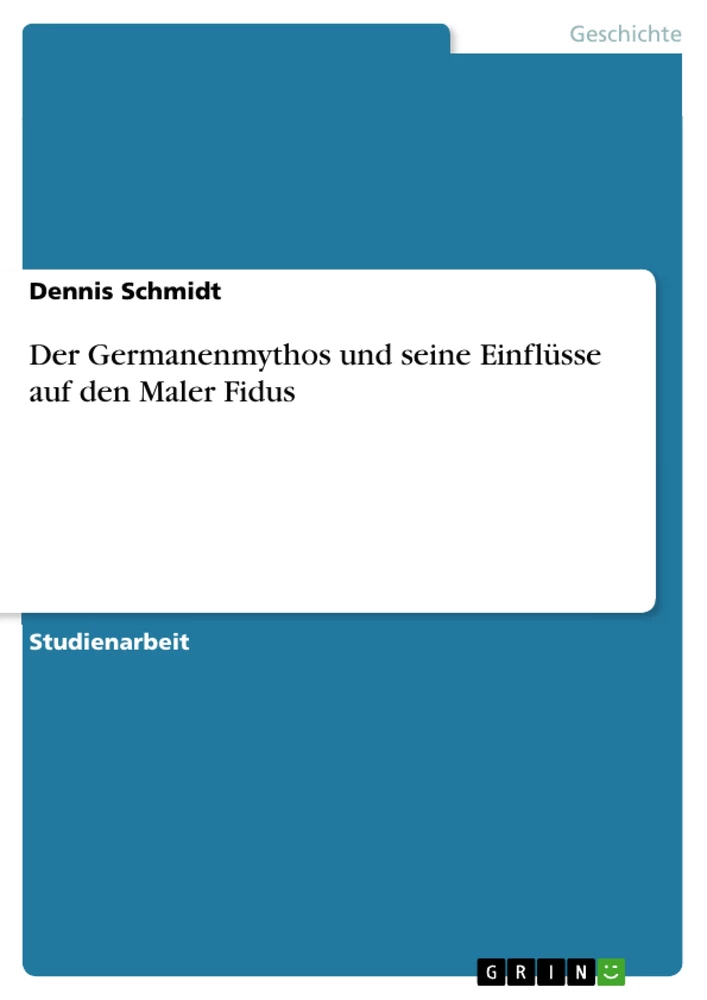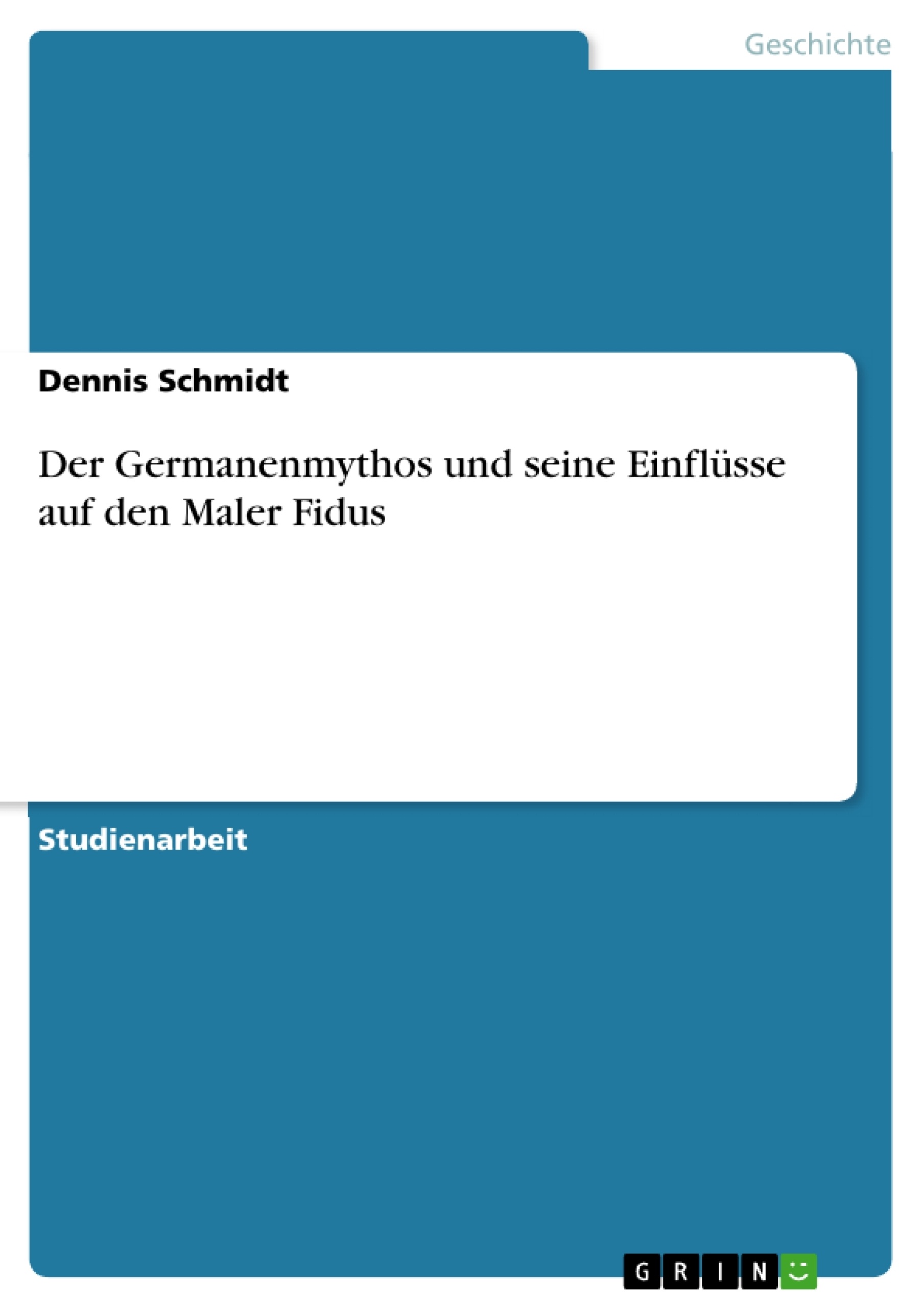Kürzlich habe ich mir die erste Folge der sechsteiligen ZDF-Dokumentation Deutschland-Saga angesehen, die anlässlich des 25. Jubiläums des Mauerfalls produziert wurde und seit Herbst 2014 in regelmäßigen Abständen im Fernsehen ausgestrahlt wird. Im ersten Teil der Doku-Reihe soll der australische Historiker Christopher Clark den Zuschauer unter dem Motto „Woher wir kommen – Die Frage nach unseren Ursprüngen“ durch die Geschichte Deutschlands führen. Dabei kommt er auch auf die Zeit um Christi Geburt zu sprechen – jener Epoche, die heutzutage sehr vereinfacht als die Zeit der Germanen bezeichnet wird. Clark spricht in dieser Episode von den Germanen als Ahnen der Deutschen. Doch wer oder was waren die Germanen?
Etymologisch gesehen ist die Herkunft des Wortes Germane ungeklärt. Das erste Mal findet sich das lateinische Wort germani in der Schrift De Bello Gallico von Julius Cäsar und bezeichnet den übergreifenden Namen der deutschen Völker.2 Für die Römer waren die Germanen also Volksgruppen, die nördlich der Alpen und östlich des Rheins lebten. Sie hatten zwar Kenntnis von unterschiedlichen Stämmen, die dort lebten – zum Beispiel Goten, Sueben oder Teutonen – dachten diese jedoch als einheitliche ethnische Gruppe.3 Wie kam es also dazu, dass gerade die Germanen als Vorfahren der Deutschen gesehen werden, wie in der ZDF-Dokumentation, wenn doch germanische Stämme beispielsweise auch im heutigen Holland, in Belgien und in Skandinavien lebten? Und warum werden nicht zum Beispiel die Kelten als das deutsche Urvolk angesehen? Natürlich müsste man sich hier auch fragen, was denn überhaupt „deutsch“ ist und ob es eigentlich möglich ist, dass man einer ethnisch gesehen heterogenen Bevölkerungsgruppe, die sich heute durch den Nationalstaat Deutschland definiert, überhaupt eine altertümliche Volksgruppe als Vorfahren zuweisen kann. Wahrscheinlich nicht. Doch dieses Problem soll und kann in der vorliegenden keine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Germanen - Der Mythos von den Vorfahren der Deutschen
- II.1. Die Entstehung des Germanenkults – Wiederentdeckung von Tacitus' Germania
- II.2. Die Germanenideologie in der Völkischen Bewegung
- II.3. Die Rolle der Germanen in der Ideologie der Nationalsozialisten
- III. Fidus - Künstler und Germanenliebhaber
- III.1. Germanophile Elemente in Leben und Kunstschaffen des Fidus
- III.2. Analyse des Baltenkampfs und Zurück zur Natur - ein Menschenpaar
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stilisierung der Germanen als Vorfahren der Deutschen und deren Einfluss auf den Maler Fidus. Ziel ist es, die Entstehung des Germanenkults nachzuvollziehen und dessen Rezeption in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus aufzuzeigen. Die Rolle Fidus' als "Germanenschwärmer" wird anhand seines Lebens und Werkes analysiert.
- Entstehung des Germanenkults und die Rolle von Tacitus' Germania
- Die Germanenideologie in der Völkischen Bewegung
- Die Instrumentalisierung des Germanenmythos durch die Nationalsozialisten
- Fidus' Germanophilie und deren Reflexion in seinen Bildern
- Analyse von Fidus' Werken im Kontext des Germanenmythos
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit der Betrachtung einer ZDF-Dokumentation, die die Germanen als Ahnen der Deutschen darstellt. Dies wirft die Frage auf, wie dieser Mythos entstand und welchen Einfluss er hatte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entstehung des Germanenkults, dessen Rolle in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus, und schließlich auf die Germanophilie des Malers Fidus, dessen Werk exemplarisch analysiert wird. Die komplexe Frage nach der Definition von „Deutsch“ und der Zuweisung einer altertümlichen Volksgruppe als Vorfahren einer heterogenen Bevölkerungsgruppe wird angesprochen, aber als Thema der vorliegenden Arbeit ausgeklammert.
II. Die Germanen – Der Mythos von den Vorfahren der Deutschen: Dieses Kapitel erörtert die Konstruktion der Germanen als Vorfahren der Deutschen. Es beginnt mit der Entstehung des Germanenkults, der maßgeblich durch die Germania des Tacitus beeinflusst wurde. Tacitus' Werk, obwohl möglicherweise auf ungenauen Quellen basierend, beschreibt die Germanen mit positiven Eigenschaften wie Freiheit, Sittlichkeit und Tapferkeit, im Kontrast zur dekadenten römischen Gesellschaft. Diese positive Darstellung wurde später von völkischen und nationalsozialistischen Ideologien missbraucht und auf die Deutschen projiziert. Das Kapitel beleuchtet die Weiterentwicklung dieses Mythos im Kontext der völkischen Bewegung und schließlich seine pervertierte Aneignung und Glorifizierung durch die Nationalsozialisten.
II.1. Die Entstehung des Germanenkults - Wiederentdeckung von Tacitus' Germania: Dieser Unterabschnitt konzentriert sich auf die Germania des Tacitus und deren Bedeutung für die Entwicklung des Germanenmythos. Tacitus' Beschreibung der Germanen als freiheitsliebende, tugendhafte und kriegerische Völker wurde von späteren Generationen aufgegriffen und ideologisch uminterpretiert. Die Arbeit beleuchtet die späte Wiederentdeckung der Germania während der Renaissance und deren Einfluss auf die Herausbildung eines deutschen Nationalcharakters im Kontext des Heiligen Römischen Reiches. Die Arbeit betont den selektiven Umgang mit Tacitus' Werk, der die positiven Aspekte hervorhob und die negativen Aspekte ignorierte, um ein gewünschtes Bild zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Germanenmythos, Tacitus' Germania, Völkische Bewegung, Nationalsozialismus, Fidus, Germanophilie, Kunst, Ideologie, Nationalcharakter, Geschichtsdeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Stilisierung der Germanen als Vorfahren der Deutschen und deren Einfluss auf den Maler Fidus
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Stilisierung der Germanen als Vorfahren der Deutschen und deren Einfluss auf den Maler Fidus. Sie analysiert die Entstehung des Germanenkults, seine Rezeption in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus, und die Rolle Fidus' als "Germanenschwärmer".
Welche Aspekte der Germanenideologie werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des Germanenkults, beginnend mit der "Germania" von Tacitus und deren Einfluss. Sie untersucht die instrumentalisierende Verwendung des Germanenmythos durch die völkische Bewegung und den Nationalsozialismus, sowie die Projektion von idealisierten Eigenschaften der Germanen auf die deutsche Identität.
Welche Rolle spielt Fidus in dieser Arbeit?
Fidus dient als Fallbeispiel. Die Arbeit analysiert seine Germanophilie und deren Reflexion in seinem Leben und künstlerischen Werk, insbesondere in Bezug auf den Germanenmythos. Seine Werke werden im Kontext des Mythos interpretiert.
Wie wird Tacitus' "Germania" in der Arbeit behandelt?
Tacitus' "Germania" wird als zentrale Quelle für die Entstehung des Germanenkults betrachtet. Die Arbeit analysiert, wie Tacitus' Beschreibung der Germanen (auch wenn möglicherweise ungenau) von späteren Ideologien aufgegriffen und selektiv interpretiert wurde, um ein bestimmtes Bild der Germanen und der Deutschen zu schaffen.
Welche historischen Bewegungen werden im Zusammenhang mit dem Germanenmythos untersucht?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Germanenmythos in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus. Es wird gezeigt, wie der Mythos von beiden Bewegungen missbraucht und instrumentalisiert wurde, um politische Ziele zu verfolgen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Mythos der Germanen als Vorfahren der Deutschen (mit Unterkapiteln zur Entstehung des Kults und dessen Rolle in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus), ein Kapitel über Fidus und seine Germanophilie (mit einer Analyse seiner Werke), und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Germanenmythos, Tacitus' Germania, Völkische Bewegung, Nationalsozialismus, Fidus, Germanophilie, Kunst, Ideologie, Nationalcharakter, Geschichtsdeutung.
Welche Frage wird in der Einleitung gestellt und wie wird damit umgegangen?
Die Einleitung wirft die Frage auf, wie der Mythos der Germanen als Ahnen der Deutschen entstand und welchen Einfluss er hatte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entstehung des Kults, seine Rolle in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus, und die Germanophilie des Malers Fidus. Die komplexe Frage nach der Definition von „Deutsch“ wird angesprochen, aber als Thema der vorliegenden Arbeit ausgeklammert.
Wie wird das Kapitel über Fidus aufgebaut?
Das Kapitel über Fidus untersucht die germanophilen Elemente in seinem Leben und künstlerischen Schaffen. Es beinhaltet eine detaillierte Analyse seines Werkes "Baltenkampf" und "Zurück zur Natur - ein Menschenpaar" im Kontext des Germanenmythos.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits ist nicht im bereitgestellten Text enthalten und kann daher nicht zusammengefasst werden.)
- Quote paper
- Dennis Schmidt (Author), 2015, Der Germanenmythos und seine Einflüsse auf den Maler Fidus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295918