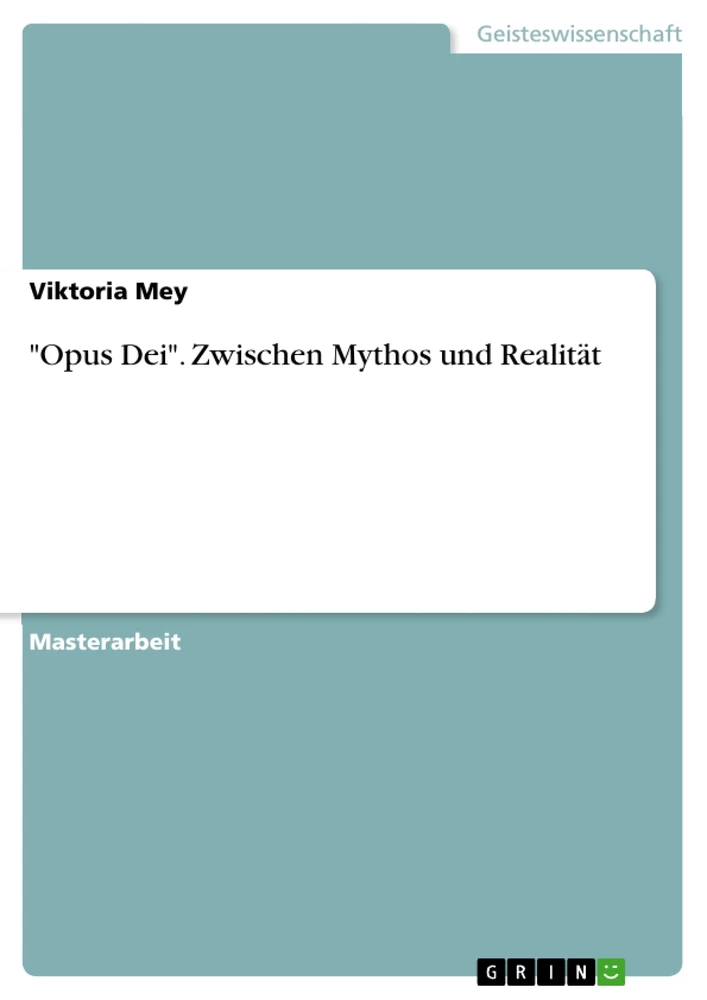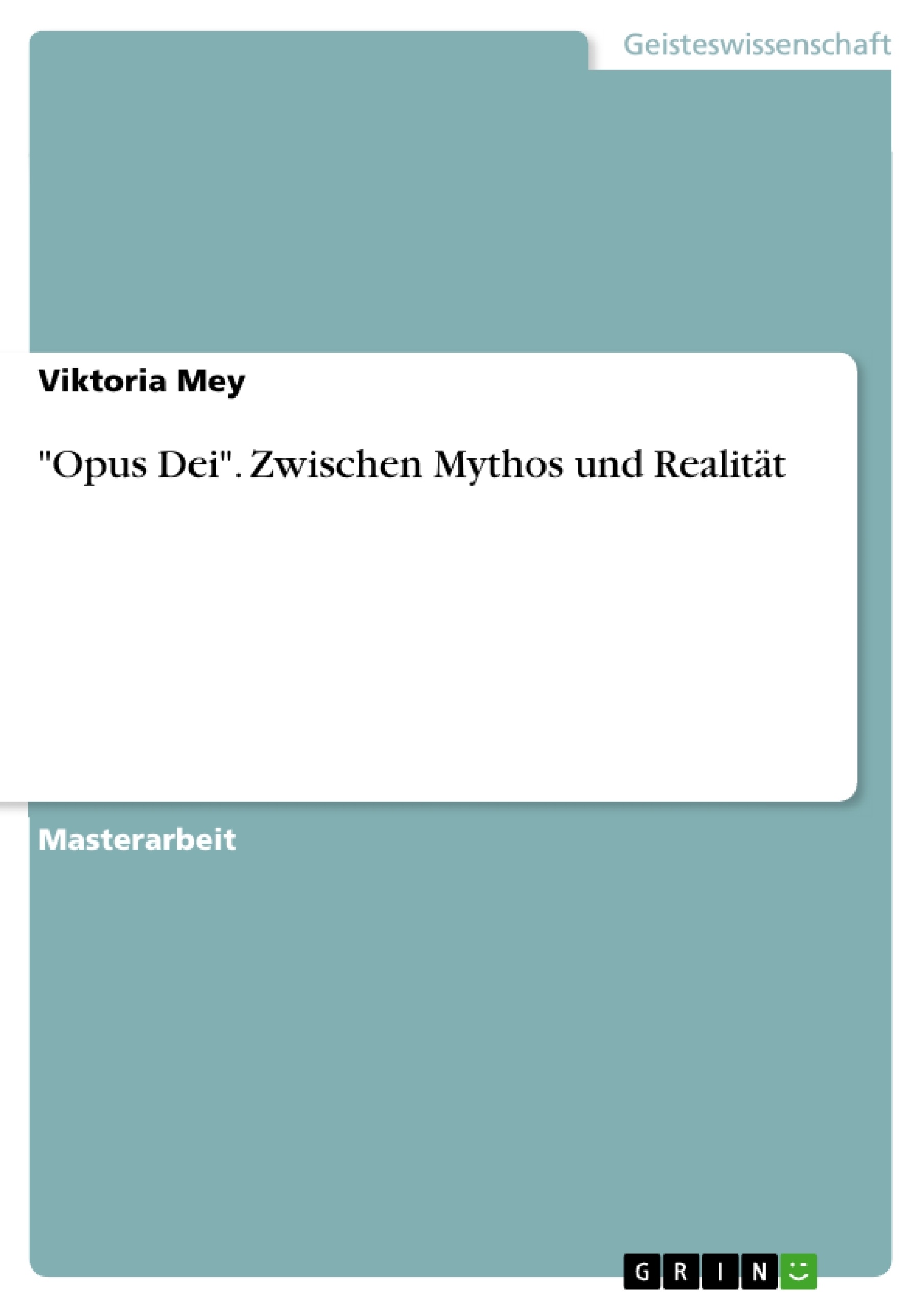Die meisten haben sicher schon das eine oder andere über das "Opus Dei" gehört. Aber was entspricht davon wirklich der Wahrheit? Schließlich ist uns allen vermutlich bewusst, dass das „Werk“, wie es von seinen Mitgliedern genannt wird, oft als sagenumwobener Geheimbund dargestellt wird. Worum handelt es sich beim "Opus Dei" also eigentlich? Ist es eine Sekte? Existieren für die zahlreichen Mythen und Legenden über das „Werk“ (historische) Belege? Was kann man sich unter dem Begriff „Personalprälatur“, der Rechtsform des "Opus
Dei", vorstellen? Wie wird man Mitglied und ist es möglich, das „Werk“ jemals wieder zu verlassen? Wo findet man das "Opus Dei" und was macht das Leben der Mitglieder aus? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der vom Gründer entworfenen Kurzformel „Heilige deine Arbeit. Heilige dich in deiner Arbeit.
Heilige andere durch deine Arbeit.“ für den Alltag der Anhänger
des "Opus Dei"? Was hat es mit dem Symbol des „Werks“, bestehend aus einem Kreuz in einem Kreis, auf sich?
All diese Fragen stellt man sich, wenn das
Gespräch auf das "Opus Dei" fällt, doch meist sind die Darstellungen der Personalprälatur in der Öffentlichkeit so legendenlastig oder aber so kritisch und von Vorwürfen determiniert, dass ein auf Tatsachen beruhendes Urteil schwer
fällt.
In meiner Ausarbeitung unternehme ich einen ersten Schritt, das "Opus Dei" nicht nur nach seinem von der Öffentlichkeit
gestalteten Bild zu beurteilen. Stattdessen habe ich es mir zum Ziel gesetzt, vielschichtige Ansichten zu studieren, um am Ende zu einem Urteil zu gelangen, das auf belastbaren Recherchen beruht. Hierfür befasse ich mich mit der Gründung des "Opus Dei" und in diesem Zusammenhang mit seinem Gründer,
Josemaria Escriva.
Des Weiteren werde ich die Organisationsstruktur des
„Werks“ sowie die Rechtsform der „Personalprälatur“ beleuchten und mich mit dem „Lebensplan“ beziehungsweise den „Normen“ der Mitglieder des "Opus Dei" befassen.
Im Anschluss daran widme ich mich der Mitgliedschaft in der
Personalprälatur. Hierbei gehe ich einerseits auf die Aufnahme als Mitglied in die Prälatur sowie die unterschiedlichen Kategorien einer Mitgliedschaft im "Opus Dei", andererseits jedoch auch auf den Austritt aus der Personalprälatur ein. Zudem gilt es im weiteren Verlauf der Arbeit die Ideen, die hinter dem "Opus Dei" stehen, zu beleuchten und auf seine weltweite Verbreitung einzugehen. Auch die Rolle des "Opus Dei" während des Zweiten Vatikanischen Konzils .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gründung
- 3. Struktur
- 3.1 Organisationsstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, das Opus Dei anhand vielschichtiger Ansichten und belastbarer Recherchen zu untersuchen und ein unvoreingenommenes Urteil zu bilden. Sie geht über das öffentliche Bild der Organisation hinaus und beleuchtet verschiedene Aspekte.
- Gründung des Opus Dei und die Rolle Josemaría Escrivás
- Organisationsstruktur und Rechtsform der Personalprälatur
- Mitgliedschaft im Opus Dei: Aufnahme und Austritt
- Ideen und weltweite Verbreitung des Opus Dei
- Mythen und Legenden um das Opus Dei und die öffentliche Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt zahlreiche Fragen zum Opus Dei, von seiner Darstellung als Geheimbund bis hin zu seinen inneren Strukturen und dem Alltag seiner Mitglieder. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der auf einer neutralen und faktenbasierten Betrachtungsweise beruht und diverse Quellen, sowohl von Anhängern als auch Kritikern, heranzieht. Der Bezug zu Dan Browns „Sakrileg“ dient dazu, die Mythenbildung und den damit verbundenen Profit zu beleuchten.
2. Gründung: Dieses Kapitel beschreibt die Gründung des Opus Dei durch Josemaría Escrivá de Balaguer im Jahr 1928. Es schildert seine frühen mystischen Erfahrungen, seinen Weg zum Priestertum und die Herausforderungen bei der Gründung. Es wird detailliert auf die drei Phasen des Aufbaus eingegangen: die anfängliche Gründung, die Aufnahme weiblicher Mitglieder und die Gründung der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz als Reaktion auf Konflikte mit anderen Priestern. Der Fokus liegt auf Escrivás Vision einer Erneuerung der katholischen Kirche durch die Heiligung der Arbeit und die Zusammenfassung von Menschen aus allen Lebensbereichen.
3. Struktur: Das Kapitel befasst sich mit der Organisationsstruktur des Opus Dei. Es beschreibt die von Escrivá selbst als "desorganisierte Organisation" bezeichnete Struktur, die durch organische Vielfalt und minimalistische Leitungsorgane gekennzeichnet ist. Der Abschnitt konzentriert sich auf die Beschreibung der Organisation als ein dynamisches Gebilde, welches sich organisch entwickelt hat und an die Bedürfnisse seiner Gläubigen anpasst.
Schlüsselwörter
Opus Dei, Josemaría Escrivá, Personalprälatur, Heiligung der Arbeit, Organisationsstruktur, Mitgliedschaft, Mythen, Kritik, katholische Kirche, Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Opus Dei
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über das Opus Dei. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text zielt darauf ab, das Opus Dei anhand vielschichtiger Ansichten und belastbarer Recherchen zu untersuchen und ein unvoreingenommenes Urteil zu ermöglichen.
Welche Kapitel sind enthalten?
Der Text umfasst mindestens drei Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Gründung) und Kapitel 3 (Struktur). Die Einleitung stellt Fragen zum Opus Dei und beschreibt den Forschungsansatz. Kapitel 2 behandelt die Gründung des Opus Dei durch Josemaría Escrivá und dessen Entwicklung. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Organisationsstruktur des Opus Dei.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Textes?
Die Arbeit zielt auf eine unvoreingenommene Untersuchung des Opus Dei ab, die über das öffentliche Bild hinausgeht. Die Themenschwerpunkte umfassen die Gründung des Opus Dei und die Rolle Josemaría Escrivás, die Organisationsstruktur und Rechtsform, die Mitgliedschaft (Aufnahme und Austritt), die Ideen und weltweite Verbreitung, sowie Mythen und Legenden um das Opus Dei und die öffentliche Wahrnehmung.
Wie wird die Gründung des Opus Dei im Text behandelt?
Kapitel 2 beschreibt detailliert die Gründung des Opus Dei im Jahr 1928 durch Josemaría Escrivá de Balaguer. Es beleuchtet seine frühen mystischen Erfahrungen, seinen Weg zum Priestertum, die Herausforderungen bei der Gründung und die drei Phasen des Aufbaus (Anfänge, Aufnahme weiblicher Mitglieder, Gründung der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz). Der Fokus liegt auf Escrivás Vision einer Erneuerung der katholischen Kirche durch die Heiligung der Arbeit und die Zusammenfassung von Menschen aus allen Lebensbereichen.
Wie wird die Struktur des Opus Dei dargestellt?
Kapitel 3 befasst sich mit der Organisationsstruktur, die von Escrivá als "desorganisierte Organisation" bezeichnet wurde. Es beschreibt die Struktur als organisch vielfältig und mit minimalistischen Leitungsorganen. Der Text betont die dynamische Entwicklung der Organisation und ihre Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Gläubigen.
Welche Schlüsselwörter werden im Text verwendet?
Die Schlüsselwörter umfassen Opus Dei, Josemaría Escrivá, Personalprälatur, Heiligung der Arbeit, Organisationsstruktur, Mitgliedschaft, Mythen, Kritik, katholische Kirche und Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz.
Welche Quellen werden verwendet?
Der Text erwähnt, dass er diverse Quellen heranzieht, sowohl von Anhängern als auch Kritikern des Opus Dei. Die neutrale und faktenbasierte Betrachtungsweise wird hervorgehoben.
Wie wird "Sakrileg" von Dan Brown im Text erwähnt?
Der Bezug zu Dan Browns "Sakrileg" dient dazu, die Mythenbildung um das Opus Dei und den damit verbundenen Profit zu beleuchten.
- Quote paper
- Viktoria Mey (Author), 2015, "Opus Dei". Zwischen Mythos und Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295772