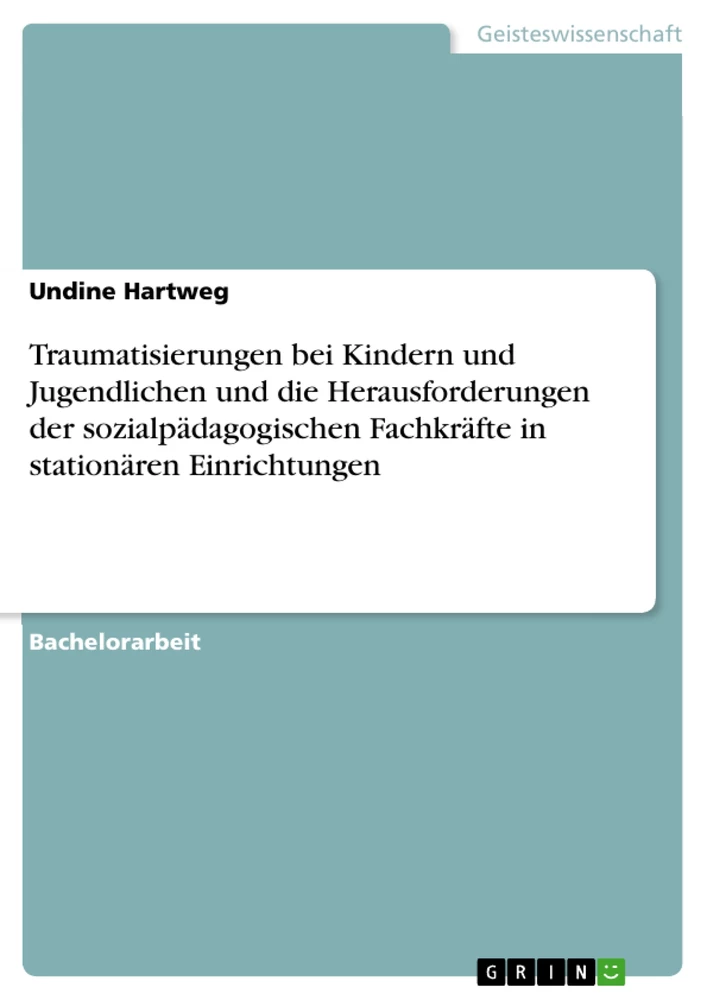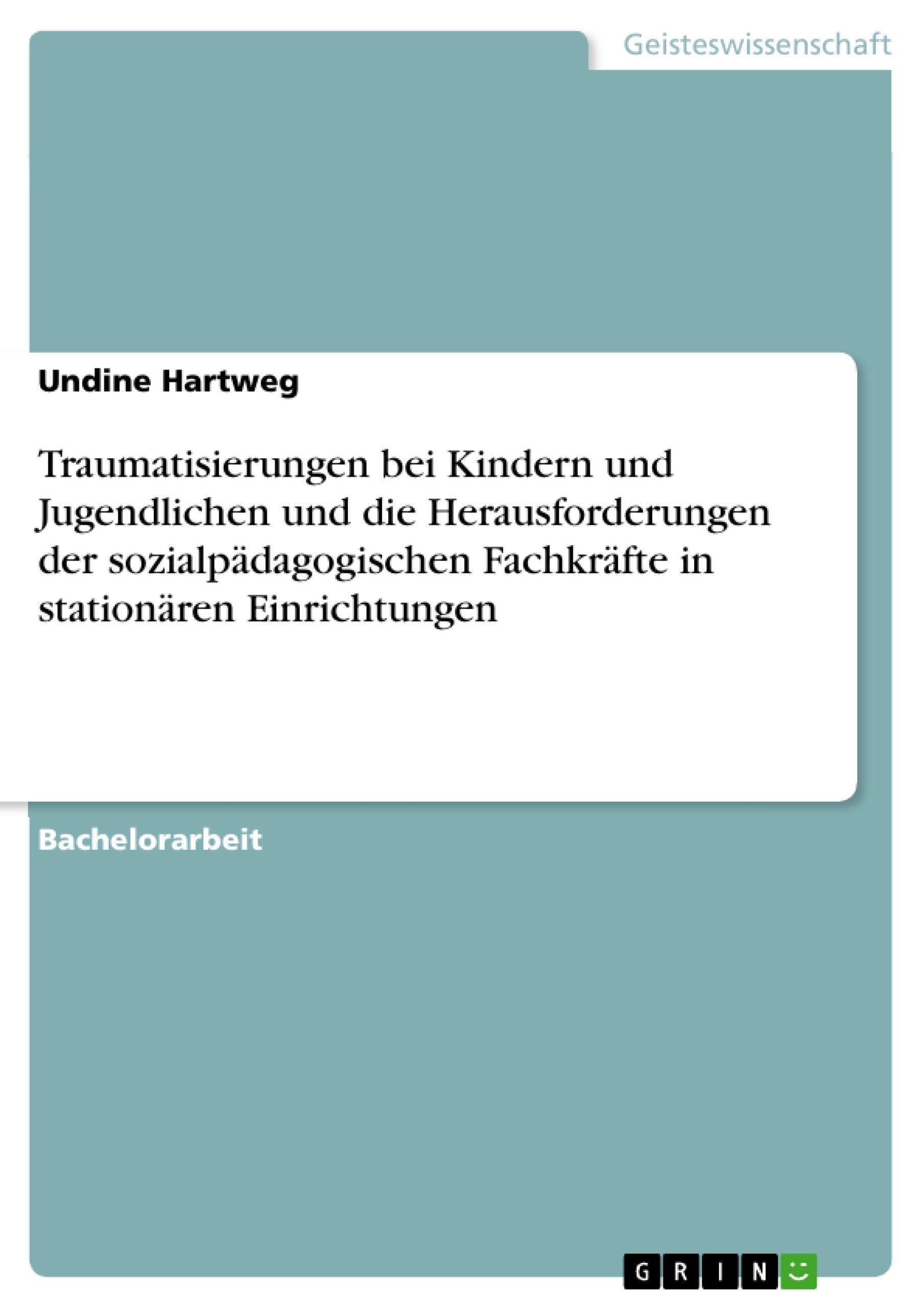Seit mehreren Jahren arbeite ich in einer Einrichtung der Jugendhilfe in einer heilpädagogischen Intensivgruppe mit Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Jedes dieser Kinder weist schwere Belastungszustände und psychische Probleme auf. Oft wurde eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Vielen Kindern fehlt diese Diagnose, dennoch ist ihren Akten zu entnehmen, dass sie traumatische Erlebnisse durchlebt und entsprechende Verhaltensmuster entwickelt haben. So unterschiedlich diese traumatischen Erlebnisse auch sind, erfahren alle diese Kinder existenzielle Angst der sie hilflos ausgeliefert sind. Diese Kinder verlieren ihr Ur-vertrauen, fühlen sich nirgendwo mehr sicher und kennen ihren Platz in der Welt nicht mehr. Auf Grund der unter dem bestehenden Kostenduck stetig weiter ausgebauten ambulanten Hilfen nimmt die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit komplexen Störungsbildern in den Einrichtungen der Jugendhilfe weiter zu. Eine Ursache dafür ist, dass gerade Kinder und Jugendliche aus einem besonders belasteten sozialen Umfeld bei denen die ambulanten Hilfen nicht mehr ausreichend sind stationär untergebracht werden. Studien zufolge zeigen " … mindestens zwei Drittel der Kinder in stationären Einrichtungen ... Auffälligkeiten, ein Drittel eine ganze Reihe von Störungen und Problemlagen. Frühe Traumatisierung nimmt dabei eine Spitzenstellung ein. Ungefähr 80% der Kinder aus stationären Einrichtungen geben an, eine oder mehrere traumatische Erfahrungen gemacht zu haben, ... ". Gerade diese massiv psychisch und psychosozial belasteten Kinder und Jugendlichen fordern die sozialpädagogischen Fachkräfte in ganz besonderem Maße heraus. Häufig konnte ich beobachten, sowohl bei meinen Kollegen als auch bei mir, dass die Reaktionen der Kinder und Jugendlichen die Fachkräfte an ihre physischen und psychischen Grenzen bringen. Viele begleiten die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit großem Einfühlungsvermögen und Hingabe, engagieren sich mit Kraft und Elan und sind dennoch überfordert von den vorerst nicht nachvollziehbaren Verhaltensweisen dieser Kinder und Jugendlichen. Sie fühlen sich persönlich angegriffen und zweifeln an sich und ihrer Professionalität. Es macht sich ein Gefühl der Hilflosigkeit und Frustration breit, die Einsatzbereitschaft sinkt und die Krankheitsraten steigen.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu klären worin die besonderen Belastungen in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauma - Die Theorie
- Geschichtliche Entwicklung der Traumaforschung
- Was ist ein Trauma?
- Entstehung von Traumata
- Traumafolgen
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (DESNOS)
- Entwicklungsverzögerung
- Störung der Bindungsentwicklung
- Neurobiologische Grundlagen
- Traumapädagogik
- Der pädagogische Zugang zum Thema Trauma
- Traumatherapie und Traumapädagogik
- Traumapädagogische Konzepte und Standards
- Grundhaltung
- Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung
- Herausforderungen für sozialpädagogischen Fachkräfte
- Die traumatische Übertragung
- Die traumatische Gegenübertragung
- Die sekundäre Traumatisierung
- Weitere herausfordernde Faktoren
- Unterstützende Faktoren für die pädagogische Traumaarbeit
- Grundkompetenzen sozialpädagogischer Fachkräfte
- Teamarbeit als unterstützender Faktor
- Strukturelle Voraussetzungen und Maßnahmen
- Ausgleichende Schutzfaktoren
- Stabilisierende Prinzipien von Institutionen
- Förderung sozialpädagogischer Fachkräfte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die besonderen Belastungen sozialpädagogischer Fachkräfte in stationären Einrichtungen bei der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, diese Belastungen zu identifizieren und unterstützende Maßnahmen aufzuzeigen, um eine professionelle und hilfreiche traumapädagogische Arbeit zu ermöglichen, ohne dass die Fachkräfte selbst Schaden nehmen.
- Theoretische Grundlagen von Traumata und deren geschichtliche Entwicklung in der Forschung
- Auswirkungen von Traumata auf Kinder und Jugendliche, insbesondere die Entstehung und Folgen verschiedener Traumafolgestörungen
- Traumapädagogische Konzepte und Standards im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen
- Herausforderungen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Arbeit mit traumatisierten Kindern (z.B. Übertragung, Gegenübertragung, sekundäre Traumatisierung)
- Unterstützende Faktoren für die pädagogische Traumaarbeit (z.B. Grundkompetenzen, Teamarbeit, strukturelle Maßnahmen)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Autorin in einer heilpädagogischen Intensivgruppe mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Sie schildert die Überforderung der Fachkräfte durch die komplexen Verhaltensweisen der Kinder und die steigende Zahl traumatisierter Kinder in stationären Einrichtungen aufgrund von Kostendruck und unzureichenden ambulanten Hilfen. Die Arbeit zielt darauf ab, die besonderen Belastungen der Fachkräfte zu klären und unterstützende Maßnahmen aufzuzeigen.
Trauma - Die Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen zum Thema Trauma dar. Es beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Traumaforschung, definiert den Begriff des Traumas, untersucht die Entstehung von Traumata und deren Folgen (PTBS, DESNOS, Entwicklungsverzögerungen, Bindungsstörungen). Ein besonderer Fokus liegt auf den neurobiologischen Grundlagen von Traumatisierungen.
Traumapädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit dem pädagogischen Zugang zum Thema Trauma. Es differenziert zwischen Traumapädagogik und Traumatherapie und untersucht traumapädagogische Konzepte und Standards. Besonderes Augenmerk liegt auf der Grundhaltung der Fachkräfte, der Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung bei den Kindern sowie den Herausforderungen für die Fachkräfte (traumatische Übertragung, Gegenübertragung, sekundäre Traumatisierung).
Unterstützende Faktoren für die pädagogische Traumaarbeit: Dieses Kapitel beschreibt unterstützende Faktoren für die Arbeit mit traumatisierten Kindern. Es beleuchtet die Bedeutung der Grundkompetenzen sozialpädagogischer Fachkräfte, die Rolle der Teamarbeit und die Notwendigkeit von strukturellen Voraussetzungen und Maßnahmen (ausgleichende Schutzfaktoren, stabilisierende Prinzipien von Institutionen, Förderung der Fachkräfte).
Schlüsselwörter
Traumatisierung, Kinder, Jugendliche, stationäre Einrichtungen, sozialpädagogische Fachkräfte, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (DESNOS), Traumapädagogik, Traumatherapie, sekundäre Traumatisierung, Übertragung, Gegenübertragung, unterstützende Faktoren, Teamarbeit, strukturelle Maßnahmen, neurobiologische Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Traumapädagogik in stationären Einrichtungen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die besonderen Belastungen sozialpädagogischer Fachkräfte in stationären Einrichtungen, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Traumata, traumapädagogische Konzepte und Standards, die Herausforderungen für Fachkräfte (Übertragung, Gegenübertragung, sekundäre Traumatisierung) und unterstützende Faktoren wie Grundkompetenzen, Teamarbeit und strukturelle Maßnahmen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenbereiche: die geschichtliche Entwicklung der Traumaforschung, die Definition von Trauma und dessen Entstehung und Folgen (PTBS, DESNOS, Entwicklungsverzögerungen, Bindungsstörungen), neurobiologische Grundlagen von Traumatisierungen, traumapädagogische Konzepte und Standards, die Herausforderungen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Arbeit mit traumatisierten Kindern, und unterstützende Faktoren für die pädagogische Traumaarbeit (Grundkompetenzen, Teamarbeit, strukturelle Maßnahmen).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Belastungen sozialpädagogischer Fachkräfte bei der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu identifizieren und unterstützende Maßnahmen aufzuzeigen, um eine professionelle und hilfreiche traumapädagogische Arbeit zu ermöglichen, ohne dass die Fachkräfte selbst Schaden nehmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Trauma - Die Theorie, Traumapädagogik, Unterstützende Faktoren für die pädagogische Traumaarbeit und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Traumapädagogik und der damit verbundenen Herausforderungen für Fachkräfte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Traumatisierung, Kinder, Jugendliche, stationäre Einrichtungen, sozialpädagogische Fachkräfte, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (DESNOS), Traumapädagogik, Traumatherapie, sekundäre Traumatisierung, Übertragung, Gegenübertragung, unterstützende Faktoren, Teamarbeit, strukturelle Maßnahmen, neurobiologische Grundlagen.
Welche Herausforderungen für sozialpädagogische Fachkräfte werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen der traumatischen Übertragung, der traumatischen Gegenübertragung und der sekundären Traumatisierung für sozialpädagogische Fachkräfte. Zusätzlich werden weitere herausfordernde Faktoren im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen beleuchtet.
Welche unterstützenden Faktoren werden genannt?
Als unterstützende Faktoren werden die Grundkompetenzen sozialpädagogischer Fachkräfte, die Bedeutung der Teamarbeit und die Notwendigkeit von strukturellen Voraussetzungen und Maßnahmen (ausgleichende Schutzfaktoren, stabilisierende Prinzipien von Institutionen, Förderung der Fachkräfte) genannt.
Was ist der Fokus der theoretischen Grundlagen?
Der Fokus der theoretischen Grundlagen liegt auf der geschichtlichen Entwicklung der Traumaforschung, der Definition und Entstehung von Traumata, deren Folgen (inkl. PTBS und DESNOS) und den neurobiologischen Grundlagen von Traumatisierungen.
Wie wird der pädagogische Zugang zum Thema Trauma beschrieben?
Der pädagogische Zugang wird durch die Betrachtung traumapädagogischer Konzepte und Standards, die Bedeutung der Grundhaltung der Fachkräfte, die Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung bei den Kindern beschrieben.
- Quote paper
- Undine Hartweg (Author), 2014, Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen und die Herausforderungen der sozialpädagogischen Fachkräfte in stationären Einrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295524