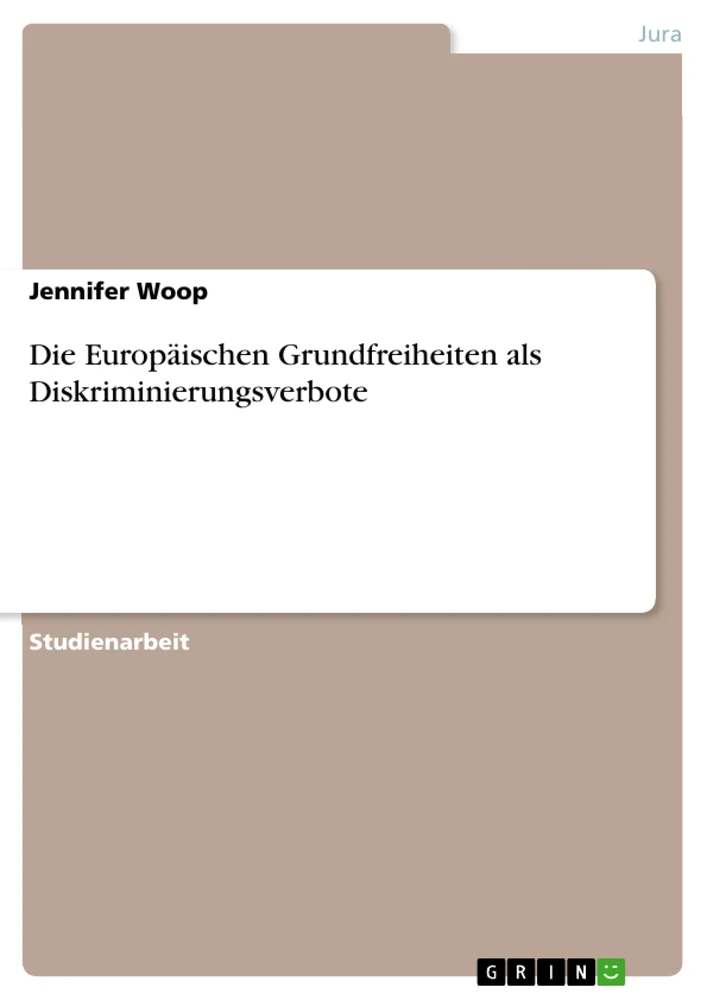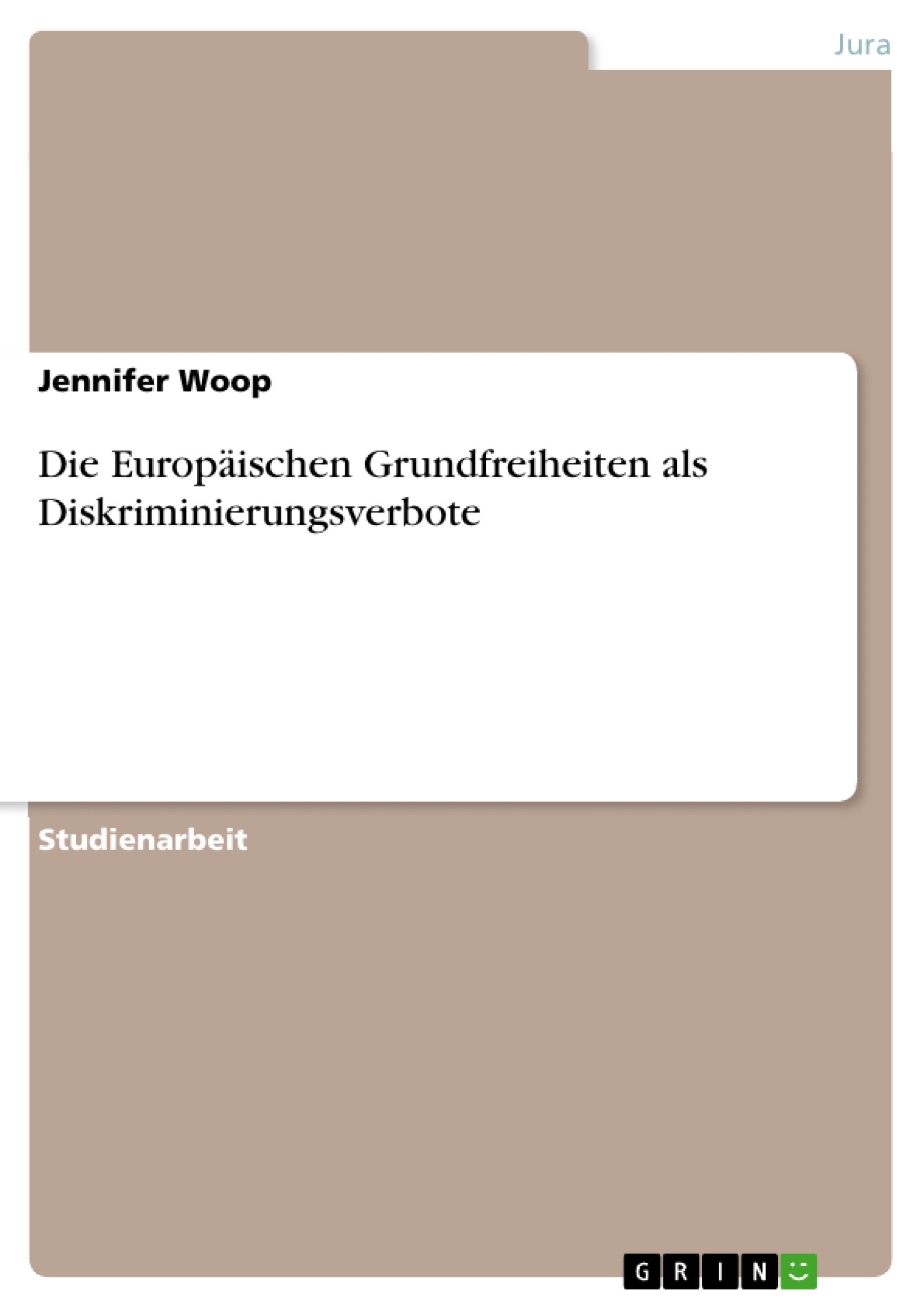Die Grundfreiheiten des Europäischen Gemeinschaftsrechts stellen einen wichtigen Eckpfeiler des Binnenmarktes der Europäischen Union dar, sie sind insbesondere relevant für den Abbau der Hemmnisse im Handel innerhalb der Union. Die Abschaffung der Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten verlangte eine Maßnahme, um die Bewegungsfreiheit von Waren sowie Dienstleistungen, Kapital und Personen zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Zur Erreichung eines gemeinsamen Binnenmarktes als eines der zentralen Ziele der Europäischen Union waren die Marktfreiheiten für die notwendige freiheitliche Gestaltung des Wirtschaftsverkehrs von essentieller Bedeutung. Es wird unterschieden zwischen freiem Warenverkehr (Art. 28 AEUV), freiem Personenverkehr, hierunter fallen sowohl die Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art 45 AEUV), als auch die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV), freiem Dienstleistungsverkehr (Art. 56 AEUV) und freiem Kapitalverkehr (Art. 63 Abs. 1). Ergänzt werden diese vier Grundfreiheiten durch den freien Zahlungsverkehr (Art. 63 Abs. 2), welcher auch die fünfte Grundfreiheit genannt wird und als eigenständige Grundfreiheit aufzufassen ist. Diese Grundfreiheiten sind als spezielle Ausformungen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes des Art. 18 AUEV anzusehen und beinhalten dementsprechend jeweils besondere Diskriminierungsverbote, sie verbieten eine Ungleichbehandlung von Unionsbürgern bzw. Waren anderer Mitgliedstaaten, man spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Grundsatz der Inländergleichbehandlung“. Die folgende Ausführung betrachtet die verschiedenen Grundfreiheiten der Europäischen Union als Diskriminierungsverbote. Das Ziel ist hierbei sowohl eine Definition des Begriffs „Diskriminierung“ vorzunehmen, als auch den Kern der Wirkungsbereiche der einzelnen Grundfreiheiten aufzuzeigen und ihre Ausgestaltung als Diskriminierungsverbote im Einzelnen zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Der Begriff der Diskriminierung
- C. Die Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote
- D. Die einzelnen Grundfreiheiten
- I. Die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 28 ff. AEUV)
- 1. Die Zollunion
- 2. Das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung
- 3. Anwendungsbereich
- 4. Als Diskriminierungsverbot
- II. Die Personenverkehrsfreiheiten
- 1. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
- a) Anwendungsbereich
- b) Als Diskriminierungsverbot
- 2. Die Niederlassungsfreiheit
- a) Der Anwendungsbereich
- b) Als Diskriminierungsverbot
- 1. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
- III. Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Als Diskriminierungsverbot
- IV. Die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Verhältnis zu den anderen Grundfreiheiten
- 3. Als Diskriminierungsverbot
- I. Die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 28 ff. AEUV)
- E. Das Problem der Inländerdiskriminierung
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die europäischen Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote. Ziel ist es, den Begriff der Diskriminierung zu definieren, die Wirkungsbereiche der einzelnen Grundfreiheiten aufzuzeigen und ihre Ausgestaltung als Diskriminierungsverbote zu analysieren.
- Definition des Diskriminierungsbegriffs im europäischen Recht
- Analyse der einzelnen Grundfreiheiten (Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr)
- Untersuchung der Grundfreiheiten als spezielle Ausformungen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes
- Behandlung der Inländerdiskriminierung
- Analyse offener und versteckter Diskriminierungen sowie nicht-diskriminierender Beschränkungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt die europäischen Grundfreiheiten als Eckpfeiler des Binnenmarktes der EU vor und hebt ihre Bedeutung für den Abbau von Handelshemmnissen hervor. Sie führt die vier Grundfreiheiten (Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) sowie den freien Zahlungsverkehr auf und betont ihre Funktion als Diskriminierungsverbote zum Schutz der Unionsbürger vor Benachteiligung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Die Arbeit kündigt die Definition des Diskriminierungsbegriffs und die Analyse der einzelnen Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote an.
B. Der Begriff der Diskriminierung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Diskriminierungsbegriffs, beginnend mit dem US-amerikanischen Wettbewerbsrecht. Es definiert unmittelbare und mittelbare Diskriminierung anhand der Richtlinie 2000/43/EG, wobei unmittelbare Diskriminierung eine explizite Benachteiligung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft darstellt, während mittelbare Diskriminierung sich auf scheinbar neutrale Vorschriften bezieht, die bestimmte Gruppen benachteiligen können. Das Kapitel erweitert den Diskriminierungsbegriff auf unerwünschtes Verhalten, das die Würde verletzt und ein einschüchterndes Umfeld schafft. Es erwähnt auch weitere Diskriminierungsformen (Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung) aus RL 2000/78/EG und fasst Diskriminierung als jede Ungleichbehandlung aufgrund unsachgemäßer Kriterien zusammen.
C. Die Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote: Dieses Kapitel erläutert die Grundfreiheiten als ursprünglich als Diskriminierungsverbote konzipierte Bestimmungen, die Unionsbürger vor Benachteiligung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit schützen sollen. Es differenziert zwischen offenen (direkter Bezug zur Staatsangehörigkeit) und versteckten Diskriminierungen (Anknüpfung an andere Kriterien wie den Wohnort) sowie Beschränkungen, die keine Diskriminierung darstellen, aber dennoch den Ausländern Nachteile verschaffen. Es betont die Entwicklung der Grundfreiheiten durch die Rechtsprechung des EuGH hin zu allgemeinen Beschränkungsverboten, die auch nicht-diskriminierende Beschränkungen als rechtswidrig einstufen.
Schlüsselwörter
Europäische Grundfreiheiten, Diskriminierungsverbote, Binnenmarkt, Gleichheitsgrundsatz, Inländergleichbehandlung, Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr, Zahlungsverkehr, unmittelbare Diskriminierung, mittelbare Diskriminierung, Art. 18 AEUV, Art. 28 ff. AEUV, Art. 45 AEUV, Art. 49 AEUV, Art. 56 AEUV, Art. 63 AEUV.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Europäische Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die europäischen Grundfreiheiten als Verbote von Diskriminierung. Sie definiert den Begriff der Diskriminierung, zeigt die Wirkungsbereiche der einzelnen Grundfreiheiten auf und analysiert deren Ausgestaltung als Diskriminierungsverbote.
Welche Grundfreiheiten werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes: die Freiheit des Warenverkehrs, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit, die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs und die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Jede Freiheit wird im Hinblick auf ihre Funktion als Diskriminierungsverbot analysiert.
Wie wird der Begriff der Diskriminierung definiert?
Die Arbeit definiert den Diskriminierungsbegriff anhand der Richtlinie 2000/43/EG, unterscheidet zwischen unmittelbarer (explizite Benachteiligung) und mittelbarer Diskriminierung (scheinbar neutrale Vorschriften mit benachteiligenden Folgen). Der Begriff wird erweitert auf unerwünschtes Verhalten, das die Würde verletzt und ein einschüchterndes Umfeld schafft. Weitere Diskriminierungsformen (Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung aus RL 2000/78/EG) werden erwähnt.
Wie werden die Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote ausgelegt?
Die Arbeit erläutert die Grundfreiheiten als ursprünglich als Diskriminierungsverbote konzipierte Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Sie differenziert zwischen offener und versteckter Diskriminierung und behandelt auch Beschränkungen, die keine Diskriminierung darstellen, aber Nachteile für Ausländer mit sich bringen. Die Entwicklung der Grundfreiheiten durch die Rechtsprechung des EuGH hin zu allgemeinen Beschränkungsverboten wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Inländerdiskriminierung?
Die Inländerdiskriminierung wird als ein wichtiges Thema innerhalb der Analyse der Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote behandelt. Die Arbeit untersucht, wie die Grundfreiheiten dazu beitragen, Inländerdiskriminierung zu verhindern und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Begriff der Diskriminierung, Die Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote, Die einzelnen Grundfreiheiten (Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr), Das Problem der Inländerdiskriminierung und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Europäische Grundfreiheiten, Diskriminierungsverbote, Binnenmarkt, Gleichheitsgrundsatz, Inländergleichbehandlung, Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr, Zahlungsverkehr, unmittelbare Diskriminierung, mittelbare Diskriminierung, Art. 18 AEUV, Art. 28 ff. AEUV, Art. 45 AEUV, Art. 49 AEUV, Art. 56 AEUV, Art. 63 AEUV.
Welche Rechtsgrundlagen werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die einschlägigen Artikel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und relevante Richtlinien der Europäischen Union, insbesondere Richtlinie 2000/43/EG und Richtlinie 2000/78/EG. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) spielt eine zentrale Rolle bei der Auslegung der Grundfreiheiten.
- Quote paper
- Jennifer Woop (Author), 2013, Die Europäischen Grundfreiheiten als Diskriminierungsverbote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295505