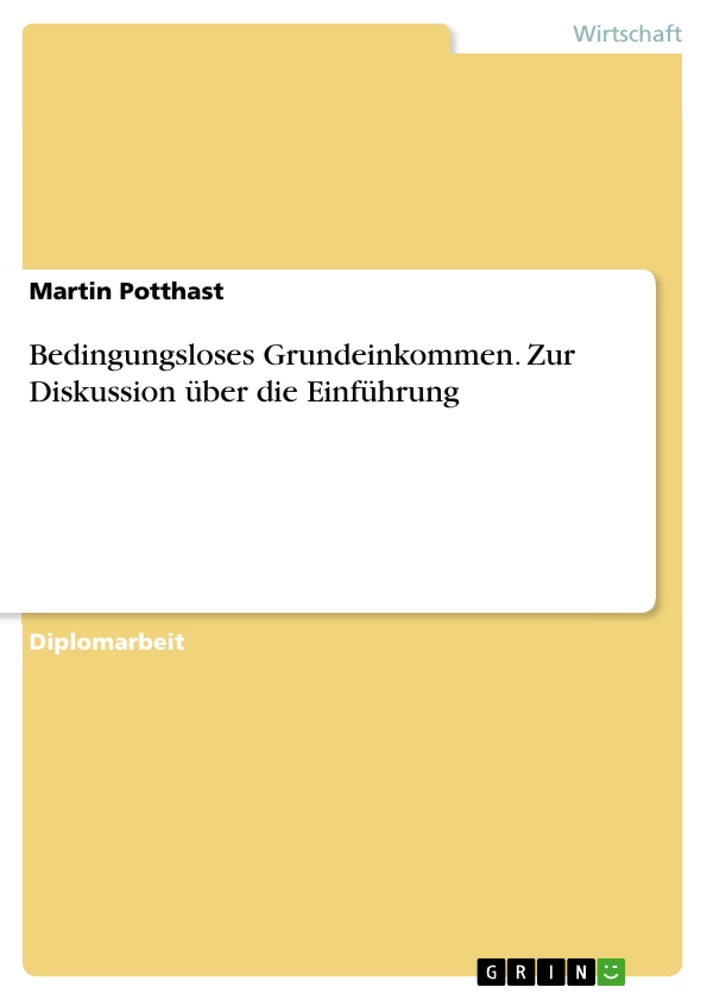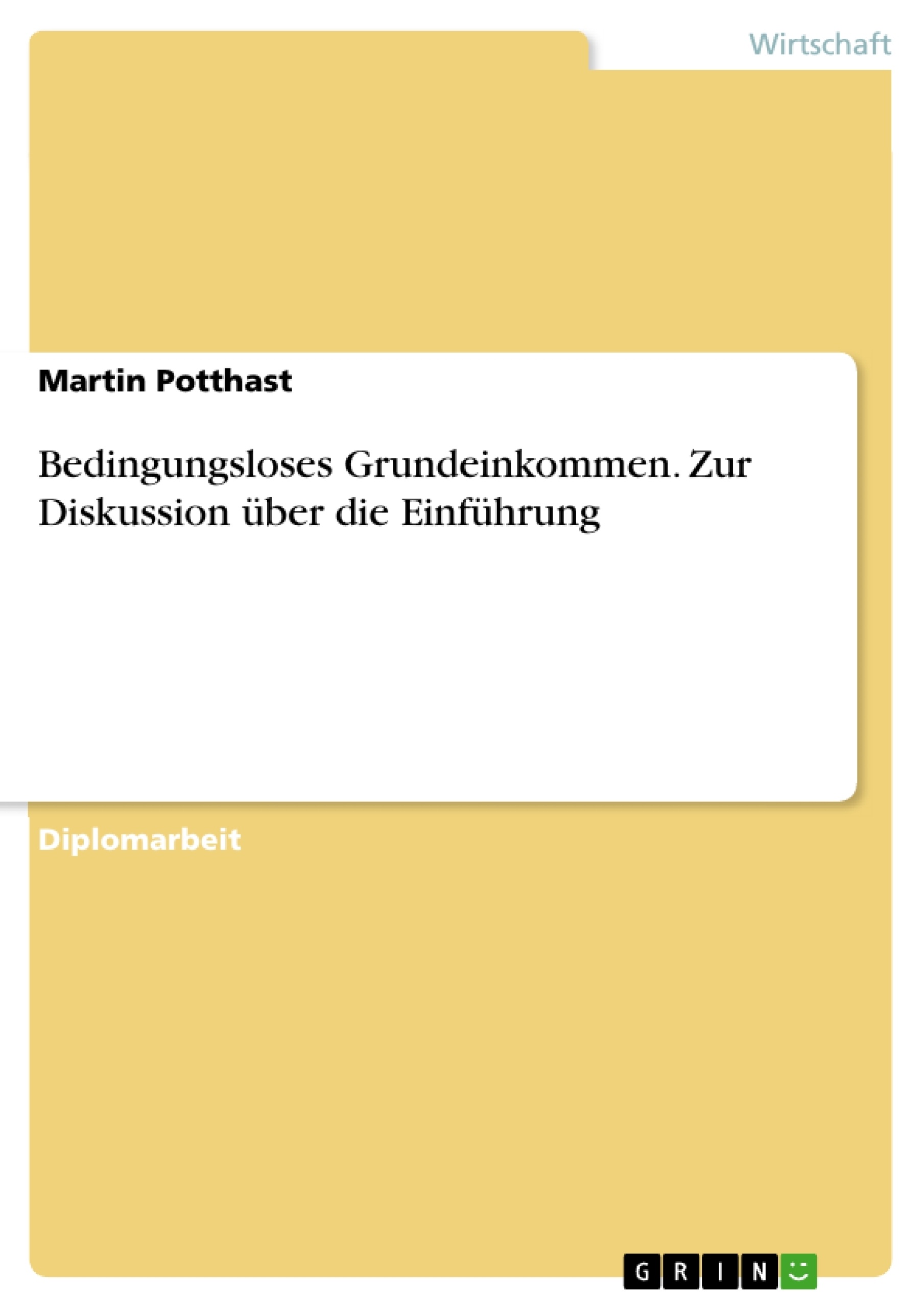Das bedingungslose Grundeinkommen ist zurzeit wieder ein viel diskutiertes Thema. Aus verschieden politischen Richtungen werden Ideen dazu entwickelt. Die vorliegende Arbeit wird sich mit diesem Thema befassen. Zunächst wird definiert, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Anschließend folgt ein kurzer historischer Überblick, danach die Vorstellung der wichtigsten Konzepte. Aus diesen Modellen wird eine zentrale Zielsetzung für ein idealtypisches bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt.
Im darauffolgenden Kapitel werden dann die ökonomischen Auswirkungen (Geldwertstabilität, Arbeitsmarkt, Einkommensverteilung, Bürokratie) untersucht.
Schließlich folgen Kapitel zur Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens und zur Einbindung der Sozialversicherungssysteme.
Im darauf folgenden Kapitel werden sehr kurz Alternativen zum bedingungslosen Grundeinkommen vorgestellt und die Unterschiede dazu erläutert. Es folgt eine kurze Schlussbetrachtung.
In dieser Arbeit wird ein Phänomen nicht weiterfolgt, nämlich, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es nur in einem regionalen Bereich eingeführt wird, „Sozialtourismus“ erzeugt und diejenigen, die es finanzieren müssen, abwandern oder ihr Geld in eine andere Region verlagern können, also Kapitalflucht begehen. Darum wird hier von dem Modell der geschlossenen Volkswirtschaft ausgegangen.
Alleine die ökonomischen Reaktionen in einer offenen Volkswirtschaft durch „Sozialtourismus“ und Kapitalflucht könnten dafür sorgen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht realisierbar ist.
Inhaltsverzeichnis
0. Verzeichnisse
0.2 Tabellenverzeichnis
0.3 Kastenverzeichnis
0.4 Abbildungsverzeichnis
0.5 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Das bedingungslose Grundeinkommen
2.1 Definition und Rechtfertigung
2.2 Historischer Überblick
2.3 Verschiedene Konzepte
2.3.1 Aktuelle Grundsicherung in Deutschland (zum Vergleich)
2.3.2 Negative Einkommensteuer
2.3.3 Modell Solidarisches Bürgergeld von Dieter Althaus
2.3.4 Modell des Grundeinkommens vom HWWI (Hohenleitner/Straubhaar)
2.3.5 Modell von Götz Werner
2.3.6 Das Transfergrenzen-Modell (Pelzer/Fischer)
2.3.7 Ausgewählte weitere Konzepte (Kurzdarstellung)
2.4 Zielsetzungen und Funktionsweise
3. Ökonomische Auswirkungen
3.1 Auswirkungen auf Märkte
3.1.1 Auswirkungen auf die Geldwertstabilität
3.1.2 Auswirkungen auf den Kapitalmarkt
3.1.3 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
3.2 Auswirkungen auf die Nachfragestruktur
3.2.1 Auswirkungen auf die Konsumgüternachfrage
3.2.2 Auswirkungen auf die Investitionsgüternachfrage
3.3 Auswirkungen auf die Preisgestaltung
3.4 Auswirkungen auf die Einkommensverteilung
3.5 Auswirkungen auf die Bürokratie
3.5.1 Auswirkungen auf die Verwaltung
3.5.2 Auswirkungen auf die Empfänger der bisherigen Grundsicherung
4. Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens
4.1 Finanzierung durch Einkommenssteuer
4.2 Finanzierung durch Mehrwertsteuer
4.3 Finanzierung durch Sozialversicherungen
5. Einbindung der Sozialversicherungen
6. Alternativen zum Bedingungslosen Grundeinkommen
7. Schlussbetrachtung
8. Literaturverzeichnis
0.2 Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Transferentzugsraten gemäß § 30 SGBII
Tabelle 2: Grundeinkommenskonzepte im Vergleich
Tabelle 3: Einkommensverteilung und Einflussgrößen
0.3 Kastenverzeichnis
Kasten 1: Das Konzept des Solidarischen Bürgergeldes von Dieter Althaus
Kasten 2: idealtypische Grundpfeiler eines BGE nach dem HWWI-Modell
0.4 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Wirkungsweise der negativen Einkommenssteuer
Abbildung 2: Idealtypische Wirkungsweise des BGE anhand der Wirkungsweise einer Sozialdividende
Abbildung 3: Wirkungsweise einer Sozialdividende ohne Einkommensumverteilung
0.5 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Das bedingungslose Grundeinkommen ist zurzeit wieder ein viel diskutiertes Thema. Aus verschieden politischen Richtungen werden Ideen dazu entwickelt.
Die vorliegende Arbeit wird sich mit diesem Thema befassen.
Zunächst wird definiert, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Anschließend folgt ein kurzer historischer Überblick, danach die Vorstellung der wichtigsten Konzep- te.
Aus diesen Modellen wird eine zentrale Zielsetzung für ein idealtypisches bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt.
Im darauffolgenden Kapitel werden dann die ökonomischen Auswirkungen (Geldwertstabilität, Arbeitsmarkt, Einkommensverteilung, Bürokratie) untersucht.
Schließlich folgen Kapitel zur Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens und zur Einbindung der Sozialversicherungssysteme.
Im darauf folgenden Kapitel werden sehr kurz Alternativen zum bedingungslosen Grundeinkommen vorgestellt und die Unterschiede dazu erläutert.
Es folgt eine kurze Schlussbetrachtung.
In dieser Arbeit wird ein Phänomen nicht weiterfolgt, nämlich, dass ein bedingungslo- ses Grundeinkommen, wenn es nur in einem regionalen Bereich eingeführt wird, „Sozialtourismus“ erzeugt und diejenigen, die es finanzieren müssen, abwandern oder ihr Geld in eine andere Region verlagern können, also Kapitalflucht begehen.1
Darum wird hier von dem Modell der geschlossenen Volkswirtschaft ausgegangen.
Alleine die ökonomischen Reaktionen in einer offenen Volkswirtschaft durch „Sozialtourismus“ und Kapitalflucht könnten dafür sorgen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht realisierbar ist.
2. Das bedingungslose Grundeinkommen
Zunächst soll geklärt werden, was genau unter einem „bedingungslosen Grundeinkom- men“ verstanden wird bzw. werden soll. Danach werden einige Modelle vorgestellt, wobei jedoch nicht alle derzeit diskutierten Modelle behandelt werden können. Viel- mehr soll der Grundgedanke der wichtigsten Modelle erfasst und aus den verschiedenen Modellen eine Art „Forderungskatalog“ erstellt werden, was die Ziele eines „bedin- gungslosen Grundeinkommens“ sein sollen. Im nächsten Kapitel sollen dann die öko- nomischen Auswirkungen eines solchen Grundeinkommens untersucht werden.
2.1 Definition und Rechtfertigung
Der Begriff „bedingungsloses Grundeinkommen“, auch als BGE bezeichnet, beinhaltet zwei Bestandteile, welche für sich in diesem Zusammenhang definiert werden sollen:
1. bedingungslos:
Dies bedeutet, dass keine Gegenleistung, keine Bedürftigkeitsprüfung und keine sonstigen Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Das heißt, es besteht keine Verpflichtung zu Erwerbsarbeit oder gemeinnütziger Tätigkeit, deren Verlet- zung eine Kürzung oder Streichung zur Folge hätte. Somit gibt es kein Prinzip des „Förderns und Forderns“. Ebenso wenig darf anderes Einkommen oder gar Vermögen angerechnet werden. Es gibt also keine Nachrangigkeit der Unters- tützung und somit gilt das Subsidiaritätsprinzip nicht. Darüber hinaus dürfen auch keine sonstigen Auflagen, z.B. Wohlverhalten, aber auch andere Bedin- gungen, wie Aufenthaltsort, Abstammung, Lebensalter oder Geschlecht eine Voraussetzung sein.
Es muss also jedem ohne „wenn und aber“ gewährt werden. Juristisch bedeutet das, einen individuellen Rechtsanspruch darauf zu haben.2
2. Grundeinkommen:
Das bedeutet: Es ist ein Einkommen, das als Grundlage dient. Es stellt keines- wegs ein Einheitseinkommen für alle sicher, sondern nur das Minimaleinkom- men, das jeder zur Sicherstellung der Grundversorgung erhält. Es stellt natürlich das gesamte Einkommen für diejenigen dar, die keine weiteren Einkommen ha- ben, also keine weiteren Transfereinkommen (z.B. private Unterhaltszahlungen, speziell gewährte Transfereinkommen für Menschen in besonderen Lebensla- gen), keine am Markt erzielten Einkommen (Kapitaleinkommen und Arbeitsein- kommen) und keine zu früherem Zeitpunkt erworbenen Renten beziehen. Das Grundeinkommen soll das Existenzminimum sichern, nach Möglichkeit das „so- zioökonomische Existenzminimum“. Da das Grundeinkommen der Minimalbet- rag ist, den ein Mensch regelmäßig erhalten soll, muss es natürlich steuerfrei sein. Die darüber hinaus erzielten Einkommen (weitere Einkommen) können ganz normal besteuert werden.
Wird das bedingungslose Grundeinkommen wie in den oben beschriebenen Definitionen gewährt, wird es auch als Sozialdividende bezeichnet.
Ein weiterer Begriff, welcher zu definieren ist, ist das in der Literatur häufig genannte „sozioökomische Existenzminimum“(SE):
Während das (normale) Existenzminimum das physikalische Existieren (Überleben) gerade eben auf minimalem Niveau sichert, soll das „sozio-kulturelle“3 bzw. das „so- zioökonomische Existenzminimum“4 (im folgenden SE abgekürzt) alle Grundlasten des Lebens decken und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Ziel ist der Schutz der Menschenwürde5, wie sie in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesre- publik Deutschland gefordert wird. Das SE soll somit ein von Existenzängsten befreites Leben ermöglichen. Keineswegs heißt das aber, dass damit ein Leben „in Saus und Braus“ gesichert wird. Vielmehr soll es nur eine Grundlage sichern, auf die man sich zur Not zurückziehen kann, aber den Anreiz zur Einkommenserzielung am Markt (in- sbesondere durch Arbeit) nicht verhindern. Die Höhe dieses Existenzminimums lässt sich nicht so leicht bestimmen, schon gar nicht in absoluter Höhe. Das hängt zum einen davon ab, was nun alles als „lebensnotwendig“ und für ein „würdevolles Leben“ unab- dingbar erachtet wird, zum anderen davon, wie es in Relation zu anderen Gesell- schaftsmitgliedern steht.6 Durch die ökonomischen Reaktionen verändert sich auch das Preisniveau, so dass es erst recht schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, einen Geldbetrag dafür zu bestimmen. Es lässt sich zunächst nur willkürlich, orientiert an derzeitigen Sozialleistungen, ergänzt um die zusätzlichen Aufgaben („würdevolles Leben“), festlegen und dann regelmäßig anpassen.
Ein wichtiger Punkt beim SE ist, dass zur Vermeidung von Existenzängsten sicherge- stellt wird, dass der einmal erworbene Lebensstandard gehalten werden kann und nicht weiter absinkt. Das gilt insbesondere für die Vermögenssicherung, so dass der Schutz vor Vermögensverwertung eine der wichtigsten Aufgaben des SE ist. Insofern würde die Sicherstellung des SE nicht zwangsläufig zu Gleichheit oder gar Umverteilung füh- ren.
Die Vorschläge für die Höhe des BGE bewegen sich zwischen 400 und 1500 €. Als numerischer Richtwert könnte die derzeitige Armutsgrenze von 938 €7 dienen.
Rechtfertigung für ein Grundeinkommen:
Warum sollte ein solches BGE eingeführt werden? zu In der Literatur gibt es verschiedene Begründungen und Ziele, z.B. den sozialen Frieden zu stärken8 Zunächst soll an dieser Stelle nur geklärt werden, warum ein leistungsloses Einkommen (ob in Geld oder in Naturalien) überhaupt ausgezahlt werden soll.
Der Grundkonsens ist, dass Menschen ein Einkommen zum Leben brauchen. Hierbei sollte nicht nur das rein physische Überleben berücksichtigt werden, sondern auch das psychische Wohlbefinden. Es soll zumindest eine Grundzufriedenheit für jeden sicher- gestellt werden. Dieses gebietet allein die Einhaltung der Menschenwürde und Gleich- behandlung.
Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens führen dagegen an, dass es in Deutschland und allen erfolgreichen Industriestaaten üblich ist, dass Menschen auch für ein solches Grundeinkommen eine Gegenleistung erbringen müssen9. Das Funktionie- ren eines Gemeinwesens und hoher Wohlstand beruhten auf den Prinzipien der Eigen- verantwortung, das mit einem BGE ausgehebelt würde, weil zu viele Menschen dann gar nichts tun und dadurch die Produktion und somit der Wohlstand sinken würden. Außerdem sei es ungerecht, wenn „Fleißige“ für „Faule“ mitarbeiten müssten.
Auf den ersten Blick scheint diese Kritik berechtigt zu sein. Bei genauerem Hinschauen jedoch lässt sich wiederum dagegen argumentieren:
Das BGE bedeutet nicht zwangsläufig, dass keiner mehr etwas tut. Es kommt auf die Ausgestaltung an.10
Es gibt Menschen, die nicht in der Lage sind, eine Gegenleistung zu erbringen. Bei dieser Gruppe ist das Thema Arbeitsanreiz ohnehin irrelevant. Da diese Menschen ihrer Situation kaum etwas ändern können, benötigen sie ein Grundeinkommen, welches das SE abdeckt.
Dem Prinzip der Eigenverantwortung und der Gerechtigkeit stehen Menschen- würde und Gleichbehandlung gegenüber. Somit ergibt sich ein Verteilungsprob- lem.
Dem möglichen Produktionsrückgang steht ein möglicher Freizeitgewinn gegen- über.
Die Produktivität und Fähigkeiten der Menschen sind ungleich verteilt. Von daher kann auch der Arbeitseinsatz ungleich verteilt werden.
Dem strukturellen Wandel der Gesellschaft sind die derzeitigen Sozialsysteme nicht gewachsen.11
Vollbeschäftigung im herkömmlichen Sinne wird es nicht mehr geben können12
Menschen brauchen, um sinnvoll arbeiten zu können eine gesicherte Existenz und Ausbildung, also Chancengleichheit13
Die derzeit gewährten sozialen Sicherungen erreichen nicht diejenigen, welche sie am dringendsten benötigen.14
Die Mitwirkungspflichten derzeitiger sozialer Sicherungen verstoßen gegen die Menschenwürde.
Das BGE wäre effizienter als die ohnehin gewährten Sozialleistungen.15 Aufwertung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Schon heute und auch in früheren Zeiten waren nicht alle Menschen, die versorgt werden mussten, erwerbstätig. Es gab viele große Familien mit nur einem Erwerbstätigen. Frau und viele Kinder lebten auf Kosten eines Mannes. Das änderte sich im Laufe der Jahre. So ist die Erwerbsquote heutzutage deutlich höher, da jetzt in den Familien oft beide Eltern berufstätig sind, aber die Familien weniger Kinder haben. Dadurch würde die Umverteilung statt intrafamiliär nun interfamiliär stattfinden.
2.2 Historischer Überblick
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens bzw. eines garantierten Mindesteinkommens geht bis ins Mittelalter zurück. Thomas Morus forderte in seinem Werk „Utopia“ bereits 1517 ein Einkommen für jeden, einfach weil er der Gesellschaft angehört. Jeder sollte sich nehmen können, was er braucht.16
Später, im 19. und Anfang des 20. Jahrhundert, wurde eine staatliche Fürsorgepflicht konstatiert, im Gegenzug aber eine Arbeitspflicht gefordert. Es gab aber auch andere Stimmen: So forderte z.B. der russische Anarchist Peter Kropotkin einen bedingungslo- ses Grundeinkommen und meinte: „Ein Recht auf Arbeit wäre günstigstenfalls ein in- dustrielles Zuchthaus.“17
Schon zu dieser Zeit glaubten Menschen daran, dass technischer Fortschritt die Arbeit irgendwann überflüssig machen und eine arbeitsunabhängige Vollversorgung entstehen würde. Ohne ein BGE, so ihre Auffassung, würden viele verarmen und nur wenige (diejenigen, die noch Arbeit hätten oder von Kapitalerträgen lebten) sehr wohlhabend sein. Durch die Weltwirtschaftskrise wurde der technische Fortschrittsglaube zunächst gestoppt und die BGE-Debatte kam zum Erliegen.18
In den 1960er Jahren wurde die Debatte um das Grundeinkommensdebatte vor allem in den USA und in Schweden geführt. Wissenschaftler unterschiedlicher Weltanschauung schlossen sich den Befürwortern an. In den USA wurden Feldexperimente durchgeführt, welche das Arbeitsangebot testen sollten. Die Ergebnisse waren aber verzerrt, da kinderreiche Familien überrepräsentiert waren. Hierdurch war bei Frauen eine hohe Ausstiegsrate aus dem Arbeitsmarkt ermittelt worden.19
In den 1970er Jahren wurde das Thema auch in Deutschland wieder diskutiert. Vor allem das Modell der „negativen Einkommensteuer“ (siehe nächster Abschnitt) spielte eine wichtige Rolle. Aber auch die „Sozialdividende“ (= BGE) wurde schon gefordert, jedoch eng verknüpft mit der Frage der Arbeitsumverteilung. Der Gedanke, dass Menschen arbeiten sollen, spielte hier noch eine wichtige Rolle.20
Insgesamt bildeten sich verschiedene Denkrichtungen mit unterschiedlichen Motiven und Zielsetzungen heraus. Den einen ging es vor allem um eine Effizienzsteigerung bei der Gewährung von staatlich finanzierten Sozialleistungen, eine Integration von Trans- ferleistungen ins Steuersystem (Steuerreform) und eine Senkung des Sozialleistungsni- veaus21, den anderen um eine Sicherstellung des Existenzminimums. Dritte wollten vor allem den Arbeitsmarkt von Regulierung befreien. Eine weitere Richtung wollte die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen, um die den Menschen bessere Entfaltungs- möglichkeiten zu geben. Natürlich gab es auch alle möglichen Kombinationen der ver- schiedenen Richtungen. Teilweise wurde in der früheren Diskussion auch eine „Ar- beitspflicht im Sektor des Notwendigen“22 gefordert. Einigen ging es darum, Produkti- vitätsgewinne durch Automation nicht allein den Kapitaleignern und Unternehmern zugute kommen zu lassen, sondern umzuverteilen, so dass alle etwas davon hätten.23
In der vorindustriellen Zeit ging es in der Diskussion vor allem um Sozialpolitik - es war dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft versorgt wären, somit die Produktion auf „notwendige“ Güter reduziert und nicht für „verpönte“ Luxusgüter ver- schwendet würde. Mit der Industrialisierung kam dann mehr die Frage einer Vertei- lungsgerechtigkeit im Sinne der Produktivität auf. Nicht die Kapitalgeber und Unter- nehmer, sondern auch die Arbeiter sollten angemessen an dem Erwirtschafteten beteiligt werden.
In den USA schlug Milton Friedman 1962 eine „negative Einkommensteuer“24 vor, welche aber im Falle des maximalen Transfers, also ohne selbst verdientes Einkommen, unterhalb des Existenzminimums liegen sollte, damit genug Arbeitsanreiz bestände. Ziel war vor allem die vereinfachte Gewährung sozialer Transferleistungen. In diese Richtung geht auch das von der FDP in Deutschland vorgeschlagene „Liberale Bürgergeld“, welches eine negative Einkommensteuer darstellt, die an Arbeitsbereit- schaft gebunden ist.
Erst in den 1980er Jahren wurde die Debatte über das Grundeinkommen wieder auf breiterer Basis geführt. In Frankreich war André Goerz, in Deutschland Michael Opiel- ka und Georg Vobruba Vorkämpfer für die Idee eines BGE. Das Motiv war jetzt eine Absicherung derjenigen, die durch die zunehmende Massenarbeitslosigkeit und das nicht mehr zu realisierende Ziel der Vollbeschäftigung aus den beschäftigungsgebunde- nen bzw. -orientierten sozialen Sicherungssystemen herausfielen. Ebenfalls wollte man eine Alternative zu den bisherigen sozialen Sicherungssystemen schaffen, weil diese bei rückläufiger Beschäftigung ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen oder gar zusammenbre- chen könnten.25
International hat sich 1986 das „Basic Income Earth Network“ (BIEN) gegründet26: www.basicincome.org
Dessen deutscher Ableger ist das „Netzwerk Grundeinkommen“: www.netzwerk-grundeinkommen.de
In der aktuellen Diskussion fordern nun auch Unternehmer ein BGE. Ihr Motiv ist vor allem die Deregulierung des Arbeitsmarktes und somit mehr Flexibilität des Produkti- onsfaktors Arbeit. Darüber hinaus wird eine Produktivitätssteigerung des Faktors Arbeit erhofft, weil Menschen ohne Existenzängste ihr Arbeitspotential besser nutzen könnten.
Somit haben sich aktuell verschiedene Richtungen (Diskurse)27 herausgebildet, die ein BGE fordern und entsprechende Argumente vorbringen:
1. neoliberaler Diskurs
Ziel ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Dadurch soll der Produktionsfaktor Arbeit wettbewerbsfähig und besser genutzt werden, da sich - befreit von Existenz- ängsten - mehr Kreativität und somit Produktivität entwickeln soll. Die sozialen Si- cherungssysteme sollen von Arbeit und Beschäftigung entkoppelt, die staatliche Transfergewährung entbürokratisiert und das Steuersystem, vor allem durch Wegfall von bedingten Steuerbefreiungen, vereinfacht werden. Diese Sichtweise wird vor al- lem von Unternehmern vertreten.
2. sozialliberaler Diskurs
Ziel ist ähnlich dem neoliberalen Diskurs eine Entlastung und Flexibilisierung des Faktors Arbeit zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, was aber teilweise nur als notwendiges Übel angesehen wird. Umgekehrt soll, teils aus Überzeugung, aber teils auch, um Interessengruppen, die soziale Errungenschaften nicht aufgegeben sehen wollen, zu berücksichtigen, an diesen Errungenschaften weitestgehend festgehalten werden. Ein BGE scheint hier der Kompromiss zu sein, jedoch in möglichst niedriger Höhe. Diese Sichtweise ist die politisch geprägte.
3. emanzipatorischer Diskurs
Hier geht es weniger um die Entlastung von Unternehmen oder die Vereinfachung von staatlichen Sozialsystemen, sondern darum, die Position derjenigen, die am Ar- beitsmarkt ihre Arbeitskraft bereitstellen, zu verbessern und den Druck, der durch knappe Arbeitsplätze und Wettbewerb auf Arbeitnehmer entsteht, abzumildern bzw. zu unterbinden. Die Befreiung (Emanzipation) der Arbeitnehmer von Arbeitgeber- bedingungen soll Ausbeutung verhindern und Autonomie und Verhandlungsmacht steigern. Generell soll die Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt erreicht und Autono- mie gefördert werden. Es geht letzten Endes um die Umverteilung gesellschaftlicher Arbeit, zum einen zwischen Männern und Frauen, zum anderen durch mehr Teilzei- tarbeitsplätze. Ein weiterer Punkt ist, dass derzeit unbezahlte Arbeit (z.B. Ehrenäm- ter, aber auch Hausarbeit) aufgewertet werden sollen, da ja auch diejenigen, die die- se Arbeit erledigen, das BGE erhalten. Hierbei handelt es sich um eine sozialistische Sichtweise.
4. sozial-egalitärer Diskurs
Zentral ist bei diesem Diskurs der Umverteilungsgedanke (von reich zu arm). Es spielen dabei weniger ökonomische als vielmehr soziologische Argumente eine Rol- le. Forderungen nach einem BGE aus dieser Richtung sind mehr als Gegenbewe- gung zu neoliberalen Tendenzen gedacht, alles dem Markt unterzuordnen. Die Ent- koppelung von Arbeit und Einkommen ist das eigentliche Ziel. Nur eine solidari- sche, partizipatorische und konsumstarke Gesellschaft wird als zukunftsfähig ange- sehen. Das BGE ist als Kompensation für die Unzulänglichkeiten, die das mark- twirtschaftliche System mit sich bringt, und den Strukturwandel, der dazu geführt hat, dass es immer mehr Lücken im sozialen Netz und keine Vollbeschäftigung mehr gibt und geben wird, gedacht. Die Finanzierung des Grundeinkommens soll aus Unternehmensgewinnen und höheren Einkommen erfolgen. Ziel ist der Versor- gungsstaat. Dies ist eine traditionell eher „linke“ Sichtweise.
Zum Abschluss eine Tabelle, welche die Diskurse, Motive und Ausgestaltungen noch einmal systematisch darstellt:
Tabelle: idealtypische Kategorisierung von Grundeinkommen28
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Verschiedene Konzepte
An dieser Stelle sollen die bekanntesten Modelle zur Einführung eines Grundeinkom- mens kurz vorgestellt werden. Diese Vorstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän- digkeit und es werden auch keine Modellvarianten separat erläutert, die sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden, also keine strukturellen Änderungen gegenüber vorgestell- ten Modellen beinhalten.29
2.3.1 Aktuelle Grundsicherung in Deutschland (zum Vergleich)
In Deutschland hat sich die Grundsicherung im Laufe der Zeit gewandelt. Aktuell gelten die im Rahmen der „Agenda 2010“ entworfenen Sozialgesetzbücher SGB II (auch unter dem Namen „Hartz IV“ oder „Arbeitslosengeld II“ bekannt) und SGB XII (Hilfe zu Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen, bekannt auch als „Sozialhilfe“ und „Grundsicherung im Alter“. Dieses nennt sich auch Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU).30 Es gibt darüber hinaus ergänzende Regelungen, die hier im Einzelnen nicht erwähnt werden sollen, weil sie nur für in speziellen Fällen gewährt werden (Sozialgeld, Wohngeld, BAföG usw.) oder Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in besonderen Lebenslagen (HLB).31 gedacht sind. Zusätzlich gibt es noch Sozialleistungen, die be- stimmten Personengruppen bedarfsunabhängig gewährt werden, z.B. Kindergeld und Betreuungsgeld. Es gibt sogar Sozialleistungen, die sich mit steigendem Einkommen erhöhen, weil sie als (vorübergehende) Lohnersatzleistungen gedacht sind, z.B. Eltern- geld.
Das derzeitige Grundsicherungssystem gliedert sich somit in zwei Teile. Beide sind alles andere als ein BGE. Zum einen wird nicht das SE, sondern nur das physische Existenzminimum gesichert. Ein Vermögensaufbau soll nicht möglich sein. Diese Einkommen sind nachrangig nach anderen Quellen. Hierzu zählen selbstverdiente Einkommen, aber auch andere Transferleistungen (lediglich bestimmte Leistungen wie z.B. Opferentschädigungsrenten sind ausgenommen). Es findet also eine Bedürftigkeitsprüfung statt. Der Anreiz, durch eigene Anstrengung die Bedürftigkeit abzuwenden, hat hier oberste Priorität. Dadurch entsteht aber auch eine Transferentzugsrate von 100% und somit kaum ein Anreiz, anderes Einkommen zu erzielen.
Die beiden Grundsicherungen unterscheiden in einem Punkt. Während das SGB II (Hartz IV) zusätzliche „Mitwirkungspflichten“, wie das aktive Bemühen um die Ver- wertung der eigenen Arbeitskraft und somit eine Arbeitspflicht auch für Tätigkeiten unterhalb des eigenen Qualifikationsniveaus (Arbeit um jeden Preis) einfordert (ansons- ten drohen Sanktionen in Form von Kürzungen um bis zu 100%), entfällt diese Bedin- gung beim SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und Alter). Dafür ist die Schonvermögensgrenze hier deutlich niedriger (2600€ einschließlich eige- nem Auto und kleineres „angemessenes Hausgrundstück“!). Zu beachten ist hierbei, dass es nicht nur einen festen Betrag (Regelsatz) gibt, sondern bedarfsabhängige Extra- zahlungen wie Heizkosten, Miete, Kommunalabgaben, Rundfunk-, Abwasser- und Krankenversicherungsbeiträge sowie weitere notwendige Versicherungsbeiträge). Dazu kommen Mehrbedarfszahlungen für Personen in besonderen Lebenslagen.
Die mit den Hartz-IV-Leistungen verbundene Arbeitspflicht ist ein Anreiz-Ersatz für die sehr hohen Transferentzugsraten. Außerdem wird die Transferentzugsrate auf Arbeitseinkommen etwas abgesenkt durch „Hinzuverdienstmöglichkeiten“.
Tabelle 1: Transferentzugsraten gemäß § 30 SGBII32
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben den umfangreichen Bedürftigkeitsprüfungen und der Arbeitspflicht (nur Hartz IV) ist die Vermögensverwertung eine weitere Bedingung. Auch Vermögen und Einkommen anderer zur sogenannten Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen sind vom Staat dazu bestimmt, vorrangig verbraucht zu werden. Ausgenommen ist nur ein bestimmtes „Schonvermögen“. Hierdurch wird auch in die Selbstbestimmung anderer Wirtschaftssubjekte eingegriffen, was nicht nur rechtlich und menschlich problematisch ist, sondern auch zu Allokationsverzerrungen führen kann, wenn sich dies auf die Bildung von Bedarfsgemeinschaften auswirkt.
Ein weiteres Problem ist die geringe Höhe der Leistungen nach SGB II, welche nur das Existenzminimum, aber nicht das SE absichern.
Es gibt weitere versteckte Anreize zur Arbeitsaufnahme, z.B. eine Versicherungspauschale von 30 € / Monat, welche die 100 € Freibetrag der Arbeitseinkommensanrechnung auf den Transferbezug zweckgebunden erhöht.
2.3.2 Negative Einkommensteuer
Die negative Einkommensteuer wurde von Antoine Augustin Cournot und Abba Lerner erfunden und funktioniert so33:
Es werden ein Freibetrag und ein SE bzw. ein normales Existenzminimum definiert. Verdient jemand mehr als den Freibetrag, so zahlt er ganz normal Steuern. Verdient er weniger als den Freibetrag, so zahlt er nicht nur keine Steuern, sondern bekommt etwas ausgezahlt (negative Steuer). Im Maximalfall (jemand verdient nichts), bekommt er einen Betrag in Höhe des Existenzminimums ausgezahlt. Der Auszahlungsbetrag fällt bei einem konstanten Steuersatz proportional zum steigenden Einkommen. Ist der Frei- betrag gleich dem Existenzminimum, so wird das verdiente Einkommen 1:1 wegge- steuert. Der Steuersatz auf das verdiente Einkommen bzw. die Transferentzugsrate be- tragen 100%. Sollen die Steuer bzw. die Transferentzugsrate kleiner 100% sein, so muss gelten:
Freibetrag > („sozioökonomischen“) Existenzminimum
Wenn wirklich das SE gesichert werden soll, so besteht die Steuerpflicht erst für Verdiener, die mehr als das SE verdienen. Dies soll den Arbeitsanreiz erhöhen bzw. den monetären Arbeitsanreiz ermöglichen. Das verfügbare Einkommen (Yv) ergibt sich aus der Summe des besteuerten (Steuersatz=t) selbstverdienten Einkommens (YA) und dem garantierten Existenzminimum (G).
Für das verfügbare Einkommen gilt34:
Y=G - t YA + YA = G + (1 - t) YA
Folgende Grafik verdeutlicht das Ganze noch einmal:
Abbildung 1 Wirkungsweise der negativen Einkommenssteuer35
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Arbeitseinkommen, negative Steuer, positive Steuer und verfügbares Einkommen im Falle eines Mindesteinkommens von 800 Euro, eines negativen Steuersatzes von 50 Prozent und eines positiven Steuersatzes von 50 Prozent.
Es handelt sich hierbei nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, da die Auszahlung ja durch das selbstverdiente Einkommen bedingt ist. Das Ergebnis der negativen Einkommenssteuer ist jedoch vergleichbar mit dem BGE, sofern es mit einer umverteilenden Steuer auf selbstverdientes Einkommen einhergeht. Dieses Modell ist im Wesentlichen durch den sozialliberalen Diskurs geprägt.
2.3.3 Modell Solidarisches Bürgergeld von Dieter Althaus
Der frühere thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus hat folgendes Konzept vor- gestellt:
Kasten 1: Das Konzept des Solidarischen Bürgergeldes von Dieter Althaus36
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses ebenfalls dem sozialliberalen Diskurs folgende Modell gewährt ein Grundein- kommen mit dem Ziel, das „sozioökonomische Existenzminimum“ zu sichern. Es wird jedoch nicht einheitlich gewährt, sondern in der Höhe des in Abhängigkeit vom Lebens- alter (Volljährigkeit/Minderjährigkeit) differierenden „sozioökonomischen Existenzmi- nimums“. Bedingungslos ist es nicht, da es mit steigendem Einkommen schrittweise reduziert wird und somit eine Bedürftigkeitsprüfung erfolgt. Hinzu kommt ein eben- falls nur für einen Teil der Bevölkerung, nämlich den über 67-Jährigen, eine Transfer- zahlung, welche jedoch nicht bedingungslos ist, sondern von einem früheren Erwerbs- einkommen abhängig sein soll, jedoch keine speziellen Beitragszahlungen, wie z. B. Rentenbeiträge, voraussetzt. Dies ist aber in der Höhe ebenfalls auf den Betrag des be- dingungslosen Grundeinkommens beschränkt, da freiwillige Zusatzrenten, welche am Markt erworben werden können, möglich sind. Diese Zusatzzahlung stellt auch ein Grundeinkommen dar. Die Finanzierung soll aus der Besteuerung höherer am Markt verdienter Einkommen und aus einer Lohnsummensteuer, welche der Arbeitgeber zu bezahlen hat, erfolgen. Zusätzlich wären noch bedarfsabhängige soziale Zusatzleistun- gen geplant. Es soll außerdem einen für alle Personen einheitlichen gebundenen Transfer (in Höhe von 200€) für Pflege- und Gesundheitsleistungen geben, der dann wiederum bedingungslos ist. Vermögen wird offenbar in keinem Falle angerechnet, so dass sämtliche Leistungen in Bezug auf Vermögen bedingungslos sind.37
2.3.4 Modell des Grundeinkommens vom HWWI (Hohenleitner/Straubhaar)
Das HWWI-Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens entspringt dem neolibe- ralen Diskurs und soll eine Lösung für die derzeit stark in die Krise geratenen sozialen Sicherungssysteme darstellen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen soll dabei alle personengebundenen Abgaben und Transfers zu einem steuerbasierten universellen Umverteilungsinstrument zusammenfassen und damit die Umverteilung transparenter machen38. Auch sollen dadurch die Lohnnebenkosten, welche den Faktor Arbeit belas- ten, sowie die Regulierungen des Arbeitsmarktes (Mindestlöhne, Kündigungsschutz) entfallen. So sollen der gesamte Arbeitsmarkt effizienter gestaltet und Allokationsver- zerrungen verhindert werden. Das Ganze wird als eine Steuerreform angesehen. Ein Rückgang der Steuerzahlenden wird nicht erwartet.
Grundsätzlich wird die Zahlung eines Einkommens als Antwort auf die gesellschaftli- chen Wandlungen gerechtfertigt, weil die traditionellen Familienformen und Erwerbs- biografien mit lebenslanger Beschäftigung immer seltener werden39. Die gesicherte Existenz soll zu erhöhter Akzeptanz von unabdingbaren Veränderungen führen; diese werden eher als Chance denn als Risiko gesehen. Ferner soll die Kontrollbürokratie abgebaut werden. Das Grundeinkommen soll bedingungslos, also ohne Gegenleistung gewährt werden.
Die Rechtfertigung eines Grundeinkommens besteht vor allem darin, dass die derzeit gewährten Systeme im Prinzip schon ähnlich funktionierten, aber ineffizienter seien. Die Finanzierung soll über die Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgen. Beide sollen einen konstanten Steuersatz von 50% erhalten. Da selbstverdientes Einkommen von der ersten Einheit an versteuert wird, ersetzt das Grundeinkommen den Freibetrag. Es soll mit der Steuerschuld verrechnet werden. Somit entstehen, wenn das Grundeinkommen größer ist als die Steuerschuld, Nettoempfänger, anderenfalls Nettozahler. Das BGE sorgt für eine indirekte Progression, so dass geringer verdienende Personen eine stärke- re Nettozahlung bekommen als besserverdienende. Entsprechend zahlen schlechter verdienende Nettozahler weniger Steuern als besser verdienende.40
Die Höhe des BGE soll das „soziokulturelle Existenzminimum“ sichern, wird aber konkret nicht bestimmt. Es gibt lediglich einen Orientierungswert an bereits gezahlten Sozialleistungen.
Das Modell hat unterschiedliche Untervarianten, welche zum Teil keine bedarfsgerechten Zahlungen für Menschen in besonderen Lebenslagen vorsehen.
Kasten 2: idealtypische Grundpfeiler eines BGE nach dem HWWI-Modell41
Idealtypische Grundpfeiler eines BGE nach dem HWWI-Modell
- Der Staat lässt allen Staatsangehörigen lebenslang eine auf der Höhe des soziokulturellen Existenzmi- nimums liegende Transferzahlung zukommen. Das Grundeinkommen wird ohne Bedingung, ohne Ge- genleistung, ohne Antrag und damit ohne bürokratischen Aufwand als sozialpolitischer Universaltrans- fer ausbezahlt.
- In das Grundeinkommenssystem werden alle deutschen Staatsangehörigen sowie Ausländer in Abhän- gigkeit von ihrer Aufenthaltsdauer einbezogen. Ausländer bekommen pro Jahr der legalen Anwesenheit in Deutschland 10 % des Grundeinkommens, so dass sie nach zehn Jahren das volle Grundeinkommen erhalten. Im Ausland lebende deutsche Staatsbürger behalten ihren Anspruch auf das Grundeinkommen.
- Die Höhe des Grundeinkommens bleibt letztlich eine politische Entscheidung. Dabei gilt der einfache Zusammenhang: Hohe Grundeinkommen bedingen hohe Steuersätze, niedrige Grundeinkommen er- möglichen tiefe Steuersätze. Eine Orientierung für die Höhe der Transferzahlung könnte das bereits heute zur Umverteilung genutzte Sozialbudget bieten. Legt man die im Jahr 2004 erfolgten direkten Sozialleistungen zugrunde, ergäbe dies ein Grundeinkommen von 7505 € jährlich beziehungsweise 625 € monatlich pro Person. Würde man das gesamte Sozialbudget 2004 zugrunde legen, ergäbe sich ein Grundeinkommen von 8405 € jährlich beziehungsweise 700 € monatlich.
- Das Grundeinkommen wird aus dem allgemeinen Staatshaushalt über direkte und indirekte Steuern finanziert (Einkommen- und Konsumsteuern).
- Das Grundeinkommen erhalten alle steuerfrei - unabhängig von weiteren Einkommen. Zusätzliches Einkommen wird vom ersten bis zum letzten Euro an der Quelle erfasst und mit einem einheitlichen und gleich bleibenden Steuersatz belastet. Eine Steuererklärung muss nur noch von jenen ausgefüllt werden, die gegen entsprechende Belege Werbungskosten geltend machen wollen. Dabei gibt es keine expliziten Steuerfreibeträge, denn das Grundeinkommen wirkt bereits als Freibetrag.
- Im Gegenzug werden nahezu alle steuer- und abgabenfinanzierten Sozialleistungen durch das Grundeinkommen ersetzt: Gesetzliche Renten-, Arbeitslosen- oder Pflegeversicherung werden genauso durch das Grundeinkommen ersetzt wie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohn- und Kindergeld.
- Die heute zu leistenden Abgaben an die Sozialversicherungen entfallen damit vollständig. Entsprechend sinken die Lohnnebenkosten.
- Für Kranken- und Unfallversicherung gibt es eine Grundversicherungspflicht. Der notwendige Beitrag ist mit dem Grundeinkommen zu verrechnen oder dazu zu addieren und als Versicherungsgutschein auszugeben. Dieser Gutschein kann bei jeder Kranken- beziehungsweise Unfallversicherung für eine Grundversicherung eingelöst werden. Für die Versicherer besteht Diskriminierungsverbot und Kontrahierungszwang.
- Ebenso werden alle sozialpolitisch motivierten Regulierungen des Arbeitsmarktes gestrichen. Es gibt keinen Kündigungsschutz mehr, dafür aber betrieblich zu vereinbarende Abfindungsregeln (siehe dazu das Modell des „Hamburger Dreisprungs“. Es gibt keinen Flächentarifvertrag mehr und keine Mindest- löhne, sondern von Betrieb zu Betrieb frei verhandelbare Löhne. Es gibt keine Sozialklauseln.42
2.3.5 Modell von Götz Werner
Der Unternehmer und Gründer der Drogerie-Handelskette „dm“ ist ein vehementer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Auch er folgt dem neoliberalen Diskurs. Jedoch lassen sich auch Elemente von anderen Diskursen erkennen. Zwar soll alles abgeschafft werden, was Arbeit behindert. Dazu zählen Regulierungen des Ar- beitsmarktes, aber auch die Befreiung von Besteuerung. Deshalb plädiert er für die Um- stellung des Steuersystems auf ein reines Umsatzsteuersystem, das einen einheitlichen Steuersatz von bis zu 50% vorsieht. Auch andere Steuern (Gewerbesteuer, Körper- schaftsteuer und Sozialabgaben) sollen entfallen. Werner sieht jedoch im Entzug eines Existenzgeldes eine Verletzung der Menschenwürde - auch bei Arbeitsverweigerung. Menschen sind für ihn Wesen, die gerne und freiwillig und dadurch auch produktiv ar- beiten, wenn man sie lässt. Die Befreiung von Existenzsicherungssorgen und der (rech- tlichen) Bedrohung von Existenz sei nicht nur ein Gebot der Menschenwürde, sondern eine notwendige Voraussetzung, um arbeiten zu können. Das BGE wird damit gerech- tfertigt, dass Menschen ein Einkommen brauchen, um zu leben und auch um zu arbei- ten.
Das Konzept ist ähnlich dem des HWWI, nur ist es nicht so ausführlich ausgestaltet. Der wesentliche Unterschied zum HWWI-Modell ist die zwingende Umstellung auf eine Umsatzsteuerfinanzierung und eine in jedem Falle bedarfsgerechte Ergänzung der staatlichen Förderung für Menschen in besonderen Lebenslagen.
Die Grundidee ist, dass nicht gearbeitet werden muss, um Einkommen zu erzielen, sondern dass es eines Einkommens bedarf, um zu arbeiten.
Das Konzept lässt sich so interpretieren:
Ein Einkommen, das vom Staat garantiert wird, ist eine Investition in den Faktor Arbeit. Diese Investition lohnt sich für den Staat, da die Menschen durch freiwillige Arbeit, also nicht durch Bedrohung ihrer Existenz hierzu motiviert, sinnvoller eingesetzt wer- den können. Mit dem Konzept wird eine Effizienzsteigerung intendiert, da der Faktor Arbeit nicht um jeden Preis für „unsinnige Arbeit“ verschwendet wird. Um das Modell flexibel der Realität anpassen zu können, schlägt Götz Werner eine schrittweise Umsetzung vor, vor allem bei der Umsatzsteuererhöhung.43
2.3.6 Das Transfergrenzen-Modell (Pelzer/Fischer)
Das Transfergrenzen-Modell ist im Grunde genommen nur eine Ergänzung zu der For- derung nach einem BGE von Götz Werner (aber auch anderen vergleichbaren Model- len) und als Antwort auf die durch das Ulmer Modell (so eine Bezeichnung für das Transfergrenzen-Modell von Helmut Pelzer, welches schon 1998 veröffentlicht wurde und laufend aktualisiert wird)44 von hervorgerufene Kritik gedacht. Dem eher sozialli- beralen Diskurs folgend untersucht es eher die Finanzierung und soll deshalb auch im Kapitel 4 (Finanzierung des BGE) diskutiert werden. Hier nur die Darstellung:
Grundidee ist die Finanzierung des BGE über eine Basissteuer, welche auf alle Ein- kommen mit Ausnahme des BGE erhoben wird. Diese Basissteuer bzw. Sozialabgabe (S) soll proportional mit dem Einkommen steigen. Sobald die Basissteuer (S) gleich dem BGE ist, wird die Transfergrenze (TG) erreicht. Vor Erreichen ist das BGE größer als der Basissteuerbetrag (Nettoempfänger), nach Erreichen ist das BGE kleiner (Netto- zahler). Die Basisteuer (S) lässt sich auch in % des Bruttoeinkommens (X) ausdrücken:
(1) S = BGE*100/X.
Das verfügbare Nettoeinkommen eines Bürgers (Y) ergibt sich unter Einbeziehung der zweckungebundenen normalen Einkommensteuer auf das zu versteuernde Einkommen
(E) wie folgt:
(2) Y=X-X*S/100-E+BGE=(1-S/100)*X-E+BGE
Wenn die Basissteuer gleich dem BGE ist, dann gilt in Abwandlung von (1):
(3) S = BGE*100/X. => X = BGE*100/S = TG
Also ist die Transfergrenze damit errechnet.
Je geringer die Transfergrenze ist, desto mehr Nettozahler gibt es, was die Finanzierung wahrscheinlicher macht. Die Transfergrenze absenken kann man durch ein niedriges BGE oder durch ein großes S, was wiederum zu hohen Transferentzugsraten führt, also das selbst verdiente Einkommen stark belastet. Damit die Nettozahler nicht zu stark belastet werden, sollen zwei verschiedene Abgabensätze für die Basissteuer erhoben werden: SI und SII, wobei gilt: SI > SII. SI gilt bis zur Transfergrenze, SII danach. SI soll deswegen hoch sein, damit gemäß Gleichung (3) die Transfergrenze niedrig ist und es wenig Nettoempfänger (Ne) mit Summe der Einkommen (Ve), aber viele Nettozahler
(Nz) mit Summe der Einkommen (Vz) gibt. Die Höhe des Abgabensatzes SII errechnet sich bei gegebenen SI:
S II = (Ne * BGE * 12 - Ve * S I / 100) * 100 / Vz + BGE * 100 / X
S II = S II + S II
S II = (Ne * BGE * 12 - Ve * S I / 100) * 100 / Vz
(=Deckung der saldierten Kosten des BGE bis zur Transfergrenze, konstant als Prozentsatz über alle Einkommen oberhalb der Transfergrenze, zunehmender Geldbetrag mit zunehmendem Einkommen)
S II = BGE * 100 / X
(=Deckung der Kosten ab der Transfergrenze, regressiver Verlauf, derselbe Geldbetrag für alle Einkommen)
Dieses Modell lässt sich noch weiter differenzieren, unter anderem mit progressiver Besteuerung und unterschiedlichen Abgabensätzen für verschiedene Gruppen.45
2.3.7 Ausgewählte weitere Konzepte (Kurzdarstellung)
Weitere Konzepte sind:
Grüne Grundsicherung (Poreski /Emmler)
Sanktionsfreie Mindestsicherung (Linkspartei) Modell der katholischen Arbeiterbewegung Liberales Bürgergeld
Solidarisches Grundeinkommen (BGE der Piratenpartei)
Diese Konzepte sollen mit den zuvor ausführlicher dargestellten in einer Tabelle verglichen werden.
Die Tabelle gibt einen groben Überblick, Details lassen sich der zugrundegelegten Lite- ratur entnehmen. Insbesondere die €-Beträge weichen innerhalb der Modelle in den ver- schiedenen Quellen voneinander ab, so dass es sich nicht lohnt, darauf weiter einzuge- hen, zumal die Geldgrößen ohnehin einer ständigen Wandlung unterworfen sind. Viel- mehr geht es darum, die Grundrichtung der Modelle zu kennzeichnen und allenfalls die relativen Größen, also Verhältnisse vom BGE zum ü brigen Einkommen zu betrachten. Schon jetzt lässt sich sagen, dass es verschiedene Ansichten gibt und man sie nicht im- mer eindeutig einem Diskurs zuordnen kann. Auch lassen sich durchaus Ziele verschie- dener Diskurse vereinbaren. Wenn das BGE richtig ausgestaltet ist, werden auch Ziele verschiedener Diskurse erreicht, so dass anstelle eines Streits der Diskurse lieber aus diesen Konzepten eine Grundrichtung abgelesen werden sollte, die konsensfähig ist.
Zur übersichtlicheren Darstellung werden die vorgestellten und kurzdargestellten Modelle wie folgt nummeriert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Grundeinkommenskonzepte im Vergleich46 47
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* Die Rechtfertigungen des BGE passen auch in einen sozial-egalitären Diskurs
2.4 Zielsetzungen und Funktionsweise
Als Zusammenfassung der verschiedenen Diskurse und der vorgestellten Modelle, die ein echtes BGE (Sozialdividende ohne Bedürftigkeitsprüfung und Arbeitsbereitschafts- pflicht) vorschlagen, sollen nun die Ziele (Anforderungen an ein BGE) dargestellt wer- den.
Mit dem Grundeinkommen werden drei Ziele verfolgt:
1. eine Sicherstellung des sozio-ökonomischen Existenzminimums (SE) für jeden unabhängig von seiner Produktivität
2. eine Entbürokratisierung der Transfergewährung
3. die Verhinderung einer Armutsfalle
Unter dem Begriff „Armutsfalle“ ist zu verstehen, dass Menschen über ein bestimmtes Einkommensniveau auch durch eigene Anstrengungen nicht hinauskommen, solange ihnen staatliche Hilfen gewährt werden.
Das in Deutschland existierende Sozialleistungssystem, das alles andere als ein BGE ist, rechnet fast jedes Einkommen, das dem Empfänger von Sozialleistun- gen aus eigenen oder anderen Quellen zur Verfügung steht, 1:1 an. Somit gibt es eine Transferentzugsrate von 100%. Lediglich ganz spezielle Renten, wie Op- ferentschädigungsrenten und selbst verdientes Einkommen bis zu einer be- stimmten Grenze (z.Zt. 100 €) sind davon freigestellt. Darüber hinaus verdientes Einkommen wird bis zu einer weiteren Grenze zum Teil bedarfsabhängig zu 80 bzw. 90 % angerechnet.
Dadurch wird der Anreiz, etwas dazuzuverdienen (sei es durch Angebot der Arbeitskraft oder aber auch durch Bereitstellung von Kapital), verhindert bzw. stark eingeschränkt.
Zum Teil soll durch das BGE auch ein 4. Ziel erreicht werden, das ggf. als eine Erweite- rung des Ziels 1 gesehen werden kann, nämlich die Entkoppelung von Existenzsiche- rung und Arbeit (auch als Entkoppelung von Einkommen und Arbeit bezeichnet). Die- ses Ziel ist vor allem Bestandteil des emanzipatorischen Diskurses. Es lässt sich darüber diskutieren, ob es ein eigenständiges Ziel ist oder eine notwendige Folge der drei ande- ren Ziele.
Zwischen diesen Zielen gibt es erhebliche Zielkonflikte. Diese sollen im nächsten Kapitel näher untersucht werden.48
Wie wird eine dynamische Sicherstellung des sozio-ökonomischen Existenzminimums erreicht? Zum einen wäre es durch eine regelmäßige Anpassung (in der Regel Erhö- hung) möglich, zum anderen durch Gewähren von Naturalleistungen. Im letzten Fall bestehen Probleme zu bestimmen, welche Leistungen das sein sollen, diese von ähnli- chen, aber nicht gewährten Leistungen abzugrenzen und einer möglichen Ineffizienz ungebundener Transfers. Aber auch im Falle der Naturalleistungen wären Anpassungen im Laufe der Zeit notwendig, da es immer wieder neuartige Güter und Dienstleistungen gibt.
Die Befürworter eines BGE beschreiben die Funktionsweise gerne in der Form, dass alle gewünschten Ziele mit der Einführung des BGE automatisch eintreten. Dieses klingt oft mehr nach einer Wunschvorstellung als nach einer wirklichen Analyse und Schlussfolgerung.
Funktionsweise:
Die Idealvorstellung ist, dass das BGE ist ein stets die Grundlasten des Lebens deckender Sockelbetrag sein soll, welcher durch eigene Leistungen - insbesondere Arbeitsleistungen - ergänzt wird.
Die Finanzierung des BGE soll über eine Einkommensteuer von 50% erfolgen.
Folgende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang zwischen BGE (Sozialdividende), Steuern und Arbeitseinkommen. Beim Arbeitseinkommen handelt es sich um das Net- toeinkommen. Das Bruttoeinkommen ergibt sich aus dem jeweiligen Arbeitseinkommen und dem jeweiligem Steuerbetrag. Da der Steuerbetrag 50% vom (Brutto-) Arbeitsein- kommen beträgt, gilt: Bruttoarbeitseinkommen = 2 x (Netto-)Arbeitseinkommen.
Das verfügbare Einkommen ist dann das BGE + Nettoarbeitseinkommen bzw.
„verfügbares Einkommen“ = „Sozialdividende“ + „Arbeitseinkommen“
Abbildung 2: Idealtypische Wirkungsweise des BGE anhand der Wirkungsweise einer Sozialdividende49
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses idealtypische und einfache Modell des BGE erfüllt zumindest Ziel 3 (Vermei- dung der Armutsfalle). Es dürfte ebenfalls Ziel 2 (Entbürokratisierung) erreichen. Frag- lich ist nur, ob das SE erreicht wird (Ziel 1) und dauerhaft erreicht werden kann. Dazu ist nicht alleine die einmalige Festlegung des SE in Form der BGE-Höhe erforderlich, sondern eine ständige wirksame Anpassung. Ob das gelingen kann, soll im nächsten Kapitel untersucht werden.
Als praktisches Beispiel dafür, dass ein BGE funktioniert, kann einmal mehr die Fami- lie dienen. Nimmt man die Kinder als Bürger, welche mit dem Taschengeld (=Regelsatz) und dem Unterhaltsanspruch gegen die Eltern, welche man mit dem Staat vergleichen kann, (=Kosten der Unterkunft + evtl. Mehrbedarf in Naturalien geleistet) eine Art Grundeinkommen erhalten, das durchaus auf dem SE-Niveau, zumeist sogar weit darüber liegt, so hat man ein anschauliches Beispiel für das Funktionieren eines BGE . (Ausnahmen gibt es nur, wenn die Eltern selbst finanzielle Probleme haben). Die- ses Grundeinkommen wird nun auch noch bedingungslos gewährt, da weder Taschen- geld, noch Vermögen, noch der Unterhaltsanspruch von den Eltern gekürzt werden (dürfen), wenn sich die Kinder etwas hinzuverdienen. Dieses „BGE“ der Eltern wird auch meistens nicht an Arbeitsgegenleistungen im Haushalt gebunden. Seitens des Staa- tes wird das durch die einkommensunabhängige Kindergeldzahlung und andere Ver- günstigungen auch der Form nach unterstützt.
Dieses Familienmodell braucht einfach nur auf die gesamte Gesellschaft übertragen zu werden.
3. Ökonomische Auswirkungen
Die im vorigen Kapitel genannten Ziele eines bedingungslosen Grundeinkommens sind zum Teil nicht miteinander vereinbar. Während Befürworter oft nur auf die kongruenten Teile eingehen bzw. alle wünschenswerten Ziele wie auf einem Wunschzettel als natür- liche Folge beschreiben, sehen Kritiker eher die möglichen Konflikte zwischen den Zie- len.
3.1 Auswirkungen auf Märkte
Würde das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich eingeführt, so würde neben den zunächst gewünschten Folgen dann eine Anpassung auf den Märkten stattfinden. Neben den in der Literatur hauptsächlich kritisierten (negativen) Auswirkungen auf das Arbeitsangebot hat es, je nachdem, wie man es ausgestaltet, auch Auswirkungen auf das Preisniveau und somit die Geldwertstabilität. Aber auch auf den Kapitalmarkt kann es Auswirkungen haben.
3.1.1 Auswirkungen auf die Geldwertstabilität
Wenn das bedingungslose Grundeinkommen ohne weitere Maßnahmen, also auch ohne Umverteilung durch steuerliche Belastung, jedem gewährt würde, so wären alle um den Betrag dieses bedingungslosen Grundeinkommens reicher. Dadurch würde die Kaufk- raft entsprechend steigen. Die angebotenen Güter und Dienstleistungen blieben, sofern keine weiteren Anpassungen eintreten, jedoch in Menge und Zusammensetzung gleich. Nun würde die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Kaufkraft durch das BGE anstei- gen. Das gilt selbst dann, wenn nur diejenigen mehr nachfragen, die durch das BGE erst das sozioökonomische Existenzminimum erreichen. Existierte vor Einführung des BGE ein Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, so existiert nun nach Einfüh- rung des BGE ein Nachfrageüberschuss. Infolgedessen würde das Preisniveau anstei- gen. Es kann lediglich zu Verschiebungen der relativen Preise führen, da Menschen mit geringerem Einkommen andere Güter nachfragen als Menschen mit höherem Einkom- men, und durch die Existenz von inferioren Gütern. Durch den Preisniveauanstieg sinkt jedoch das Realeinkommen auf das ursprüngliche Niveau zurück. Die Einkommensun- terschiede blieben so erhalten, wie sie sind. Außer einer Inflation wäre nichts erreicht worden. Lediglich das Nominaleinkommen wäre gestiegen. Somit wäre das 1. Ziel des BGE („eine Sicherstellung des sozio-ökonomischen Existenzminimums“, vgl. Kapitel
2.4) nicht erreicht. Zwar laufen die Anpassungsprozesse in der Praxis über einen gewissen Zeitraum ab, so dass es kurzfristig erst einmal gewisse Verbesserungen für die Konsumenten geben könnte, sofern nicht schon die Ankündigung der Einführung eines BGE einen Preisanstieg auslösen würde. Dafür jedoch würden die Inhaber von Geldvermögen einen dauerhaften Verlust durch die Entwertung ihres Kapitals erleiden, was möglicherweise durch einen Zinsanstieg wieder abgemildert würde.
Folgende selbsterstellte Abbildung soll die Wirkungsweise verdeutlichen, wenn ein BGE als Sozialdividende ohne umverteilende Wirkung unter den Konsumenten, aber mit Belastung der Produzenten zwecks Finanzierung ausgezahlt wird
Abbildung 3: Wirkungsweise einer Sozialdividende ohne Einkommensumverteilung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Legende:
PM = Mindestpreis, zu dem ein Angebot existiert.
PpN# = Prohibitivpreis der Nachfragefunktion N#
PGN# = Gleichgewichtspreis bei Nachfragefunktion N#
PGA# = Gleichgewichtspreis bei Angebotsfunktion A#
X = Anzahl der produzierten Warenkörbe, welche das SE decken
XGN# = Gleichgewichtsmenge (Angebot = Nachfrage) unter der Nachfragefunktion N# XS = Sättigungsmenge (= Anzahl der in der Gesellschaft lebenden Personen = XGN3)
Zur Erklärung:
Im Ausgangszustand gibt es kein BGE. Die Abbildung zeigt auf der Abszisse die mit X bezeichnete Anzahl an Warenkörben, welche das SE darstellen. Der Preis wird auf der Ordinate abgetragen. Die Angebotsfunktionen A1 bis A3 stellen typische Angebotsfunk- tionen mit steigenden Grenzkosten (sinkenden Skalenerträgen) dar. Es gibt einen Min- destpreis PM, der für ein Angebot erforderlich ist. (PM gilt für A1 und verschiebt sich entsprechend mit A2 und A3. Das wurde in der Zeichnung vernachlässigt, da es neben- sächlich ist). Im Ausgangszustand gilt A1 und N1. In ihrem Schnittpunkt (XGN1, PGN1) befindet sich das Marktgleichgewicht, welches die Höhe des SE (PGN1) und die Anzahl der Personen, die sich ein SE leisten können (XGN1) bestimmt. Bei der Menge Xs wären alle Personen versorgt. Wir haben also Xs - XGN1 in Armut lebende Personen. Durch die Gewährung eines BGE in Höhe von PGN1, was genau das SE decken würde, verschiebt sich die Nachfrage von N1 auf N2. Das bedeutet, dass sich jetzt XGN2 Personen ein SE leisten können. Es steigen aber auch die Kosten der Produktion und der Preis des SE steigt auf PGN2. Darum können noch nicht alle Personen sich ein SE leisten. Es gibt eine kleinere aber positive Menge, welche in Armut lebt (Xs - XGN2). Nun müsste also das BGE erhöht werden auf PGN3, damit alle versorgt wären. Die Anzahl XGN2 - XGN1 wäre jedoch jetzt schon bessergestellt, wenn nicht noch weitere Effekte eintreten würden. Da das BGE ja auch finanziert werden muss und zur Finanzierung der Produktionssektor herangezogen werden muss, wenn die Konsumenten alle bessergestellt werden sollen, belastet es die Produzenten in der Höhe des BGE; somit verschiebt sich die Angebots- funktion von A1 auf A2 (bei PGN2) bzw. A3 (bei PGN3), womit der Preis auf PGA2 bzw.
PGA3 steigen würde. Damit wäre dann das Marktgleichgewicht wieder bei der Ausgangsmenge XGN1, nur zu einem deutlich höheren Preis und es könnten sich nur diejenigen das SE leisten, die es ohne BGE auch konnten.
Daraus folgt zwingend, dass das BGE eine (unter den Konsumenten) umverteilende Wirkung haben muss, wenn es eine soziale Wirkung (Sicherstellung des SE für jeden) haben soll, es sei denn, das BGE würde in Naturalien gezahlt oder es würden von außerhalb der betrachteten Volkswirtschaft Geschenke importiert.
Soll das BGE nun doch eine Wirkung zeigen, muss es dafür sorgen, dass die Bezieher niedriger oder ohne Einkommen dauerhaft einen Vorteil erhalten und das „sozioökono- mische Existenzminimum“ sichern. Es muss nicht nur einen absolutes Mehreinkommen geben, sondern entweder auch ein zusätzliches Angebot an Gütern und Dienstleistungen kostenlos bereitgestellt werden oder ein relatives Mehreinkommen im Vergleich zu den Beziehern von (höheren) Einkommen gewährleistet sein. Also müsste das BGE allein dadurch, dass es finanziert werden muss, eine umverteilende Wirkung erzielen. Von einer bloßen Erhöhung der Geldmenge abgesehen, ergibt sich zum Zweck der Umver- teilung die Möglichkeit, das über das BGE hinausgehende, selbst erworbene Einkom- men entsprechend stark zu besteuern (mit theoretisch maximal 100%). Dies wirkt sich negativ auf die Anreize aus, Geld hinzuzuverdienen. Damit würde das 3. Ziel des BGE („eine Armutsfalle zu verhindern“, vgl. Kapitel 2.4) nicht erreicht. Das gleiche würde gelten, falls man das BGE auf das selbst verdiente Einkommen anrechnen würde. In diesem Fall würde auch das 2. Ziel des BGE („eine Entbürokratisierung der Transfer- gewährung“, vgl. Kapitel 2.4) nicht erreicht.
Hieraus kann man schon entnehmen, dass es einen Zielkonflikt (Trade Off) zwischen notwendiger Umverteilung, welche für das Sicherstellen des „sozioökonomischen Exis- tenzminimums“ für alle erforderlich ist, und Bedingungslosigkeit gibt. Die notwendige Bedingung heißt eben stärkere Egalisierung der selbstverdienten Einkommen. Die Be- dingungslosigkeit könnte somit künftig nur noch für das Grundeinkommen gelten. Der Zielkonflikt wird in den Modellen dadurch gelöst, dass Bedingungen an die anderen Einkommen geknüpft und das Grundeinkommen ähnlich wie ein Steuerfreibetrag wirkt.
3.1.2 Auswirkungen auf den Kapitalmarkt
Durch zusätzliches Einkommen wird zunächst zusätzliche Kaufkraft erzeugt. Das führt bei gleichbleibendem Produktionsniveau zu einem erhöhten Preisniveau und somit zu einer Abwertung des Kapitals. Gleichzeitig wird auch weniger Kapital angeboten, da durch höheres Einkommen Kapitalertragsrückgänge substituiert werden und eine alternative Verwendung lukrativer erscheint, insbesondere dann, wenn Kapitalerträge als selbstverdientes Einkommen stärker besteuert werden.
Andererseits steigt durch die Verringerung des Kapitalangebotes der Zinssatz bzw. die Kapitalrendite, was wieder zu einer Erhöhung des Kapitalangebotes führt. Dadurch verteuern sich Kredite und auch Produktionskosten, was zum Teil durch das erhöhte Preisniveau gedeckt wird, aber auch zu einem weiteren Produktionsrückgang und somit zur Verknappung von Gütern und Dienstleistungen führen kann.
Durch erhöhte Zinsen steigt natürlich die Attraktivität des Sparens. Wenn mehr gespart wird, steigt das Kapitalangebot, was wiederum zu einer Zinssenkung führt.
Sofern die Banken den nun niedrigeren Zinssatz an die Kreditnehmer weitergeben, sinken auch die Kreditkosten für Investitionsgüter, also die Kapitaldienstkosten, und somit auch die Produktionskosten, was dann zu einem Produktionsanstieg führt.
Die Abläufe auf dem Kapitalmarkt sind ähnlich wie die im nächsten Abschnitt zu be- handelnden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, der den anderen Produktionsfaktor betrachtet.
Beim Kapitalmarkt sind die Auswirkungen, die durch das BGE hervorgerufen werden, ähnlich denjenigen, die auf dem Arbeitsmarkt hervorgerufen werden. Einerseits besteht die Bereitschaft, sein Kapital risikoreicher anzulegen und somit unternehmerisch mehr zu wagen, da die Existenz ja durch das BGE gesichert ist. Hinzu kommt, dass Kapital und Kapitalerträge nicht für das alltägliche Leben benötigt werden und ein Vermögens- aufbau bzw. Kapitalstockaufbau stattfinden kann. Dies ist auch eine Art Produktivitäts- steigerung, weil nun Kapital für zusätzliche Produktion (für die durch das BGE generie- te Nachfrage) bereitsteht. Auch rein intrinsische Gründe der Kapitalbereitstellung könn- ten nun zum Zuge kommen, da die Kapitalgeber durch das existenzsichernde BGE nicht mehr so sehr gezwungen sind, auf eine hohe Rendite zu achten, sondern Projekte finan- zieren können, von denen sie sich einen direkten, also nicht monetären bzw. handelb- aren Nutzen versprechen, dem sie also vielleicht auch z.B. aus sozialen Gründen zustimmen. Andererseits könnte dem Kapitalmarkt auch weniger Kapital zur Verfügung gestellt werden, da ja die Rendite nicht mehr für die Existenzsicherung erforderlich ist. Auch könnten risikoreiche Investitionen unterbleiben, da ihnen ein sicheres BGE als Alternative gegenübersteht.
Das Pendant zur Vermeidung von menschenunwürdiger Arbeit und Ausbeutung ist hier die Vermeidung des Kapitalverzehrs, des Kapitals, das zur Existenzsicherung genutzt bzw. aufgebraucht werden muss, wenn es keine oder bevor es staatliche Hilfe (z.B. Hartz IV) gibt.
In diesem Punkt würde das BGE eine wichtige Funktion erfüllen, da es notwendiges zur langfristigen Existenz beitragendes Kapital (z.B. Wohneigentum oder Geld, das für die Beschaffung von Energieversorgungsanlagen genutzt werden kann) vor dem kurzfristigen Konsumverzehr schützt.
3.1.3 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Beim Arbeitsmarkt sind die Auswirkungen, die durch das BGE hervorgerufen werden, ähnlich denjenigen auf dem Kapitalmarkt. Die Bereitstellung von Kapital greift aber nicht so tief in die Persönlichkeit des Menschen ein wie die Bereitstellung von Arbeits- kraft. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Großteil der Menschen nicht in der Lage ist, nennenswertes Kapital zur Verfügung zu stellen, wohl aber ihre Arbeitskraft. Vor die- sem Hintergrund sollen die Auswirkungen des BGE auf den Arbeitsmarkt in diesem Abschnitt etwas genauer betrachtet. Werden. Da in der Literatur der zentrale Kritik- punkt am BGE der eventuelle geringere Anreiz zu arbeiten ist, sollen der Produktions- faktor Arbeit und die Auswirkungen des BGE auf die Bereitschaft, diesen Faktor einzu- setzen, hier näher untersucht werden.
In der Literatur50 zum BGE werden verschiedene Reaktionsvarianten als möglich be- trachtet. Genau wie bei der Kapitalbereitstellung kann hier die Änderung des Arbeitsan- gebotes in beide Richtungen erfolgen. Zum einen ist es möglich, durch das BGE eine Regulierung des Arbeitsmarktes zum Schutz der Arbeitnehmer drastisch zu verringern oder ganz entfallen zu lassen, zum anderen könnten Arbeitsanbieter das BGE als Lohnersatzleistung sehen und ihr Angebot verringern.
Durch die Absicherung der Existenz eines Menschen (=sozioökonomisches Existenzminimum) durch das BGE braucht das selbstverdiente Einkommen diese Funktion nicht mehr notwendigerweise zu erfüllen. Somit könnte auf Mindest- und Tariflöhne verzichtet werden. Auch andere Regulierungen des Arbeitsmarktes wären überflüssig, da der Zwang der Anbieter von Arbeitskraft, zur Sicherung ihrer Existenz ihre Arbeitskraft um jeden Preis anbieten zu müssen, nicht mehr vorhanden wäre. Somit hätten die Anbieter von Arbeitskraft mehr Marktmacht und mehr Verhandlungsspielraum.
Ein Niedriglohnsektor, auf dem Geringqualifizierte ihr Geld verdienen können stellt aus diesem Blickwinkel kein Problem dar. Das dort verdiente Geld wäre nur ein zusätzliches Taschengeld, welches für höhere Ansprüche genutzt werden könnte.
In dieser Situation wären dann die Anbieter von Arbeitskraft möglicherweise sehr viel stärker motiviert und wesentlich produktiver, was dem Ertrag von Unternehmen und letzten Endes dem Volkseinkommen zugute käme. Es könnte somit wesentlich kostengünstiger produziert werden, weil der Lohn niedriger und die Produktivität höher wäre. Dieses Phänomen ist ein psychologischer Effekt, der dem Effekt des Arbeitsanreizes für die Existenzsicherung gegenübersteht. Vereinfacht ausgedrückt: Arbeiten die Menschen mehr und besser, wenn sie keine Angst um ihre Existenz haben müssen oder gerade weil sie sonst um ihre Existenz fürchten müssen? Es ist denkbar, dass dies von Wirtschaftssubjekt zu Wirtschaftssubjekt verschieden ist.
Ob und in welcher Form sich das Arbeitsangebot nun verändert, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Menschen können freier eine Arbeitsstelle wählen. Insbesondere können sie Tä- tigkeiten unabhängig von deren Rendite ausüben. Das heißt, sie suchen sich Tätigkeiten, zu denen sie eine intrinsische Motivation haben. Das führt dann bei den gewählten Tätigkeiten zu einer Erhöhung des Arbeitsangebotes und das auch noch bei niedrigeren Löhnen.
Unter dem Gesichtspunkt der reinen Erwerbsarbeit gilt:
- Haben die Menschen ein starkes Konsuminteresse und eine geringe Freizeitprä- ferenz, so verändert sich das Arbeitsangebot kaum, da zwar ein BGE einen Teil der Konsumausgaben abdeckt, aber weiterer Konsum gewünscht wird, für den zu arbeiten ist. Sinkt der Lohnsatz dafür, könnte zum Ausgleich sogar noch mehr gearbeitet werden, damit der Lohn nachher gleich bleibt.
- Haben die Menschen jedoch eine hohe Freizeitpräferenz und einen geringen Konsumbedarf, so sinkt möglicherweise das Arbeitsangebot im Extremfall auf Null, weil sich die Menschen mit dem BGE dann vollständig zufrieden geben und kein weiteres Geld am Arbeitsmarkt erwerben wollen.
In diesem Falle könnte einem sinkenden Arbeitsangebot mit höheren Löhnen am Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden. Somit stiegen die Löhne am Arbeits- markt und auch die Kosten der Produktion. Das wiederum hätte eine Erhöhung der Preise für Güter und Dienstleistungen und damit eine Senkung der Konsum- nachfrage zur Folge. Konsum würde damit teurer oder wäre im Extremfall gar nicht mehr möglich.
Eine Einführung eines BGE würde sich hinsichtlich der beiden erstgenannten Punkte volkswirtschaftlich vorteilhaft auswirken, hinsichtlich des dritten Punktes zunächst ne- gativ.
Eine Verteuerung des Faktors Arbeit und somit eine Verringerung des Arbeitsangebotes muss jedoch nicht nur nachteilige Wirkungen haben. So gibt eine Verteuerung eines Faktors ja auch den Anreiz, ihn durch kostengünstigere Faktoren zu ersetzen.
- So könnte Arbeit zu einem Teil auch durch Kapital substituiert werden (Auto- matisierung).
- Kapital könnte soweit produktiver gestaltet werden, dass weniger Arbeitskraft benötigt wird (Rationalisierung).
- Auch könnte auf manche Tätigkeiten verzichtet werden bzw. sie würden vom Nachfrager selbst durchgeführt, da der Anbieter nun nicht mehr gezwungen wä- re, eine in seinen Augen zu niedrige Ausgleichszahlung für die entgangene Frei- zeit vom Nachfrager annehmen zu müssen, um wenigstens einen Teil seiner Existenz zu sichern.
Hierdurch würde letztlich die volkswirtschaftliche Verschwendung der Ressource Freizeit vermieden.
Häufig wird in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass die „Arbeit ausgehen“ würde. Es gibt aber keine absoluten Grenzen der Menge Arbeit. Die Menge bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage. Lediglich bisherige Strukturen können technisch überholt sein, das heißt, alte Arbeitsplätze fallen weg und neue können entstehen.
Das BGE würde einen Anreiz zu Modernisierung und Innovation geben. Einerseits würden Anbieter ungeliebter Arbeit teurer, so dass ein Anreiz bestände, den Faktor Ar- beit durch Automatisierung, Rationalisierung und Eigenproduktion zu reduzieren oder ihn angemessen zu bezahlen. Andererseits würden neue Arbeitsangebote, welche beim Anbieter sehr beliebt sind (intrinsische Motivation) kostengünstiger werden, da hier nicht hohe Löhne zum Anreiz erforderlich sind. Man kann also sagen, dass das BGE dazu beiträgt, den Arbeitsmarkt von einem Käufermarkt in einen Verkäufermarkt zu verwandeln.
Ein Problem dabei ist jedoch die Bereitstellung von notwendiger Arbeit, die nicht durch Kapital substituierbar ist und auch nicht in Eigenleistung erbracht werden kann. Ein Beispiel ist die Pflege von hilfsbedürftigen Personen ohne Angehörige, die das leisten könnten. Wenn es auch keine Anbieter mit intrinsischer Motivation für diese Tätigkeit gibt und die Nachfrager einen entsprechend hohen Preis nicht zahlen könnten, blieben nur zwei Möglichkeiten:
1. eine steuerfinanzierte entsprechende Bezahlung.
2. eine Dienstpflicht für solche Fälle, wie sie für den ehemaligen Zivildienst als Er- satz für den Wehrdienst gegolten hat. Diese Möglichkeit hat zwar den Nachteil, dass sie Menschen unabhängig von ihrer Produktivität einsetzt und dabei Über- oder Unterqualifizierung in Kauf nimmt, was ja eine Fehlallokation darstellt; da- für aber könnte durch die Gleichbehandlung der Menschen die Abneigung gegen diese Tätigkeit sinken und zur Motivationssteigerung und somit zur Produktivi- tätssteigerung führen.
3. Eine Absenkung der Transferentzugsraten könnte ebenfalls den Arbeitsanreiz steigern, weil hierdurch die sogenannte Armutsfalle entschärft bzw. vermieden würde - je nach Höhe der Transferentzugsrate. Unter der Transferentzugsrate versteht man den Anteil des Transferentzuges pro Einheit selbständig verdienten Einkommens. Da das BGE bedingungslos ist, wird dieser direkte Transfer nicht (auch nicht anteilig) entzogen, es kommt jedoch zu einem indirekten Entzug, da das selbstständig verdiente Einkommen mehr oder weniger stark besteuert wer- den kann und somit die Höhe dieses Markteinkommens (=Bruttoeinkommen) vom Staat durch Steuern verändert, also reduziert werden kann (=Nettoeinkommen). Der Arbeitsanreiz wird natürlich durch das Nettoeinkom- men bestimmt (es sei denn, jemand hat ein persönliches Interesse daran, den Staat zu finanzieren).
Beim BGE ist ja eigentlich das Ziel (3. Ziel: „eine Armutsfalle zu verhindern“, vgl. Kapitel 2.4), möglichst niedrige Transferentzugsraten zu haben. Es gibt zwar nur indirekte Transferentzugsraten, aber diese wirken genauso wie direkte.
An dieser Stelle gibt es wieder ein „magisches Dreieck“, wo wieder drei Bedin- gungen erfüllt sein müssen, zwischen denen es einen Konflikt (Trade off) gibt. Zwei davon sind die Ziele 1 und 3 (vgl. Kapitel 2.4) des BGE. Die dritte Bedin- gung ist die Finanzierbarkeit des BGE. Jeweils zwei Bedingungen lassen sich leicht erfüllen. Die jeweils dritte bleibt aber unberücksichtigt. Die Frage ist, ob es einen Kompromiss gibt, der alle drei Bedingungen ein bisschen, aber jeweils hinreichend erfüllt.
Wird die Transferentzugsrate sehr hoch ansetzt, entsteht eine Armutsfalle (Verletzung von Ziel 3 des BGE). Wird das BGE sehr niedrig angesetzt, besteht die Gefahr, dass es seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllt, ein „sozioökonomisches Existenzminimum“ zu gewährleisten (Verletzung Ziel 1 des BGE). Setzt man das BGE hoch an und dazu geringe Transferentzugsraten, so steigt die Anzahl der Transferempfänger, also der Nettoempfänger weiter an. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Nettozahler. Aus derzeitigen Nettozahlern werden Nettoempfänger. Das stellt möglicherweise die Finanzierbarkeit in Frage.
Die Lösung dieses Zielkonfliktes könnte einerseits in einer geschickten Wahl der Transferentzugsraten liegen (progressiver Anstieg mit zunehmendem am Markt verdienten Einkommen), so dass die Zahl der Nettoempfänger nicht unnö- tig ansteigt, andererseits in alternativen Anreizen zum Arbeitsangebot (intrinsische Motivation, Pflichtdienste).
Häufig wird seitens derjenigen, die eine Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze fordern, auch ein BGE mit der Begründung abgelehnt51, dass die Menschen da- mit „abgespeist“ würden und ein Arbeitsplatz mehr zu bieten habe als Einkom- menserzielung, z. B. „Teilhabe am Leben“. Aber nicht alle Arbeitssuchenden sehen das so. Soweit Arbeitslosigkeit herrscht, was ökonomisch nichts anderes bedeutet als ein Überangebot von Arbeit (also des Produktionsfaktors Arbeit), kann durch Absenken des Preises wieder ein Marktgleichgewicht erreicht wer- den. Damit nicht die gesamte Überschussmenge nachgefragt werden muss und der Preis nicht zu tief sinkt, muss das Arbeitsangebot hinreichend elastisch sein. Wenn aber ein BGE das SE sichert, kann es egal sein, wie tief der Preis sinkt und wie elastisch die Arbeitsangebotsfunktion ist. Personen, die unbedingt arbei- ten möchten, also ein unelastisches Arbeitsangebot haben, bekommen in einem deregulierten Arbeitsmarkt auch ihren Arbeitsplatz wesentlich leichter. Ander- seits lässt sich auf die Regulierung des Arbeitsmarktes nur verzichten, wenn das SE anderweitig abgesichert ist und sozialer Frieden als wünschenswert betrach- tet wird.
Eine Erhöhung der Arbeitsbereitschaft ist volkswirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch entsprechend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das ist nur der Fall, wenn
1. für die Produktion notwendiges Kapital in entsprechender Menge bereitgestellt wird bzw. werden kann und
2. die Mehrproduktion auch abgesetzt werden kann.
Dazu ist u.a. Kaufkraft notwendig. Anderenfalls gibt es nur einen (verschärften) Wett- bewerb um die vorhandenen Arbeitsplätze mit der Folge von Lohndumping. Dem Ziel einer Existenzsicherung wird damit kaum Rechnung getragen - zum einen, weil im Wettbewerb neue Anbieter dazu stoßen und dafür andere ausscheiden, zum anderen weil, sollte es tatsächlich zu mehr Beschäftigung kommen, die gesunkenen Löhne das SE nicht mehr decken und somit weiterhin Sozialleistungen erforderlich sind. Nun steigt möglicherweise das Produktionsniveau an, und die geleistete Arbeit lässt sich verwerten. Ist das nicht der Fall, wie zum Beispiel bei den „Integrationsmaßnahmen“ und Pseudo-Arbeitsplätzen der Jobcenter zum Testen der Arbeitsbereitschaft und Ge- wöhnung der Leistungsempfänger an ein geregeltes Arbeitsleben (ob den Fortschritten durch das Training nicht Ermüdungserscheinungen gegenüberstehen und somit eine mögliche Produktivitätssteigerung relativiert wird bzw. ob überhaupt eine solche statt- findet, müsste erst nachgewiesen werden), oder aber bei sehr gering qualifizierter Tätig- keit in der Privatwirtschaft (z.B. Outbound-Callcenter, deren Tätigkeit vom Adressaten eher als eine Störung empfunden wird und zum Teil auch illegal ist), ist ein Anreiz zur Erhöhung des Arbeitsangebotes sogar kontraproduktiv. Wenn aber eine Produktivitäts- steigerung erreicht wird, so wirken sich die niedrigeren Löhne entweder positiv auf die Unternehmensgewinne aus, oder die Preise der Produkte für den Konsumenten sinken.
Im ersten Fall bedarf es einer ergänzenden Steuerreform, welche die Unternehmensgewinne stärker belasten sollte, um davon das SE der bei niedrigen Löhnen zu Arbeit gezwungenen Arbeitnehmer zu unterstützen. Nur wenn die Unternehmensgewinne um mehr steigen als die steuerliche Belastung, die für die Finanzierung des SE notwendig ist, handelt es sich um eine Pareto-Verbesserung, ansonsten nicht.
Abschließend sei noch der Hinweis gegeben, dass es einen Zusammenhang zwischen Arbeitsanreizen und BGE nur für potentiell erwerbsfähige Personen gibt; bei den anderen besteht kein direkter Zusammenhang. Hier kann es nur einen indirekten Zusammenhang geben, weil die Erwerbstätigen möglicherweise einen geringeren Anreiz haben zu arbeiten, wenn die anderen ein höheres Gratiseinkommen bekommen. Das gilt aber nur soweit ausschließlich monetäre Anreize zur Arbeitsaufnahme existieren.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Auswirkungen durch ein BGE auf den Arbeitsmarkt nicht eindeutig zu bestimmen sind. Zum einen werden durch Lohnersatzleistungen negative Anreize auf das Arbeitsangebot erzeugt, zum anderen bieten die Möglichkeit der Deregulierung einerseits und die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die Befreiung von Existenzängsten andererseits positive Anreize für den Arbeitsmarkt. Die Nettowirkung hängt davon ab, welcher Effekt stärker ist.
3.2 Auswirkungen auf die Nachfragestruktur
Das BGE wird nicht nur das Einkommen verändern, sondern auch einen Einfluss darauf haben, wie die Nachfrage nach Gütern künftig sein wird. Das liegt daran dass jetzt vor allem ärmere Bevölkerungsschichten mehr Geld zur Verfügung haben.
3.2.1 Auswirkungen auf die Konsumgüternachfrage
Da jeder Mensch zum Leben regelmäßig Konsumgüter benötigt, muss er einen gewissen Anteil seines Einkommens dafür ausgeben. Bei einem durchschnittlichen Einkommen ist dieser Anteil kleiner als 100%. Da die Preise auf dem Konsumgütermarkt in der Regel für alle gleich sind, kann der Anteil nur über die Mengen der konsumierten Güter oder über eine Erhöhung des Einkommens verkleinert werden.
Da für das SE möglicherweise auch die Menge feststeht, gilt: Je kleiner das Einkommen, desto größer der Anteil des SE. Bei sehr niedrigem Einkommen liegt das Einkommen unterhalb des Preises für den SE-Warenkorb. Bestimmte Konsumgüter werden auch nur bis zu einer individuellen Sättigungsmenge konsumiert und entsprechend nachgefragt. Daraus folgt, dass Menschen mit höherem Einkommen mehr Geld für andere Dinge als Konsumgüter haben.
Wenn das BGE eingeführt wird, soll jeder die Kaufkraft für das SE haben. Ist das der Fall, steigt die Nachfrage nach Konsumgütern stark an. Das kann zur Folge haben, dass sich die Produktionsstruktur ändert und sich dann auch die relativen Preise zu anderen Gütern verändern. Somit könnte dann die gesamte Nachfrage nach Konsumgütern wie- der sinken und die nach anderen Gütern steigen. Kurzfristig würden aber Konsumgüter stärker nachgefragt, so dass es hier durchaus zu einem Beschäftigungseffekt kommen könnte, was dann wieder zu eine höheren Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt führen wür- de. Diese Annahme entspricht dem keynesianischen Ansatz, wonach der Staat durch Nachfrage die Wirtschaft ankurbeln soll. In diesem Falle täte er das indirekt mit dem BGE.
Eine weitere Veränderung bestände darin, dass die Menschen durch das gestiegene Einkommen und das verringerte Arbeitsangebot mehr Freizeit hätten. Somit würden auch mehr freizeitkomplementäre Güter nachgefragt.
3.2.2 Auswirkungen auf die Investitionsgüternachfrage
Drei Einflussgrößen können die Nachfrage nach Investitionsgütern positiv verändern:
1. die Verteuerung des Arbeitsangebotes durch geringere Arbeitsbereitschaft
2. die höhere Kapitalproduktivität aufgrund des Niedriglohnsektors
3. die gestiegene Konsumgüternachfrage
Die erste Einflussgröße beruht auf der Annahme, dass der Faktor Arbeit durch den Fak- tor Kapital substituiert wird. Infolgedessen müssten technische Innovationen erfolgen. Zur Automatisierung der Produktion benötigt man Maschinen, welche zu den Investiti- onsgütern zählen.
Die zweite Einflussgröße beruht auf der Tatsache, dass Unternehmen eine höhere Pro- duktivität haben, wenn Kapital- und Arbeitskosten sinken. Die Produktivität eines Pro- duktionsfaktors steigt alleine schon dadurch, dass die Produktivität des anderen Faktors steigt, sofern beide Faktoren sich nicht gegenseitig vollständig substituieren können und beide benötigt werden.
Der Faktor Arbeit wird durch den BGE-gestützten Niedriglohnsektor kostengünstiger und damit produktiver. Das bedeutet, dass durch den deregulierten Arbeitsmarkt die Kosten sinken.
Wenn die Nachfrage nach Konsumgütern steigt, werden auch mehr Produktionsmittel, also Investitionsgüter nachgefragt, da die Konsumgüter ja produziert werden müssen.
Eine gegenteilige Entwicklung könnte dadurch eintreten, dass bedingt durch Einkom- mensumverteilung zwar mehr Konsumgüter nachgefragt werden, aber dann insgesamt weniger Geld gespart werden kann und damit auch weniger Geld für Investitionsgüter zur Verfügung steht.
Möglicherweise werden auch dadurch mehr Investitionsgüter nachgefragt, dass aufgrund des strukturellen Wandels in der Gesellschaft bedingt durch die Einführung des BGE andere Investitionsgüter benötigt werden. Dadurch würde dann ein Strukturwandel im Produktionssektor durchgesetzt.
3.3 Auswirkungen auf die Preisgestaltung
Unabhängig vom Marktpreis werden derzeit von Anbietern freiwillig oder durch gesetz- liche Vorschriften im Rahmen des Preisgestaltungsspielraums bestimmten Personen- gruppen Ermäßigungen gewährt. Neben betriebswirtschaftlichen Überlegungen, be- stimmte Zielgruppen zu erreichen, steht dahinter auch der oft untaugliche Versuch, die individuelle Kaufkraft zu berücksichtigen. Untauglich deshalb, weil die tatsächliche Kaufkraft aus rechtlichen Gründen oder wegen zu hohen Aufwands nicht zu ermitteln ist und somit nach leicht erkennbaren Merkmalen (z.B.: Lebensalter, Ausbildungs-/ Studentenstatus) differenziert wird, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit der Kaufkraft korrelieren. Dies muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Somit sind Er- mäßigungen, die aufgrund eines solchen Status gewährt werden, stets willkürlich und nicht unbedingt sachgerecht. Manchmal beträgt die Preisermäßigung sogar 100% (z.B. beim freien Eintritt für alle Personen unter 18 Jahren in die Hamburger Museen). Damit entfallen für die begünstigten Gruppen auch noch die Transaktionskosten des Bezahl- vorgangs, was in manchen Fällen noch bedeutender sein kann als die Preisermäßigung selbst.
Durch die Einführung eines BGE steigt das nominale Einkommen eines jeden. Das würde dazu führen, dass in der subjektiven Wahrnehmung der Anbieter von Waren und Dienstleistungen jeder als kaufkräftig gelten würde. Somit könnten bisher gewährte Ermäßigungen entfallen. Auch der Gesetzgeber könnte bisher vorgeschriebene Ermäßi- gungen aufheben. Für bisherige Transferempfänger entfielen in diesem Fall mit der Ein- führung des BGE bisher gewährte Ermäßigungen, und das BGE würde dadurch wiede- rum reduziert.
Dieser Preisanstieg ist jedoch vom im Abschnitt 3.1.1 beschriebenen allgemeinen Preisanstieg zu unterscheiden, da es sich hierbei nicht um eine natürliche automatische Folge, sondern um eine völlig unberechenbare willkürliche Folge handeln würde.
Im Extremfall könnten die betroffenen Personen durch das BGE sogar schlechter ge- stellt werden, sofern bisherige Transferleistungen dem BGE in der Höhe gleich waren, aber noch eine Preisermäßigung gewährt wurde. Problematisch wäre es auch, wenn es dazu käme, dass die Preisermäßigungen nur für einige bisher Berechtigten entfallen würden.
3.4 Auswirkungen auf die Einkommensverteilung
Das BGE soll eigentlich Einkommen umverteilen, damit denjenigen, die eine geringe Produktivität haben und am Markt nur wenig verdienen können, ein Mindestmaß an Lebensqualität gewährleistet wird. Das heißt, dass sie haben Anspruch auf einen größeren Teil des Bruttonationalproduktes haben, als von ihnen erwirtschaftet wurde. Im Gegenzug bekämen produktivere Mitglieder der Gesellschaft einen geringeren Anteil am Bruttonationalprodukt als sie erwirtschaftet haben.
Auf den ersten Blick funktioniert das bei einem BGE nicht, da ja der gleiche Betrag an jeden gleichermaßen ausgezahlt wird. Die eigentliche Umverteilung hängt nun davon ab, wie das BGE finanziert und das selbstverdiente Einkommen besteuert werden.52
Versucht man den Anteil der Nettozahler möglichst hoch und den Anteil der Nettoempfänge möglichst niedrig zu halten, so ändert sich die Einkommensverteilung gegenüber dem Ausgangszustand kaum; das gleiche gilt bei einer niedrigen Höhe des BGE.
Niedrige Transferentzugsraten sind ebenfalls geeignet, die Änderung der Einkommensverteilung möglichst gering zu halten. Entsprechend gilt, dass durch die umgekehrten Einflussgrößen eine hohe Einkommensgleichheit erreicht würde.
Tabelle 3: Einkommensverteilung und Einflussgrößen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* eine hohe Transferentzugsrate sorgt dafür, dass mittlere Einkommen den niedrigen gleichgesetzt werden, genauer, dass Einkommen von Nettoempfängern mit selbstverdientem Einkommen dem BGE in der Höhe angepasst werden. Insofern wird die Einkommensverteilung gleicher. Der Unterschied zu den Einkommen der Nettozahler hingegen vergrößert sich (Armutsfalle).
Auch die Verteilung der Arbeitsplätze hat einen Einfluss auf die Einkommensverteilung. Besonders wenn statt einer bestimmten Anzahl Vollzeitarbeitsplätze doppelt so viele Teilzeitarbeitsplätze eingerichtet werden, gleichen sich die Einkommen an.
Das BGE hat insofern einen Einfluss darauf, als dass niemand mehr zur Existenzsiche- rung einen Vollzeitarbeitsplatz annehmen muss, wenn er nur in Teilzeit arbeiten möch- te. Andererseits würden die Unternehmen, soweit sie es ermöglichen können und nicht ganz auf das Arbeitsangebot verzichten, weil sie in irgendeiner Form ausweichen kön- nen (Standortverlagerung, Rationalisierung, Automatisierung oder Aufgabe der Produk- tion) solche Teilzeitarbeit auch nachfragen, weil ja kein Überangebot von Arbeit auf dem Arbeitsmarkt mehr existiert.
Andere Menschen wiederum würden die Möglichkeit, sich mit Teilzeitarbeit etwas hinzuzuverdienen, als sehr angenehm empfinden und ihre Arbeitskraft in Teilzeit gerne und hochmotiviert anbieten.
Die Unternehmen hätten damit ein besseres (=qualitativ hochwertigeres) Arbeitsangebot, was aufgrund höherer Produktivität seinen Preis wert wäre, und würden es auch nachfragen. Auf diese Weise würden sich zwei Personen einen Arbeitsplatz und entsprechend ein Einkommen teilen. Käme es so, wäre damit die im emanzipatorischen Diskurs geforderte Umverteilung der Arbeit realisiert.
Zum Abschluss lässt sich die Frage stellen, ob nicht auch das BGE zu einer ungleiche- ren Verteilung von Einkommen führen kann als die derzeitige Situation. Dies ist durch- aus möglich.
Insbesondere die Modelle aus dem neoliberalen Diskurs könnten zu so einer Situation führen. Da mit dem BGE ja ein SE sichergestellt wäre, würden im Gegenzug durch die Deregulierungen am Arbeitsmarkt einige gut oder mittelmäßig bezahlte Tätigkeiten in den Niedriglohnsektor abgeschoben bzw. ganz aufgegeben, so dass es deutlich mehr unfreiwillige „Nur-BGE-Bezieher“ geben könnte.
Niemand weiß genau, wie sich der Arbeitsmarkt nach Einführung eines BGE entwickelt würde. Darum kann das oben beschriebene Szenario nur eine Vermutung sein. Hinzu kommt die Frage, ob die Ungleichheit größer oder kleiner würde, wenn es statt „reich“, „normal“ und „arm“ nur noch „reich“ und „arm“ gäbe.
3.5 Auswirkungen auf die Bürokratie
Eines der Ziele des BGE ist die Entbürokratisierung, das heißt, Transferleistungen sol- len effizienter, also mit wenig bürokratischem Aufwand, gewährt werden. Der Fortfall der Bedürftigkeitsprüfung, die automatische Gewährung (Es ist kein Antrag zu stellen.) und die einheitliche Höhe des BGE sollen dafür sorgen, dass dieses Ziel erreicht wird. Während ein Geldtransfer regelmäßig daraufhin überprüft werden müsste, ob er noch der Höhe des definierten SE entspricht, wären Naturalleistungen hiervon unabhängig. Zwar müsste die Zusammenstellung des Warenkorbes aus Naturalleistun- gen hin und wieder angepasst werden, aber man könnte das SE so definieren, dass be- stimmte zeitlose Waren und Dienstleistungen, die immer benötigt werden, in jedem Fall dazugehören.53
Der Geldtransfer hat Gegenüber den Transfer von Naturalien zwei Vorteile: Ersten lässt sich der Aufwand sparen, zu entscheiden, welche Güter und Dienstleistungen nun gewährt werden sollen; zweitens sind ungebundene Transfers in der Regel effizienter, da ein geringerer Geldwert als Transfer gewährt werden muss als der Geldwert für die Menge des gewährten Naturals betragen würde, die benötigt wird, um den Transferempfänger in gleicher Weise zufriedenzustellen. Das liegt daran, dass die meisten Individuen einen Gelbetrag wegen seiner Flexibilität höher schätzen, als die Menge eines Naturals, die man für diesen Geldbetrag erwerben kann. So können sie sich von verschiedenen Gütern und Dienstleistungen etwas kaufen.
Aber auch gebundene Transfers haben ihre Vorteile. Sie werden in Form von Gutscheinen gewährt. So ist beim HWWI-Modell geplant einen Gutschein im Wert von 200€ für Krankenversicherung auszugeben. Bei den aktuellen Grundsicherungen in Deutschland gibt es z.B. Bildungsgutscheine.
Ein Vorteil davon ist, dass eine Lenkungswirkung erzielt wird. Dieses soll vor allem dafür sorgen, dass die gewährten Mittel im Sinne des Sozialtransfergebers effizient ein- gesetzt werden. Somit soll verhindert werden, dass die gewährten Mittel dazu benutzt werden, die Bedürftigkeit zu erhöhen (z.B. für Genussmittel wie Alkohol verwendet werden), sondern für Zwecke, die die Bedürftigkeit senken (Gesundheit, Bildung oder Investitionen in Energieerzeugung, z.B. Solaranlagen). Damit wird zwar das Postulat der Konsumentensouveränität missachtet, jedoch negative externe Effekte (Erhöhung der Bedürftigkeit zu Lasten der Allgemeinheit) vermieden.
Ein zweiter Vorteil kann darin bestehen, dass Naturalleistungen zu einem deutlich nied- rigeren Preis produziert werden und der Transfergeber nur den Produktionspreis bezah- len muss, weil er entweder selbst der Produzent ist (staatliche Betriebe) oder aber durchsetzen kann, dass der Produzent das Gut oder die Dienstleistung zu Grenzkosten bereitstellen muss. Das ist vor allem dann sehr sinnvoll, wenn die Grenzkosten bei null liegen. In diesem Falle würde ein zusätzlicher Konsument keine zusätzlichen Kosten verursachen. Das Gut bzw. die Dienstleistung aber können nicht generell zum Nulltarif bereit gestellt werden, da die Durchschnittskosten gedeckt werden müssen. Zahlungsun- fähige Personen, aber vom Konsum auszuschließen, wäre ineffizient.
Da beim BGE die Bedürftigkeitsprüfung entfällt, wäre es nicht sinnvoll, gebundene Transfers aus den zu vor genannten Gründen zu gewähren, weil dieses dann ohnehin zu einer reinen Steuerfinanzierung und für alle unentgeltlichen Bereitstellung vorgenannter Güter und Dienstleistungen führen müsste. Das wäre zwar sinnvoll, würde jedoch nicht als Bestandteil des BGE wahrgenommen werden.
Ein dritter Vorteil ist der, dass der Staat als Großkunde gegenüber den Anbietern von Gütern und Dienstleistungen auftreten kann und somit mehr Marktmacht hat. Dadurch kann er große Mengenrabatte durchsetzen.
So ergibt es keinen Sinn, wenn alle Bedürftigen sich den günstigsten Stromanbieter su- chen. Durch (künstliche) Wechselkosten wird seitens der Anbieter eine Monopolstel- lung erzeugt. Ebenso haben einzelne Privatkunden kaum Macht bei einem Stromanbie- ter den Preis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Der Staat hat dazu bessere Möglichkei- ten.
3.5.1 Auswirkungen auf die Verwaltung
Bei einer Realisierung des BGE können in hohem Umfang Kosten eingespart werden.54 Die heutigen Sozialämter könnten aufgegeben oder, wenn sie noch weiter für die Ge- währung von bestimmten Sozialleistungen für besondere Lebenslagen gebraucht wer- den, stark entlastet werden, da das Finanzamt die Verwaltung des BGE übernehmen würde.
Kosten für die Bedürftigkeitsprüfung entfallen in jeder Hinsicht. Es braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob jemand etwas bestimmtes benötigt, noch ob derjenige eigne Mit- tel dafür zur Verfügung hat. Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit könnten eben- falls entfallen. Damit entfallen dann auch Arbeitsplätze und Menschen, welche hochmo- tiviert und aus rein intrinsischen Gründen andere gerne kontrollieren und bevormunden, können ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen und würden künftig ggf. genauso nur vom BGE leben wie ihre bisherige Kundschaft. Aber dieser Nachteil dürfte zu vernachlässi- gen sein.
3.5.2 Auswirkungen auf die Empfänger der bisherigen Grundsicherung
Das BGE in Form der Sozialdividende hat zunächst einmal für die Empfänger bisheri- ger Grundsicherung den Vorteil, dass sie keine Anträge mehr stellen müssen, um ihr Grundeinkommen zu erhalten (Entbürokratisierung). Die Betroffenen werden dadurch auch weniger stigmatisiert.55 Ebenso sind sie an keine Mitwirkungspflichten mehr ge- bunden. Sie müssen keine Bereitschaft zur Arbeit zeigen, keine Pflichtbewerbungen mehr schreiben, nicht mehr an Maßnahmen und Fortbildungen teilnehmen, keine Be- dürftigkeitskontrollen mehr über sich ergehen lassen und keine Termine beim Jobcenter wahrnehmen.
Also würden sie wieder menschenwürdig behandelt.56 Eine administrative Aktivierung zum Arbeiten entfiele und somit auch hohe Fehler bei der Beurteilung der Menschen und ihrer „Arbeitsfähigkeit“.57
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Vermögen besser geschützt wäre. Eine unfreiwilli- ge Vermögensverwertung bliebe aus. Dadurch ergibt es für Empfänger der bisherigen Grundsicherung wieder Sinn, Geld zu sparen und nicht alles sofort auszugeben, um zu vermeiden, dass das Vermögen anstelle von Transferleistungen verwertet werden muss.
Letzteres ist sogar ein Effizienzgewinn, da nun wieder die optimale Spar-Konsum- Kombination gewählt wird und es nicht zu Verzerrungen kommt, weil die minimale Zwangsvermögensverwertung gewählt wird.
Aufgrund der Regelungen der derzeitigen Grundsicherung in Deutschland, werden seitens der Empfänger viele Ressourcen verschwendet, um einen Bedarf darzustellen, der in den Augen des Staates nicht vorhanden ist, damit sie Leistungen erhalten zu diesem Zweck muss ggf. auch Vermögen versteckt werden.
Das alles würde mit der Einführung eines echten BGE entfallen. Und die Empfänger könnten ihre Kräfte produktiver nutzen. Die psychische Stabilität würde steigen und die Armutskriminalität sinken. Auch das wäre wieder ein Effizienzgewinn.
4. Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens
Die Finanzierung und auch die Finanzierbarkeit eines BGE ist eine wichtige Vorausset- zung für die Realisierung. In der Literatur scheiden sich genau an diesem Punkt die Geister. Von „Irrweg“ (Heiner Flassbeck)58 und „unhaltbares Versprechen“ (Guido Raddatz)59 bis hin zu „finanzierbar“ und sogar hohen Einsparmöglichkeiten für den Staat (HWWI, Hohenleitner/Straubhaar zum solidarischen Bürgergeld von Dieter Althaus)60 reicht das Spektrum der Aussagen zur Realisierbarkeit der Modelle.
Die Einführung eines BGE bedarf zur Finanzierung in der Regel weitere finanzielle Veränderungen im Staat, z.B. eine Steuerreform.61 Somit kann dann das Gesamtpaket aus BGE und den dazu notwendigen weiteren Änderungen auch als BGE-System be- zeichnet werden.
Wie die Erörterung des Transfergrenzen-Modell von Pelzer/Fischer (vgl. Kapitel 2.3.6) zeigte, lässt sich an den Parametern die Finanzierbarkeit einstellen. Die Transferent- zugsrate muss niedrig genug eingestellt werden, dass monetäre Arbeitsanreize existieren und andererseits hoch genug, um die Zahl der Nettoempfänger möglichst gering zu hal- ten. Es kann auch mit unterschiedlichen Steuersätzen gearbeitet werden. Beim Trans- fergrenzen-Modell wird sogar ein niedrigerer Steuersatz für höhere Einkommen ange- wandt (regressive Wirkung). Es kann aber andererseits auch eine Feinsteuerung mit progressivem Steuersatz erreicht werden.
Wie im vorigen Kapitel erörtert wurde, kann das BGE nur funktionieren, wenn eine Umverteilung der Einkommen oder genauer gesagt der Kaufkraft stattfindet, damit nicht die durch das BGE gewonnene Kaufkraft für die Bedürftigen durch Preissteigerungen neutralisiert wird. Die damit verbundene Anreizreduzierung der Nettozahler, Einkom- men am Markt zu erwerben, sollte in Grenzen gehalten werden, lässt sich aber naturge- mäß nicht ganz vermeiden. Da ja im Grunde genommen das Ziel ist, die Menschen gleichmäßiger am Wohlstand teilhaben zu lassen, kann eine Produktionsreduzierung dafür auch in Kauf genommen werden, womit das SE und damit auch der Finanzbedarf sinkt.
Eine Finanzierung ist somit immer möglich. Sie wird nur dann problematisch, wenn mindestens eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:
1. Das aktuelle Konsumniveau soll beibehalten und auf alle Personen erweitert werden, ohne dass zusätzliche Produktionsmittel (Kapital und Arbeit) zur Ver- fügung gestellt werden, also keine weitere Investition getätigt wird. Dies kann an fehlenden Anreizen oder an fehlenden Produktionsmöglichkeiten liegen, weil das Kapital (oder z.B. Bodenschätze) nicht vorhanden ist oder die Menschen nicht in der Lage sind (aufgrund fehlender Fähigkeiten), die Güter und Dienst- leistungen zu produzieren.
2. Es handelt sich um keine geschlossene Volkswirtshaft, und das BGE-System ist nur auf diese eine Volkswirtschaft begrenzt. In diesem Falle besteht die Gefahr, dass Nettoempfänger aus anderen Volkswirtschaften zuwandern62, während Net- tozahler in eine andere Volkswirtschaft abwandern, die ihr Einkommen weniger belastet, oder ihr Kapital verlagern (Kapitalflucht).
Genau aus dem Grund, dass Kapital mobiler ist als Arbeit, gehen viele Volkswirtschaften dazu über, Kapitalerträge wesentlich behutsamer und niedriger zu besteuern als Arbeitseinkommen.63
Dieses Problem ist nur zu lösen, indem für das BGE die Bedingungen einer geschlosse- nen Volkswirtschaft geschaffen werden. Das kann dadurch geschehen, dass das BGE gleich weltweit eingeführt oder zumindest möglichst große Gebiete (z.B. EU) als Start- gebiet gewählt werden. Alternativ könnten von Volkswirtschaften, die kein BGE ein- führen, aber Nettozahler bzw. deren Kapital aufnehmen bzw. Nettoempfänger „entsen- den“, Ausgleichszahlungen gefordert werden. Hierzu fehlt es aber oft an rechtlichen Grundlagen, und militärische Interventionen, um diese Ausgleichzahlungen durchzuset- zen, sind nicht realisier- oder finanzierbar. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Volks- wirtschaft abzuschotten und dadurch die Bedingungen einer geschlossenen Volkswirt- schaft herzustellen. Dies allerdings bedeutet erhebliche wirtschaftliche Nachteile, weil dadurch der Außenhandel behindert wird.
Einerseits ist es erforderlich, für das Funktionieren des BGE-Systems eine Kaufkraft- umverteilung durchzuführen, was im Prinzip eine Arbeitseinkommensumverteilung bedeutet; andererseits besteht die Gefahr, dass der Produktionsfaktor Arbeit stark ab- nimmt (und im Extremfall ganz verschwindet), weil er aufgrund von mangelndem Ar- beitsangebot durch Kapital substituiert wird. Die verbleibenden Arbeitseinkommen sind aufgrund des steigenden Niedriglohnsektors für eine Besteuerung nicht sehr ergiebig. Genau an diesem Punkt setzt auch die Kritik an den neoliberalen BGE-Befürwortern an. Diesen wird unterstellt, sie wollen angeblich nur deshalb ein BGE, um den Niedriglohn- sektor auszuweiten, damit sie als Unternehmer noch höhere Gewinne machen können.64 Hiergegen lässt sich argumentieren, dass diese Gewinne in einer der beiden nachfolgend beschriebenen Formen zurückgegeben werden können:
1. Die Gewinne entstehen gar nicht, da die niedrigeren Kosten der Arbeit in einem Wettbewerbsmarkt in Form niedrigerer Preise für die produzierten Güter und Dienstleistungen an die Konsumenten weitergegeben werden. In diesem Falle be- steht eine Finanzierung des BGE durch das Absenken seiner Höhe.
2. Zur Finanzierung des BGE könnten eben diese Gewinne besteuert werden. Hier be- steht nur dann ein Problem, wenn diese Gewinne der Besteuerung entzogen werden können. Das Problem wurde bereits weiter oben erörtert.
Grundsätzlich müssen neben den Arbeitseinkommen auch Kapital- und Transfereinkommen für die Finanzierung des BGE herangezogen werden. Dies gilt gerade bei Transfereinkommen, die nicht an der Bedürftigkeit orientiert sind (z.B. zu einem früheren Zeitpunkt erworbene Renten- und Pensionsansprüche).
Die Finanzierung allein aus den derzeit gewährten Sozialleistungen und aus den Einspa- rungen im Bereich der Bürokratie wird von keinem Modell dargestellt, obwohl es zu- mindest in den liberalen Modellen eine erhebliche Rolle spielt. Es kommt natürlich dar- auf an, was alles an Sozialleistungen gestrichen werden soll und was zusätzlich zum BGE gewährt wird. Allerdings ist dieser Anteil auch nicht zu vernachlässigen, zumal manche derzeitige Sozialleistungen, z.B. Kindergeld, sich nicht an der Bedürftigkeit orientieren. Dadurch entsteht auch für Normalverdiener zusätzliche Kaufkraft, welche beim Wegfall umverteilt würde.
Darüber hinaus werden in vielen Modellen neue Steuern und Abgaben erwogen, die zur Finanzierung des BGE beitragen sollen; es dürften aber, sofern es um echte zusätzliche Einnahmen geht, nur die beiden aufkommensstärksten Steuern, die Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer, ernsthaft in Erwägung gezogen werden können. Daneben gibt es noch eine dritte Finanzierungsquelle, die bisherigen Sozialversicherungen, welche aber durch ihren begrenzten Beitragszahleranteil problematisch sind.
Manche Modelle, insbesondere diejenigen, welche zwar ein echtes BGE beinhalten, aber von liberalen Diskursen geprägt sind, setzen auf ein BGE mit niedriger Höhe, um damit Arbeitsanreize und somit auch eine Steuerbasis beim Arbeitseinkommen zu schaffen. Fraglich ist allerdings, ob damit das Ziel, ein SE zu garantieren, erreicht wird. Da das SE keine feste messbare Größe ist, lässt sich dieser Anspruch nicht überprüfen.
Neben der Frage, ob ein BGE überhaupt finanzierbar ist oder was als Steuerbasis gelten sollte, ist noch zu untersuchen, welche Art der Besteuerung zu wählen ist. Hier kommen drei Formen der Besteuerung (bzw. auch eine Kombination daraus) in Betracht:
1. Besteuerung der Einkommen (Einkommenssteuer)
2. Besteuerung des Umsatzes (Mehrwertsteuer)
3. Finanzierung über Sozialversicherungsbeiträge bzw. eine Sonderabgabe
4.1 Finanzierung durch Einkommenssteuer
Bei den meisten Modellen wird eine Finanzierung über die Einkommensteuer vorgeschlagen. Lediglich die neueren neoliberalen Modelle sehen eher eine Umsatzsteuer vor. Bei den Modellen der negativen Einkommensteuer ist es implizit unumgänglich, das Grundeinkommen über die Einkommensteuer zu finanzieren. Hierbei handelt es sich lediglich um die weiter oben beschriebene notwendige Kaufkraftumverteilung durch Einkommensumverteilung.
Es ist vielfach erörtert worden, dass das Faktorangebot bei sinkendem Einkommen und minimaler Differenz des Residualeinkommens zum BGE nicht besonders groß ausfällt. Somit schwächt natürlich eine Einkommensteuererhöhung das Faktorangebot.
Zwei große Vorteile der Einkommensteuer sind:
1. das Quellabzugsverfahren, zumindest bei der Lohnsteuer in festen Arbeitsver- hältnissen. Dadurch wird Steuerhinterziehung erschwert.
2. die Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit - dadurch werden Ge- ringverdiener oder Nur-BGE-Empfänger, kurz alle Nettoempfänger nicht durch die Hintertür wieder stärker belastet, außer es gelingt den Nettozahlern, sich durch höhere Preise für Güter und Dienstleistungen einen Teil der Steuern wie- der zurückholen.
Ein entscheidender Unterschied besteht zwischen den Modellen, die dem Prinzip der negativen Einkommensteuer folgen, und denen, die eine Sozialdividende auszahlen wollen.
Bei der negativen Einkommensteuer wird zunächst das Einkommen geprüft. Fällt es zu gering aus, wird entsprechend ausgezahlt, ansonsten werden Steuern eingefordert. Nur im Grenzfall hebt sich beides auf.
Die negative Einkommensteuer ist somit mit der Sozialdividende nur begrenzt vergleichbar. Erst das vollständige Konzept des BGE einschließlich der Finanzierung ermöglicht einen Vergleich der beiden Konzepte.
Dabei entspricht die negative Einkommensteuer den Nettoempfängern, während die positive Einkommensteuer den Nettozahlern entspricht.
Die negative Einkommensteuer hat den Vorteil, dass sie nicht vorfinanziert werden muss.65
Bei der Sozialdividende muss der Staat für eine Periode in Vorleistung treten und kann sich erst für die Folgeperiode das Geld von den Nettozahlen wieder holen. Somit kann es nicht aus dem jeweiligen Steueraufkommen finanziert werden.
Im Übrigen ist zu beachten, dass bei der Einkommensteuer nicht nur Arbeitseinkommen besteuert werden darf.
Manche Staaten mit sehr hohen Einkommensteuern haben einen getrennten Steuersatz für Arbeits- und Kapitaleinkommen. Damit soll dem Phänomen der internationalen Ka- pitalmobilität (Kapitalflucht) Rechnung getragen werden. Der Faktor Kapital ist somit wesentlich steuerelastischer als der Faktor Arbeit, der aufgrund hoher Transaktionskos- ten sehr immobil ist.
Das wäre kein Problem, wenn nicht die sinkende Arbeitsbereitschaft (was durch höhere Steuern noch bestärkt wird) dazu führen würde, dass dieser Faktor verstärkt durch Kapi- tal substituiert wird und somit die Steuerbasis und damit auch die Steuerertrag schrumpft.
4.2 Finanzierung durch Mehrwertsteuer
Götz Werner66 schlägt vor, den Staatshaushalt einschließlich BGE allein über die Mehrwertsteuer zu finanzieren. Er führt dazu zwei Argumente an:
1. Eine Besteuerung des selbst verdienten Einkommens verhindert Arbeitsanreize
2. Auch die Einkommensteuer verteuert den Konsum, da ja entsprechend höhere Löhne gezahlt werden müssen (bzw. bei Abschaffung der Einkommenssteuer entsprechend niedrigere) und sich dieses auf die Kosten und letztlich auf die Preise für Güter und Dienstleistungen auswirkt.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass sich bei einer offenen Volkswirtschaft eine Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer insofern positiv auswirkt, als sie die Volkswirtschaft wettbewerbs- fähiger macht (Importe werden relativ teuer, während Exporte durch geringere Besteuerung günstiger werden). Auch Nichtangehörige dieser Volkswirtschaft müssten bei entsprechendem Konsum Steuern zahlen.67
Nachteilig an einer Umsatz-/Mehrwertsteuer ist jedoch zunächst die Allokationsverzer- rung, welche dadurch entsteht, dass aus Steuervermeidungsgründen weniger konsumiert wird, als es ohne Steuern der Fall wäre, sofern die Nachfrage nach Konsum nicht voll- kommen unelastisch ist. Hierdurch entsteht ein Wohlfahrtsverlust. Dieser besteht aber auch bei der Einkommensteuer, sofern dort nicht das Faktorangebot unelastisch ist.
Hinzu kommt als weiteres Problem bei der Umsatz-/Mehrwertsteuer, dass sie nicht nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip erhoben werden kann. Hohe Kaufkraft kann nur dann abgeschöpft werden, wenn entsprechend viel in der zugehörigen Volkswirtschaft konsumiert wird. Im Gegenzug müssen Personen mit geringerem Einkommen bei hohem Konsum mehr Steuern zahlen. Diese Steuer bremst neben dem Preis bei einem begrenzten (kleinen) Einkommen den Konsum noch zusätzlich aus.
Damit würde das Ziel, für reine BGE-Empfänger das SE zu garantieren, möglicherweise gefährdet, da sie ja über die höheren Konsumpreise das BGE finanzieren bzw. diese das BGE indirekt reduzieren, es also ein geringeres Real-BGE gibt.
Folgt man den Argumenten von Götz Werner, tritt dies nicht ein, da sich zwar durch die höhere Mehrwertsteuer die Kosten erhöhen, dies aber durch die geringere Einkommen- steuer und somit die Möglichkeit, die Faktorpreise zu senken, wieder ausgeglichen wird.68
Ob sich nun durch eine Mehrwertsteuer(erhöhung) die Preise für Güter und Dienstleis- tungen erhöhen, hängt davon ab, ob die Steuern bzw. höheren Kosten auf die Konsu- menten überwälzt werden können. Das wiederum hängt von der Nachfrage und der An- gebotselastizität ab. Dies gelingt nur, wenn die Angebotselastizität größer ist als die Nachfrageelastizität. Hierbei ist es natürlich egal, ob es sich um eine Mehrwertsteuer handelt oder um eine in Form höherer Faktorentgelte höhere Einkommensteuer.
Ein Problem ist dabei auch, dass die Möglichkeit der Nichtüberwälzbarkeit nur bedeu- tet, dass der Preis nicht steigen kann. Es bedeutet nicht, dass das Gut auch dann zu dem bisherigen Preis weiterhin angeboten wird, weil der Preis möglicherweise unter den Grenzkosten liegt Im Gegensatz zur Einkommenssteuer besteht aber nur ein Überwälzungsproblem, nämlich das vom Produzenten zum Konsumenten. Bei der Einkommensteuer muss zusätzlich noch die Überwälzung auf dem Faktormarkt vom Produzenten (hier: Kapitalgeber bzw. Anbieter von Arbeitskraft) zum Konsumenten (hier: Unternehmer bzw. Produzent von Gütern und Dienstleistungen) möglich sein.
Sofern die Einkommensteuer nur auf einen der beiden Faktoren erhoben wird, z.B. Arbeit, besteht wiederum die Chance, eine Verteuerung der Produktion und damit verbundene Anhebung der Preise dadurch zu umgehen, dass der besteuerte Faktor durch den anderen substituiert wird.
4.3 Finanzierung durch Sozialversicherungen
In einigen Modellen (z.B. dem der Katholischen Arbeitnehmer69 ) sollen die Sozialversi- cherungsbeiträge beibehalten werden und daraus das Grundeinkommen finanziert wer- den.
Diese Idee ist auf den ersten Blick einfach, hat aber Nachteile:
Das System der Sozialversicherungsbeiträge müsste parallel zum Steuersystem aufrecht erhalten werden; auch die separate Beitragsverwaltung bliebe erhalten. Somit würde das Ziel der Entbürokratisierung nicht erreicht
Es ist unklar, nach welchem Kriterium sich die Beiträge richten sollen. Ist es die Leistungsfähigkeit, so verhält es sich wie eine Einkommenssteuer, und diese könnte auch direkt eingezogen werden. Hängen die Beiträge von irgendeiner Tä- tigkeit ab, so entstehen allokative Verzerrungen, da die Tätigkeit dann in einem suboptimalen Umfang ausgeübt würde, um diese Beiträge zu vermeiden oder zu reduzieren. Das ist eine Analogie zur Umsatzbesteuerung. Wird aber eine unab- hängige Kopfpauschlale erhoben, würde sie das BGE neutralisieren.
Möglicherweise würde wieder nur ein Teil der potentiellen Nettozahler erreicht, was eine Verringerung der Steuerbemessungsgrundlage wäre.
Dieses Verfahren kann aber auch Vorteile haben, die jedoch nur in offenen Volkswirtschaften eine Rolle spielen:
Beitragspflichtig können auch Personen werden, welche vom Steuersystem nicht erfasst werden.
Der Faktor Kapital würde finanziell entlastet.
Die im Transfergrenzen-Modell genannte Basissteuer70 ist zwar eine formell eine Extraabgabe, welche jedoch vom Finanzamt mit verwaltet wird und sich wie die Einkommenssteuer verhält.
5. Einbindung der Sozialversicherungen
Mit der Einführung des BGE sollen die staatlichen Transferleistungen zusammengefasst werden. Dazu gehören auch staatliche oder gesetzliche Sozialversicherungen. Nicht dazu gehören freiwillige Versicherungen.
Die staatlichen Sozialversicherungen, um die es hier geht, sind:
Arbeitslosenversicherung
Rentenversicherung
Kranken-und Pflegeversicherung
Bei der Arbeitslosenversicherung ist der Sachverhalt relativ einfach. Eine staatliche Versicherung, die davor schützt, ohne Einkommen da zu stehen, entfällt. Sie wird ja durch das BGE ersetzt. Für höhere Ansprüche gibt es die Möglichkeit, sich privat zu versichern. Nur Menschen mit hohem Einkommen brauchen eine Versicherung, welche Leistungen über dem BGE auszahlt. Eine staatliche Regulierung wäre hier nicht sinn- voll.
Die neoliberalen Modelle sehen daher keine Arbeitslosenversicherung mehr vor. Anders ist es bei den Modellen anderer Diskurse. Hier stellt das BGE zum Teil nur eine zusätz- liche Leistung zu den bestehenden sozialen Sicherungen dar. Aber auch hier ist in vie- len Fällen nur vorgesehen, das einkommensabhängige „Arbeitslosengeld I“ aufrecht zu erhalten. Das Arbeitslosengeld II soll generell durch das BGE ersetzt werden.
Ähnlich sieht es bei der Rentenversicherung aus. Hier ist die private Vorsorge auch die geeignete Form. Die Grundsicherung im Alter wird durch das BGE ersetzt. In neolibe- ralen Modellen wird die Rentenversicherung komplett gestrichen.71 In sozialliberalen Modellen wie z.B. dem solidarischen Bürgergeld soll es eine lohnabhängige Bürger- geldrente72 geben und bei der Grünen Grundsicherung ist ein Rentenzuschlag geplant.73 Einige andere Systeme, vor allem die emanzipatorischen und sozial-egalitären, lassen die Rentenversicherung als Zusatz unverändert bestehen.74 Das hat seinen Grund vor allem darin, dass die Arbeitgeber sich weiterhin an der Finanzierung der Versicherung beteiligen sollen. Liberale wollen den Anteil als (steuerpflichtiges) Einkommen an die Arbeitnehmer auszahlen lassen.75 Hier befürchten die Kritiker der Abschaffung der Ar- beitgeberbeiträge, dass diese Anteile durch den Preisdruck auf dem Arbeitsmarkt (Nied- riglohnsektor) gänzlich verschwinden und die Arbeitnehmer auf den Kosten sitzenblei- ben.
Anders sieht es bei der Krankenversicherung aus; diese wird nicht durch das BGE er- setzt. Unabhängig von der Einführung eines BGE gibt es unterschiedliche Vorstellun- gen, wie die Krankenversicherung zukünftig finanziert werden soll. So gibt es die Idee einer einkommensunabhängigen Kopfpauschale, das heißt, jeder zahlt unabhängig von seinem Einkommen und seinen finanziellen Verhältnissen einen festen Betrag für die medizinische Grundversorgung. Zusätzliche Leistungen müssen extra versichert werden.76
In den neoliberalen BGE-Modellen wird dieser Vorschlag aufgegriffen und entspre- chend diese Kopfpauschale als Bestandteil des BGE mit ausgezahlt. Dieses wird beim HWWI-Modell als ein Gutschein im Wert von 200€ realisiert. Beim Solidarischen Bürgergeld gibt es dies als Prämie. Somit steht einem einkommensunabhängigen Beitrag auch eine einkommensunabhängige Zahlung gegenüber. Der Betrag nimmt deshalb den Umweg über den Versicherten, damit dieser zwischen den im Wettbewerb stehenden Krankenkassen wählen kann. Bei einigen Modellen soll eine Grundversicherungspflicht für alle Bürger eingeführt werden.77
Die anderen Diskurse lassen die Krankenversicherungssysteme größtenteils entweder so bestehen, wie sie sind oder folgen einem anderen Vorschlag, die Krankenversicherung zu finanzieren, nämlich in Form einer Bürgerversicherung oder haben eigne dem Mo- dell der Bürgerversichrung ähnliche Vorschläge. Hier sind zum einen eine Versiche- rungspflicht für alle Personen zum anderen einkommensabhängige Beiträge vorgesehen.
Durch die BGE-Finanzierung der Kopfpauschale wird dieses Model dem der Bürger- versicherung ebenbürtig. Die fehlende Leistungsfähigkeitsberücksichtigung bei den Einheitsbeiträgen der Kopfpauschale und die daraus folgende fehlende Umverteilung bei den Krankenversicherungsbeiträgen wird durch die Umverteilung des BGE-Systems kompensiert.
Der Vorteil des Kopfpauschelenmodells ist die Entlastung der selbstverdienten Ein- kommen. Der Vorteil der Abschaffung des Arbeitgeberanteils ist die Kostensenkung des Faktors Arbeit.
6. Alternativen zum Bedingungslosen Grundeinkommen
An dieser Stelle soll noch kurz auf Alternativen zum BGE eingegangen werden. Als Alternativen stellen sich:
Mindestlohn + Erwerbslosenrente Garantiertes Mindesteinkommen Rationierter Gratiskonsum
Ein Mindestlohn würde zwar davor schützen, dass eine Arbeit zu einem Lohn verrichtet werden soll, von dem man den Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, bzw. das SE nicht erreicht. Das SE wird aber auch durch den Mindestlohn alleine nicht sichergestellt, da der Mindestlohn nicht den Arbeitsplatz garantiert. Eine ergänzende Erwerbslosenrente würde sich kaum von einem BGE unterscheiden. Würde man sie an die Erwerbsunfä- higkeit knüpfen, fände eine Bedürftigkeitsprüfung statt. Das wäre dann wieder ein bü- rokratischer Aufwand.
Ein garantiertes Mindesteinkommen, wäre entweder an den Arbeitsplatz geknüpft78 und würde den nichterwerbstätigen nicht helfen oder es wäre nur ein anderes Wort für BGE.79
Der Gratiskonsum ist schon eine interessantere Alternative. Dieses entspricht einem BGE in Naturalien und könnte eine Ergänzung oder Alternative zum BGE sein. Es wären dann die Vor- und Nachteile des gebundenen Transfers zu berücksichtigen.
7. Schlussbetrachtung
Ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, ist eine interessante Idee. Die öko- nomischen Auswirkungen sind zum Teil gegenläufig. Es ist somit kaum vorhersagbar, in welche Richtung sich die Volkswirtschaft entwickeln würde, wenn es eingeführt werden sollte. Da verschiedene politische Richtungen und gesellschaftliche Gruppen die Einführung eines BGE befürworten, obwohl sie unterschiedliche Interessen damit ver- folgen (von der Deregulierung des Arbeitsmarktes, über mehr Transparenz und Entbü- rokratisierung bis hin zur Umverteilung von „reich“ zu „arm“) und gesellschaftlich konträre Meinungen vertreten, sind sie sich in einem Punkt einig, nämlich der Sicher- stellung eines menschenwürdigen Lebens durch ein Einkommen, dass an keinerlei Pflichten gebunden ist.
Es wurden verschiedene Modelle entwickelt, welche sogar nachweisen sollten, dass so ein BGE finanzierbar ist.
Gegner lehnen das BGE Pauschal ab und halten es nicht für finanzierbar, weil eben die ökonomischen Auswirkungen nicht abschätzbar sind.
Vor allem wird ein Rückgang der Arbeitsbereitschaft befürchtet und damit ein Schrumpfen der Produktion. Die Finanzierungsmodelle werden für unrealistisch gehal- ten.
Aus den Untersuchungen bleibt festzuhalten:
Das BGE in Form der Sozialdividende hat mit einer begleitenden Steuer, die u.a. zur Finanzierung desselben dient, durchaus eine umverteilende Wirkung und ist damit dem Modell der negativen Einkommensteuer ähnlich.
Das BGE muss eine einkommensumverteilende Wirkung haben, damit es funktioniert und nicht in Inflation endet.
Wichtig ist, dass das BGE nicht nur das bloße physische Überleben absichert, sondern ein Existenzminimum, das eine psychische Zufriedenheit gewährleistet (sozio-ökonomisches Existenzminimum). Dieses lässt sich jedoch nicht eindeu- tig bestimmen.
Um Armutsfallen zu vermeiden, dürfen die Transferentzugsraten bei selbst verdientem Einkommen nicht sehr hoch sein.
Zur Sicherstellung der Finanzierung des BGE sollten die Transferentzugsraten hingegen möglichst hoch sein, damit es wenig Nettoempfänger aber viele Netto- zahler gibt.
Die Einführung eines BGE federt die negativen Folgen für die Arbeitnehmer des Niedriglohnsektors ab, sofern es hoch genug ist.
Selbstverständlich kann es sein, dass es nach Einführung des BGE zu einem Produkti- onsrückgang kommt, aber Dafür steigt dann die Freizeit. Da das nicht intrapersonell ausgeglichen ist, gibt es wie auch bei anderen Maßnahmen Gewinner und Verlierer.
Es ist keineswegs notwendig, dass es nach Einführung eines BGE allen besser geht oder nur einem besser und niemandem schlechter geht. Wäre dies so, so wäre ein BGE pare- to-effizient. Könnten die Gewinner die Verlierer kompensieren, so wäre es wenigstens nach dem Kaldor/Hicks-Kriterium eine Verbesserung. Somit wäre es ökonomisch geboten, das BGE einzuführen.
Die Gegner nennen jedoch nur Nachteile, ohne aber den Nachweis zu führen, dass die Abschaffung eines eingeführten BGE eine Pareto-Verbesserung oder wenigstens eine Verbesserung nach dem Kaldor-/Hicks-Kriterium ist. Somit lässt sich das BGE auch ökonomisch nicht ablehnen.
Die Einführung eines BGE lässt sich aus ökonomischer Sicht nicht eindeutig beantworten und wird somit de Politik zur Entscheidung vorgelegt, welche nach ihren Gerechtigkeitsvorstellungen entscheiden muss.80
Da in Deutschland die derzeitige Grundsicherung mit Bedingungen verknüpft ist, die für die Betroffenen eine sehr große Belastung darstellen und es auch in anderen Europäischen Länden ähnlich ist, sollte man den Versuch das BGE einzuführen wagen. Man könnte es schrittweise umsetzen, jedoch sind regionale Feldversuche auf Grund von Abwanderungen der Nettozahler und Zuwanderungen der Nettoempfänger zu vermeiden. Es sollte eine möglichst große Region wie Europa sein, am besten wäre eine geschlossene Volkswirtschaft dafür geeignet.
Es sollte schon das Modell der Sozialdividende (echtes „BGE“) realisiert werden. da es weniger bürokratisch als die negative Einkommensteuer und besser vermittelbar ist.
Die Parameter des BGE (Höhe des SE, Transferentzugsraten) sollten so gewählt werden, dass Finanzierbarkeit und Absicherung eines relativ hohen sozio-ökonomischen Existenzminimums sichergestellt sind und lediglich die mangelnde Arbeitsbereitschaft das einzige Problem darstellt. Dieses lässt durch Automatisierung, intrinsisch motivierte Arbeitsanbieter und dem Niedriglohnsektor abmildern. Das BGE sollte so hoch sein, dass der Arbeitsmarkt dereguliert werden kann. Mindestlöhne sind eigentlich nur notwendig, wenn man dem BGE nicht zutraut das SE sicherzustellen.
Ein Problem wird darin gesehen, dass die Neigung zur Umverteilung bei den Nettozahlern sehr gering ist. Unter diesem Gesichtspunt ist eine größere Transparenz der Transfergewährung möglicherweise kontraproduktiv.
Die von den Gegnern des BGE vorgebrachten Argumente, dass der Wegfall des Gegen- leistungsprinzips eine Abweichung vom Workfare-Prinzip81 ist und sich einige Men- schen auf die „faule Haut“ legen, mag zutreffen, ist aber auch zum Teil so gewollt (emanzipatorisch), zumindest geduldet (neoliberal), um für jeden ein menschenwürdi- ges Dasein, frei von den Konditionierungen des Arbeitsmarktes sicherzustellen. Außer- dem haben Menschen dann auch mehr Zeit für notwendige, aber nicht bezahlte Tätig- keiten.
Die Möglichkeit von gebundenen Transfers in Form von Gutscheinen oder gewährten Preisermäßigungen bzw. Gratiskonsum für bestimmte Güter und Dienstleistungen zur Förderung gesellschaftlich vorteilhaften Verhaltens, sollte aber auch weiterhin in Betracht gezogen werden.
Beim BGE gilt offenbar auch der Grundsatz: Probieren geht über Studieren!
8. Literaturverzeichnis
Ackermann, S. (2009). Neoliberalismus und Grundeinkommen: Michel Foucaults Analyse des Neoliberalismus, ihre Aktualisierung durch die Gouvernementalitätsstudien und die Bewertung des Konzepts eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) vor diesem Hintergrund (1 Ausg.). München: GRIN Verl.
Adamo, N. (2012). Bedingungsloses Grundeinkommen. Darmstadt: Büchner-Verlag.
Althaus, D. (2007). Das solidarische Bürgergeld: Analysen einer Reformidee. (M. Borchard, Hrsg.) Stuttgart: Lucius & Lucius.
Bischoff, J. (2007). Allgemeines Grundeinkommen: Fundament für soziale Sicherheit?
Hamburg: VSA-Verlag.
Bieritz-Harder, R. (2001). Menschenwürdig leben: Ein Beitrag zum Lohnabstandsgebot des Bundessozialhilfegesetzes, seiner Geschichte und verfassungsrechtlichen Problematik (Bd. 13). Berlin: Berlin Verlag Spitz.
Biedenkopf, K. H. (2008). Klimawandel und Grundeinkommen: Die nicht zufällige
Gleichzeitigkeit beider Themen und ein sozialökologisches Experiment (1 Ausg., Bd. 1). München: Mascha.
Blaschke, R. (2008). Bedingungsloses Grundeinkommen versus Grundsicherung. Von http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Standpunkte_0815.pdf abgerufen
Blaschke, R., Otto, A., & Schepers, N. (Hrsg.). (2012). Grundeinkommen: Von der Idee zu einer europäischen politischen Bewegung. Hamburg: VSA-Verl.
Convent, S. (2013). Einkommen für alle? (Bd. 61). Hamburg: Kovac, Dr. Verlag.
Feist, H. (2000). Arbeit statt Sozialhilfe: Zur Reform der Grundsicherung in Deutschland (Bd. 12). Tübingen: Mohr Siebeck.
Flassbeck, Heiner, Irrweg Grundeinkommen FLASSBECK-ECONIMICS.de http://www.flassbeck-economics.de/das-bedingungslose-grundeinkommen-bge-ist-ein- irrweg/ (letzter Zugriff 06.08, 17.46)
Franzmann, M. (2010). Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft (1 Ausg.). Weilerswist: Velbrück Wiss.
Füllsack, M. (2006). Globale soziale Sicherheit: Grundeinkommen - weltweit? Berlin: Avinus.
Gerntke, A. (2004). Einkommen zum Auskommen: Von bedingungslosem Grundeinkommen, gesetzlichen Mindestlöhnen und anderen Verteilungsfragen. Hamburg: VSA-Verlag.
Habermacher, F. (2013). Das garantierte Grundeinkommen (Bde. No. 2013-13). St. Gallen: Department of Economics, University of St. Gallen.
Heinzel, P., & Schuck, G. (1989). Mindestsicherung: Wege zur Verminderung von Armut und zur Aufhebung der Spaltung von Armen- und Arbeiterpolitik (Bd. 265). Köln: Pahl- Rugenstein.
Ickler, M. (2007). Das bedingungslose Grundeinkommen: Eine sozialpolitische Erörterung. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
Kaltenborn, B. (1998). Von der Sozialhilfe zu einer zukunftsfähigen Grundsicherung (2 Ausg.). Baden-Baden: Nomos.
Knecht, A. (2002). Bürgergeld: Armut bekämpfen ohne Sozialhilfe: Negative
Einkommenssteuer, Kombilohn, Bürgerarbeit und RMI als neue Wege. Bern: Haupt.
Kraus, K. (2001). Sozialstaat in Europa: Geschichte, Entwicklung, Perspektiven (1 Ausg.). Wiesbaden: Westdt. Verl.
Kumpmann, I. (2006). Das Grundeinkommen: Potenziale und Grenzen eines
Reformvorschlags. Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik , 86 (9), S. 595- 601.
Lessenich, S. (2009). Das Grundeinkommen in der gesellschaftspolitischen Debatte. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Meyerhöfer, F. (2000). Soziale Mindeststandards in Europa: Deutsche und französische soziale Minima im Angesicht der Harmonisierungspolitik der Europäischen Union (Bd. 2614). Frankfurt am Main: Lang.
Neumann, F. (2011). Das Grundeinkommen: Bilanz einer Utopie: Eine gerechtigkeitstheoretische Bestandsaufnahme der deutschen Debatte. Zeitschrift für Sozialreform : ZSR , 57 (2), S. 119-148.
Neumann, F. (2009). Gerechtigkeit und Grundeinkommen: Eine gerechtigkeitstheoretische Analyse ausgewählter Grundeinkommensmodelle (Bd. 163). Berlin: Lit.
Opielka, M. (Hrsg.). (1986). Das garantierte Grundeinkommen (Orig.-Ausg. Ausg., Bd. 34). Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
Opielka, M. Grundeinkommen statt Hartz IV. in Blätter für die Internationale Politik 092004 S 1081-1090
Presse, A. (2010). Grundeinkommen. Grundeinkommen , 21.
Raddatz, G. (2013). Das bedingungslose Grundeinkommen. Von http://www.stiftung- marktwirtschaft.de/wirtschaft/publikationen/argumente/detailansicht/bid/71/nr/nr- 123-das-bedingungslose-grundeinkommen-ein-unhaltbares.html abgerufen
Rätz, W., Paternoga, D., & Steinbach, W. (2005). Grundeinkommen: bedingungslos (Bd. 17). Hamburg: VSA-Verl.
Schmid, T. (1984). Beifreiung von falscher Arbeit: Thesen zum garantierten Mindesteinkommen (2 Ausg., Bd. 109). Berlin: K. Wagenbach.
Spieker, M. (2012). Der Sozialstaat (1 Ausg., Bd. 4). Baden-Baden: Nomos.
Straubhaar, T. (Hrsg.). (2008). Bedingungsloses Grundeinkommen und solidarisches
Bürgergeld - mehr als sozialutopische Konzepte (Bd. 1). Hamburg: Hamburg Univ. Press.
Ulrich, P. (2007). Das bedingungslose Grundeinkommen - ein Wirtschaftsbürgerrecht?
Vanderborght, Y., & van Parijs, P. (2005). Ein Grundeinkommen für alle?: Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl.
Wagner, B. Das Grundeinkommen in der deutschen Debatte.
Werner, G. Eichborn W., Friedrich,L.. (2012). Das Grundeinkommen: Karlsruhe Scientific Publishing
Werner, Götz W. (2007): Grundeinkommen und Konsumsteuer - Impulse für "Unternimm die Zukunft". Tagungsband zum Karlsruher Symposium Grundeinkommen: bedingungslos. Karlsruhe: Univ.-Verl. Karlsruhe (Schriften des Interfakultativen Instituts für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe (TH), 15). Online verfügbar unter http://paperc.de/6353-grundeinkommen-und-konsumsteuer-9783866441095.
[...]
1 Vgl. Raddatz, S.16
2 Vgl. Opielka: Grundeinkommen statt Hartz IV, S. 1081 in BLÄTTER FÜR DEUTSCHE UND INTERNATIONALE POLITIK 9-2004 und Rätz, Paternoga, & Steinbach, S. 31
3 Vgl. Bieritz-Harder, S. 149 f
4 Vgl. Raddatz, S. 5
5 Vgl. Presse, S. 42
6 Vgl. Knecht, S. 25
7 Vgl. Adamo, S.86
8 Vgl. Kaltenborn, S.20
9 Vgl. Raddatz, ebenda
10 Vgl. Straubhaar, S.57
11 Vgl. Ulrich, S.4
12 Vgl. Bischoff, S.24
13 Vgl. Adamo, S.60
14 Vgl. Rock, ARMUT IM ANZUG in Gerntke, S.20 ff
15 Vgl. Straubhaar S.20
16 Vgl. Opielka, Vobruba, 1986 S.7f
17 Vgl. ebenda S.8ff
18 Vgl. ebenda
19 Vgl. ebenda
20 Vgl. ebenda
21 Vgl. ebenda
22 Vgl. ebenda
23 Vgl. ebenda
24 Vgl. Neumann 2009, S.12
25 Vgl. Wagner, GRUNDEINKOMMEN IN DER DEUTSCHEN DEBATTE S.4
26 Vgl. ebenda S. 7
27 Vgl. Adamo, S. 53ff und Wagner S.21 ff
28 Vgl. Wagner, S. 22 ff
29 Vgl. Convent, S.84
30 Vgl. Meyerhöfer, S. 59
31 Vgl. ebenda
32 Vgl. ebenda, S.87
33 Vgl. Adamo 2013, S. 49
34 Vgl. Gerhard, Klaus-Uwe/Weber, Arnd GARANTIERTES GRUNDEINKOMMEN in Schmidt, S.34
35 Adamo S. 50
36 Althaus Dieter, in Borchard, DAS SOLIDARISCHE BÜRGERGELD, 2007 S.3f
37 Vgl. Straubhaar S. 21ff
38 Vgl. ebenda S.23
39 Vgl. Adamo S.69
40 ebenda
41 Straubhaar, 2008 S. 26 f
42 Vgl. Adamo, S, 57. ff und Werner, BEDINGUNGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN in Biedenkopf, S. 57 ff
43 fergrenzen- S.154 ff.
44 Vgl. ebenda S. 156 s- $ " % &''* S.154 ff.
45 Vgl. Adamo 2023 20 ff. und Blaschke, 2012 S. 216 ff
46 Vgl. Wagner 2009
47 Vgl. Blaschke, 2012 S. 228 f
48 Vgl. Hauser GRUNDSICHERUNGSMODELLE UND ARBEITSMÄRKTE in Spieker, S.225 ff
49 Vgl. Adamo, 2013 S.48
50 Vgl Straubhaar S.57 ff und Raddatz S.
51 Vgl. Lessenich, S. 19
52 Vgl. Vanderborght & van Parijs S.47 f
53 Vgl. Vanderborght & van Parijs, S.37 f
54 Vgl. Straubhaar, S. 37
55 Vgl. Ackermann, S.72 f
56 Vgl. Ickler, S.77
57 Kumpmann, S. 598
58 Vgl. Flassbeck, Irrweg Grundeinkommen Website: http://www.flassbeck-economics.de/das-bedingungslose-grundeinkommen-bge-ist-ein-irrweg/
59 Vgl. Raddatz, 2013 S. 15
60 Straubhaar 2008, S. 116 f
61 Vgl. Franzmann, S. 378 ff
62 Vgl. Howard LÄSST SICH EIN GRUNDEINKOMMEN MIT OFFENEN GRENZEN VEREINBAREN? in Füll- sack, S. 81f
63 Vgl. Habermacher, Kirchgässner, S. 12 Fußnote 36
64 Vgl. Blaschke, 2008 S. 3
65 Vgl. Feist, S.80
66 Vgl. Adamo, 2013 S. 61
67 Vgl. Habermacher, Kirchgässner, S. 7
68 Vgl. Friedrich: KONSUMBESTEUERUNG UND GRUNDEINKOMMEN in: Werner, Eichborn, Friedrich, 2012 S. 307 ff
69 Vgl. Blaschke, 2012 S.224 f
70 Vgl. Pelzer/Fischer 2011, s.3
71 Vgl. Straubhaar, 2008 S.96
72 Vgl. Wagner, 2009 S. 27 ff
73 ebenda
74 ebenda
75 Ebenda S. 22
76 Vgl. Straubhaar, 2008 S.94f
77 ebenda
78 Vgl. Heinzel & Schuck, S.224
79 Vgl. ebenda, S. 220
80 Vgl. Neumann, 2011, S 136 ff
Häufig gestellte Fragen
Was ist das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) und wie wird es in diesem Dokument definiert?
Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) wird als ein Einkommen definiert, das ohne jegliche Bedingungen gewährt wird. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, keine Verpflichtung zu Erwerbsarbeit oder gemeinnütziger Tätigkeit und es darf kein anderes Einkommen oder Vermögen angerechnet werden. Es soll das sozioökonomische Existenzminimum sichern, also alle Grundlasten des Lebens decken und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
Welche Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens werden in dem Dokument vorgestellt?
Das Dokument stellt verschiedene Modelle vor, darunter die aktuelle Grundsicherung in Deutschland (zum Vergleich), die negative Einkommensteuer, das Modell Solidarisches Bürgergeld von Dieter Althaus, das Modell des Grundeinkommens vom HWWI (Hohenleitner/Straubhaar), das Modell von Götz Werner, das Transfergrenzen-Modell (Pelzer/Fischer) und weitere ausgewählte Konzepte wie Grüne Grundsicherung und Liberales Bürgergeld.
Was sind die Hauptzielsetzungen eines bedingungslosen Grundeinkommens laut diesem Dokument?
Die Hauptzielsetzungen sind die Sicherstellung des sozioökonomischen Existenzminimums für jeden, unabhängig von seiner Produktivität, die Entbürokratisierung der Transfergewährung und die Verhinderung einer Armutsfalle.
Welche ökonomischen Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens werden in dem Dokument analysiert?
Das Dokument analysiert die Auswirkungen auf Märkte (Geldwertstabilität, Kapitalmarkt, Arbeitsmarkt), die Nachfragestruktur (Konsum- und Investitionsgüter), die Preisgestaltung, die Einkommensverteilung und die Bürokratie (Verwaltung, Empfänger der bisherigen Grundsicherung).
Wie könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden, laut diesem Dokument?
Das Dokument untersucht die Finanzierung durch Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Es wird betont, dass zur Finanzierung eine Umverteilung der Einkommen oder Kaufkraft erforderlich ist.
Welche Rolle spielen die Sozialversicherungen bei der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens?
Das Dokument betrachtet die Einbindung der Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) und stellt fest, dass einige Versicherungen (z.B. Arbeitslosenversicherung) durch das BGE ersetzt werden könnten, während andere (z.B. Krankenversicherung) möglicherweise in veränderter Form fortbestehen.
Welche Alternativen zum bedingungslosen Grundeinkommen werden in dem Dokument genannt?
Als Alternativen werden Mindestlohn mit Erwerbslosenrente, garantiertes Mindesteinkommen und rationierter Gratiskonsum genannt.
Welche verschiedenen Diskurse werden in Bezug auf das BGE in der aktuellen Diskussion identifiziert?
Das Dokument identifiziert vier Hauptdiskurse: neoliberaler Diskurs, sozialliberaler Diskurs, emanzipatorischer Diskurs und sozial-egalitärer Diskurs. Jeder Diskurs hat unterschiedliche Motive und Zielsetzungen in Bezug auf das BGE.
Welche potenziellen Probleme und Zielkonflikte werden im Zusammenhang mit einem BGE diskutiert?
Das Dokument diskutiert Zielkonflikte zwischen der Sicherstellung des sozioökonomischen Existenzminimums, der Entbürokratisierung und der Verhinderung einer Armutsfalle. Es wird auch auf potenzielle negative Auswirkungen auf die Arbeitsbereitschaft und die Geldwertstabilität hingewiesen.
Was ist die Schlussfolgerung des Dokuments bezüglich der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens?
Die Einführung eines BGE ist eine interessante Idee mit sowohl positiven als auch negativen ökonomischen Auswirkungen. Die Entscheidung für oder gegen ein BGE ist eine politische Entscheidung, die nach Gerechtigkeitsvorstellungen getroffen werden muss. Es wird empfohlen, es schrittweise in einer möglichst grossen Region (z.B. Europa) als Sozialdividende zu testen.
- Citation du texte
- Martin Potthast (Auteur), 2014, Bedingungsloses Grundeinkommen. Zur Diskussion über die Einführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295458