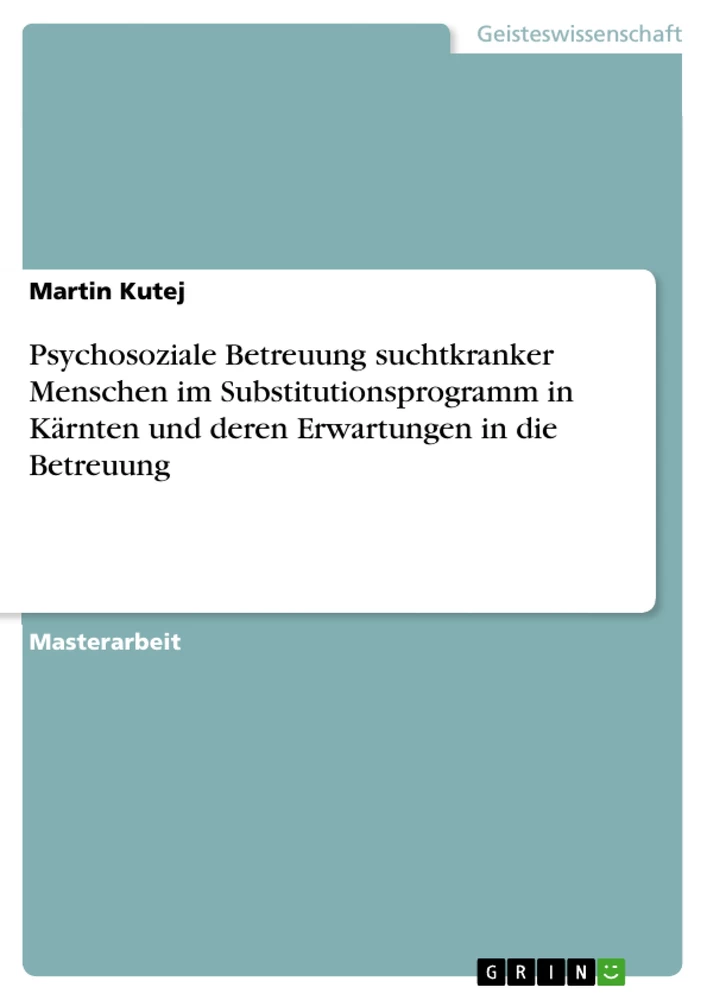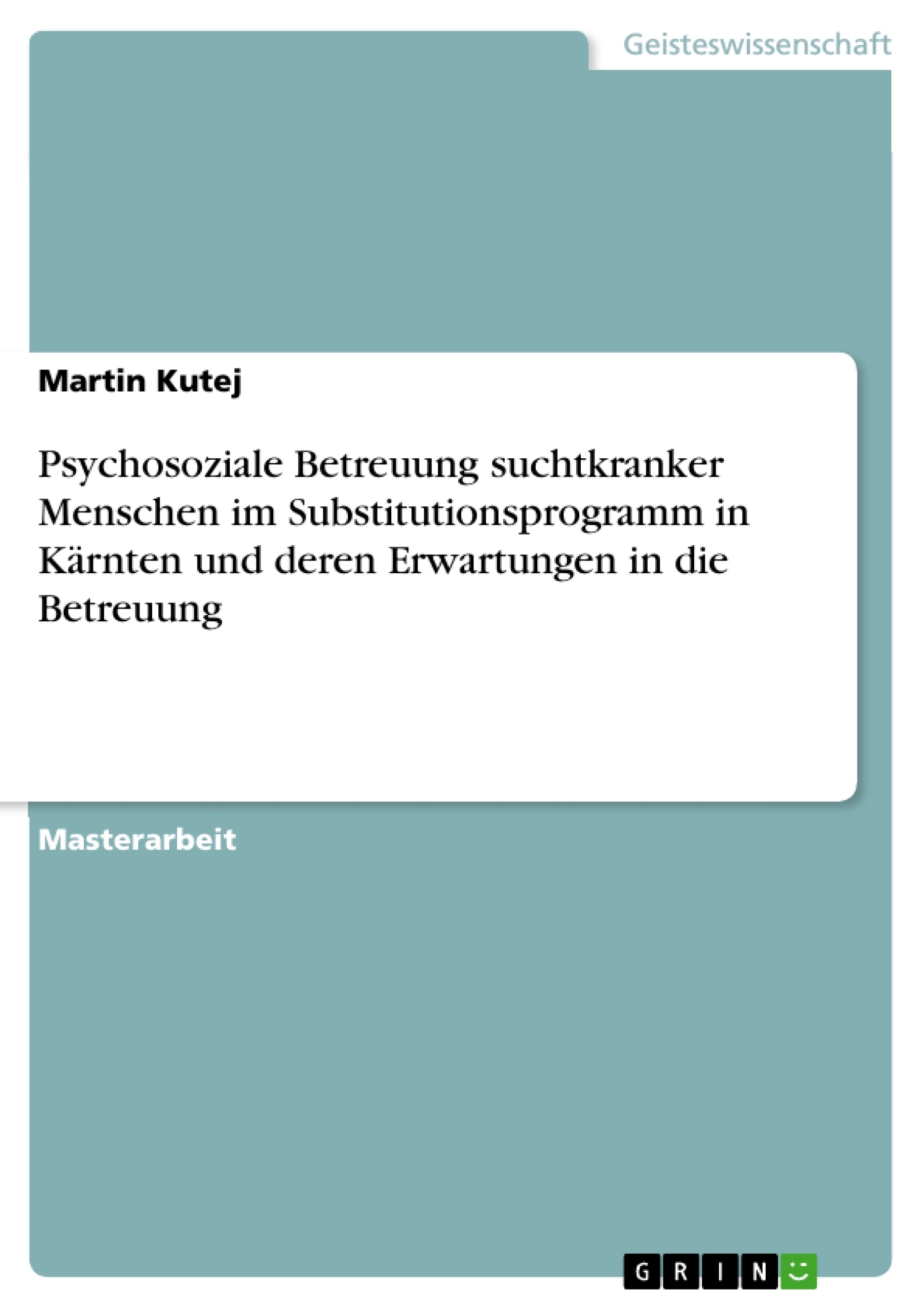Diese Studie widmet sich der Psychosozialen Beratung und Betreuung („PSB“) von suchtkranken Menschen, die sich in Kärnten in Substitutionsbehandlung befinden. Es wird untersucht, welche Erwartungen die betroffenen Menschen an die Psychosoziale Beratung und Betreuung haben, und ob sich diese Erwartungen mit den in Kärnten vorgefundenen Betreuungsmöglichkeiten und mit den in der Literatur beschriebenen Erkenntnissen und Standards decken.
In der Literatur wurde keine klare Definition der „Psychosozialen Beratung und Betreuung“ gefunden. Überwiegend wird darunter Beratung und Betreuung durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Sozial-, Pädagoginnen und Sozial-Pädagogen sowie Psychologinnen und Psychologen verstanden.
Für die Untersuchung wurden elf Interviews durchgeführt, sechs mit KlientInnen des „Ambulatoriums für Drogenkranke des Landes Kärnten und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee“, und fünf mit KlientInnen der Drogenberatungsstelle der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens, „roots“, Villach.
Diese Interviews wurden transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Es konnten dabei sowohl Einblicke über die Vorstellungen und Erwartungen der KlientInnen als auch über ihre Zufriedenheit mit erlebter Psychosozialer Beratung und Betreuung und dem von ihnen gesehenen Bedarf an Psychosozialer Beratung und Betreuung gewonnen werden.
Die erhaltenen Aussagen werden mit den in der Literaturrecherche vorgefundenen Ergebnissen gegenüber gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen, Begriffsdefinition
- 2.1 Bedürfnis
- 2.2 Erwartungen
- 2.3 Droge
- 2.4 Geschichte der Opioide
- 2.5 Heroin
- 2.6 Wirkung der Opiate
- 2.7 (akute) Intoxikation
- 2.8 Schädlicher Gebrauch / Missbrauch von Drogen
- 2.9 (Drogen)sucht
- 2.10 Drogenabhängigkeit
- 2.11 Die psychische Abhängigkeit
- 2.12 Entzug
- 3 Substitution
- 3.1 (Methadon)-Substitution
- 3.2 Opiatabhängigkeit in Österreich
- 3.3 Die Entwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen der Substitution in Österreich
- 3.4 Die Substitutionstherapie und ihre rechtlichen Rahmenbedingungen heute
- 4 Die Psychosoziale Beratung und Betreuung
- 4.1 Die Psychosoziale Beratung und Betreuung im Gesetz
- 4.2 Die psychosoziale Beratung und Betreuung im Allgemeinen
- 4.3 Die psychosoziale Beratung und Betreuung
- 4.3.1 Arbeitsbündnis und Selbstbestimmung
- 4.3.2 Notwendige Kompetenzen für die Beratung
- 4.3.3 Berufsgruppen innerhalb der Psychosozialen Beratung und Betreuung
- 4.3.4 Situation Abhängigkeitskranker
- 4.3.5 Therapiemotivation
- 4.3.6 Motivierende Gesprächsführung
- 4.3.7 Psychoedukation
- 4.4 Veränderung der sozialen Situation durch die Substitutionsbehandlung/Erwartungen
- 4.5 Aufgaben der Psychosozialen Beratung und Betreuung
- 4.6 Aktuelle Situation der Psychosozialen Beratung und Betreuung
- 4.7 Welche Erwartungen haben die Betroffenen?
- 5 Empirischer Teil
- 5.1 Durchführung der Interviews
- 5.2 Auswertung der Interviews
- 5.3 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie
- 5.4 Übersicht der genannten Themenbereiche
- 6 Interviews
- 6.1 Überblick über die Einzelinterviews
- 6.2 Zusammenführung der Interviews
- 7 Schlussfolgerungen, Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Erwartungen suchtkranker Menschen in Kärnten an die psychosoziale Betreuung im Rahmen einer Substitutionsbehandlung. Ziel ist es, diese Erwartungen mit den tatsächlich vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten und den in der Fachliteratur beschriebenen Standards zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die subjektiven Perspektiven der Betroffenen und analysiert deren Zufriedenheit mit der erhaltenen Betreuung.
- Erwartungen suchtkranker Menschen an die psychosoziale Betreuung
- Vergleich der Erwartungen mit den realen Betreuungsmöglichkeiten in Kärnten
- Analyse der Zufriedenheit der Betroffenen mit der Betreuung
- Zusammenhang zwischen den Erwartungen und den in der Literatur beschriebenen Standards
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Psychosoziale Beratung und Betreuung“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der psychosozialen Betreuung suchtkranker Menschen in Substitutionsbehandlung ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Studie. Sie hebt die Relevanz des Themas für die Praxis der Suchtberatung und Prävention hervor und gibt einen kurzen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2 Grundlagen, Begriffsdefinition: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Bedürfnis, Erwartung, Droge, Sucht und Substitution und beleuchtet die Geschichte der Opioide sowie deren Wirkung und die damit verbundenen Risiken. Es werden verschiedene Aspekte der Sucht, wie die psychische Abhängigkeit und der Entzug, erläutert, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Klärung wichtiger Begriffe für die spätere Analyse der Interviews.
3 Substitution: Dieses Kapitel befasst sich mit der Substitutionsbehandlung, insbesondere der Methadon-Substitution. Es beschreibt die Situation der Opiatabhängigkeit in Österreich und die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Substitutionstherapie. Der Fokus liegt auf dem rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext der Substitution und deren Bedeutung für die psychosoziale Betreuung.
4 Die Psychosoziale Beratung und Betreuung: Dieses Kapitel analysiert den Begriff und die Aufgaben der psychosozialen Beratung und Betreuung im Detail. Es betrachtet die gesetzlichen Grundlagen, die allgemeinen Prinzipien und die notwendigen Kompetenzen der beteiligten Fachkräfte. Es beleuchtet die Situation suchtkranker Menschen, ihre Therapiemotivation und die Rolle der motivierenden Gesprächsführung und Psychoedukation. Der Abschnitt bereitet die spätere empirische Untersuchung vor, indem er den theoretischen Rahmen für die Auswertung der Interviews liefert.
5 Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erklärt die Durchführung der Interviews, die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren und die Auswahl der Teilnehmer. Es bietet eine Übersicht über die im Interview thematisierten Bereiche und liefert die Grundlage für die Präsentation und Interpretation der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln.
Schlüsselwörter
Psychosoziale Betreuung, Suchtkranke, Substitution, Methadon, Opiatabhängigkeit, Erwartungen, Kärnten, Qualitative Inhaltsanalyse, Interviews, Soziale Arbeit, Therapiemotivation, Motivierende Gesprächsführung, Psychoedukation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Erwartungen suchtkranker Menschen an die psychosoziale Betreuung im Rahmen einer Substitutionsbehandlung in Kärnten
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Erwartungen suchtkranker Menschen in Kärnten an die psychosoziale Betreuung während einer Substitutionsbehandlung. Sie vergleicht diese Erwartungen mit den tatsächlich vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten und den in der Fachliteratur beschriebenen Standards. Der Fokus liegt auf den subjektiven Perspektiven der Betroffenen und ihrer Zufriedenheit mit der erhaltenen Betreuung.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden zentralen Fragen: Welche Erwartungen haben suchtkranke Menschen an die psychosoziale Betreuung? Wie lassen sich diese Erwartungen mit den realen Betreuungsmöglichkeiten in Kärnten vergleichen? Wie zufrieden sind die Betroffenen mit der Betreuung? Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Erwartungen und den in der Literatur beschriebenen Standards? Wie lässt sich der Begriff „Psychosoziale Beratung und Betreuung“ definieren und abgrenzen?
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Die Datenerhebung erfolgte mittels Einzelinterviews mit suchtkranken Menschen in Kärnten. Die Auswertung der Interviews basiert auf einer qualitativen Inhaltsanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Begriffsdefinitionen (Bedürfnis, Erwartung, Droge, Sucht, Substitution, Geschichte der Opioide, Wirkung von Opiaten, Intoxikation, Missbrauch, Sucht, Abhängigkeit, Entzug), Substitution (Methadon-Substitution, Opiatabhängigkeit in Österreich, rechtliche Rahmenbedingungen), Psychosoziale Beratung und Betreuung (gesetzliche Grundlagen, allgemeine Prinzipien, Kompetenzen, Situation Abhängigkeitskranker, Therapiemotivation, motivierende Gesprächsführung, Psychoedukation), Empirischer Teil (Durchführung und Auswertung der Interviews, Teilnehmer), Präsentation der Interviews, Schlussfolgerungen und Resümee.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 2 definiert zentrale Begriffe und legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 beleuchtet die Substitution, insbesondere die Methadon-Substitution und den rechtlichen Rahmen in Österreich. Kapitel 4 analysiert die Psychosoziale Beratung und Betreuung, ihre Aufgaben und die notwendigen Kompetenzen der Fachkräfte. Kapitel 5 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung (Interviews und deren Auswertung). Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Interviews. Kapitel 7 zieht Schlussfolgerungen und fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Psychosoziale Betreuung, Suchtkranke, Substitution, Methadon, Opiatabhängigkeit, Erwartungen, Kärnten, Qualitative Inhaltsanalyse, Interviews, Soziale Arbeit, Therapiemotivation, Motivierende Gesprächsführung, Psychoedukation.
Wer waren die Teilnehmer der Studie?
Die Teilnehmer der Studie waren suchtkranke Menschen in Kärnten, die an einer Substitutionsbehandlung teilnahmen. Details zur Auswahl der Teilnehmer sind im Kapitel "Empirischer Teil" der Arbeit beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Studie, d.h. die Erwartungen der suchtkranken Menschen an die psychosoziale Betreuung und deren Vergleich mit den realen Möglichkeiten und den Literaturstandards, sind im Kapitel "Interviews" und "Schlussfolgerungen" der Arbeit detailliert dargestellt.
- Quote paper
- MA Martin Kutej (Author), 2015, Psychosoziale Betreuung suchtkranker Menschen im Substitutionsprogramm in Kärnten und deren Erwartungen in die Betreuung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294977